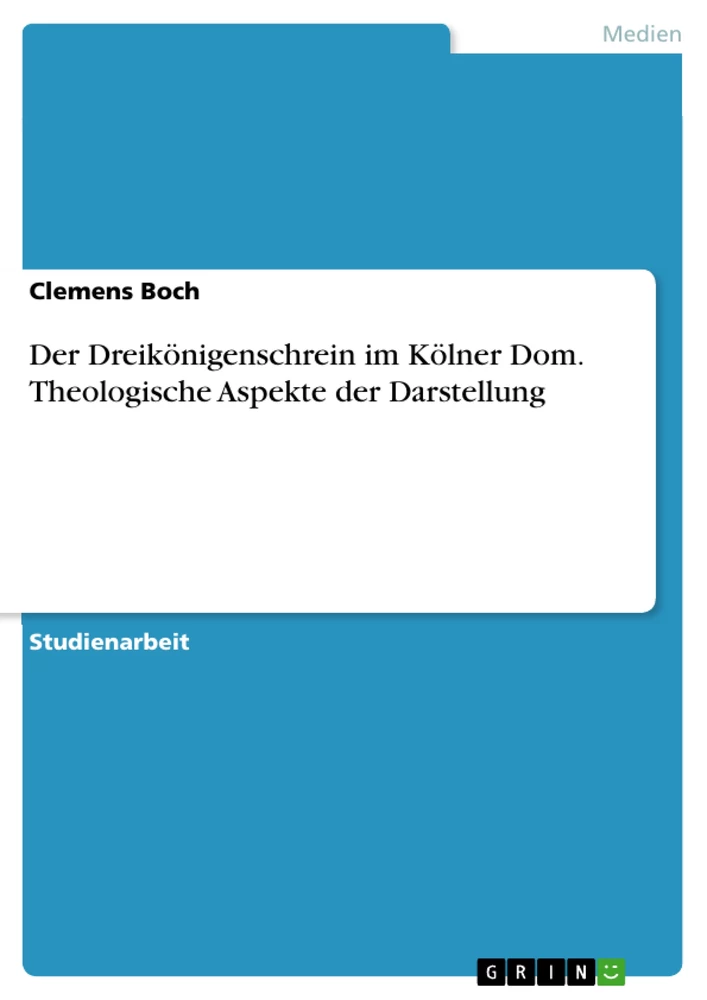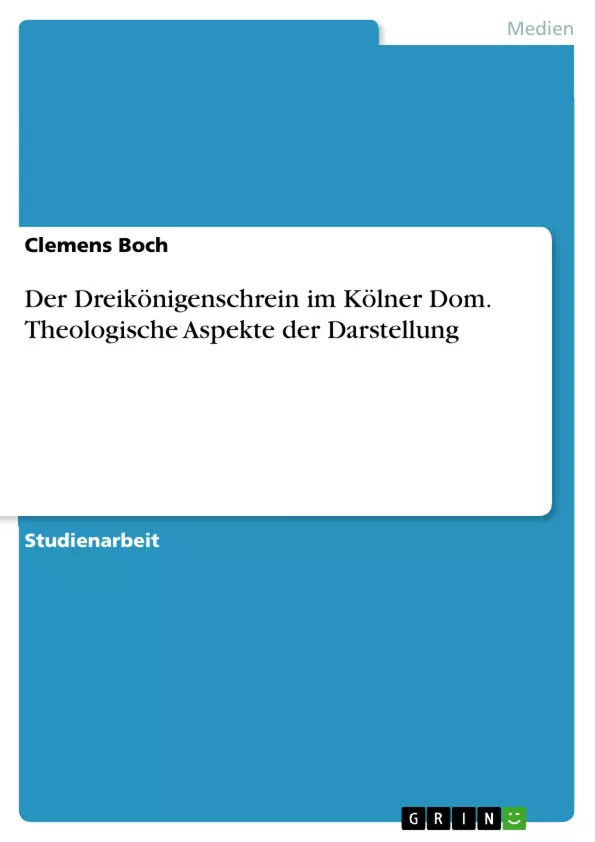Diese Arbeit verfolgt das Ziel, wesentliche Aspekte des Darstellungen auf dem Dreikönigenschrein im Kölner Dom zu erläutern und in Grundzügen darzulegen.
Das ikonographische Programm enthält eine theologische und eine politische Komponente, die aussagemäßig miteinander verknüpft sind. Diese Ausführungen werden sich dabei weitestgehend auf den theologischen Gehalt beschränken, da aufgrund der Vielschichtigkeit die politische Dimension der Darstellungen, wie etwa die Krönungssymbolik, unbehandelt bleiben muss. Auf die Entstehungsgeschichte des Schreines hinführend, wird zu Beginn kurz die Translation der Reliquien rekonstruiert.
Nach einer Beschreibung der Gestalt des Schreines widmet sich der Hauptteil dann dem umfangreichen Bildprogramm, wobei vor allem der Stirnseite Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Darstellungen der Stirnseite werden unter Rückgriff auf die Arbeit von Axel und Martina Werbke behandelt, die darin bisherige Forschungsergebnisse in Frage stellen und in ihren Untersuchungen in vielen Punkten zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Übertragung der Reliquien / Entstehungsgeschichte des Schreins
- 3. Gestalt
- 4. Darstellungsprogramm des Schreines
- 4.1 Stirnseite
- 4.2 Rückseite
- 4.3 Langseiten
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, wesentliche Aspekte des Darstellungsprogramms des Dreikönigenschreins im Kölner Dom zu erläutern und in Grundzügen darzustellen. Der Fokus liegt auf dem theologischen Gehalt des ikonographischen Programms, wobei die politische Dimension nur am Rande betrachtet wird. Die komplexe Entstehungs- und Restaurationsgeschichte des Schreins wird ebenfalls beleuchtet.
- Die Übertragung der Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln und die damit verbundene Bedeutung für die Stadt.
- Die Gestalt des Schreins und seine architektonische Besonderheiten im Vergleich zu anderen romanischen Schreinen.
- Das theologische Darstellungsprogramm des Schreins, insbesondere die Ikonographie der Stirnseite und die Rolle des Ptolomäer-Kameos.
- Die ikonographischen Programme der Rückseite und der Langseiten im Kontext der Heilsgeschichte.
- Die Bedeutung der Dreizahl im ikonographischen Programm.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Dreikönigenschreins ein. Sie beschreibt die Überführung der Reliquien der Heiligen Drei Könige nach Köln durch Rainald von Dassel und deren immense Bedeutung für die Stadt. Der Schrein wird als bedeutendste Goldschmiedearbeit des Hochmittelalters vorgestellt, wobei die komplexe Entstehungs- und Restaurationsgeschichte hervorgehoben wird. Die Arbeit fokussiert auf die theologischen Aspekte des Darstellungsprogramms, unter Bezugnahme auf relevante Forschungsliteratur. Die Verknüpfung theologischer und politischer Komponenten im Bildprogramm wird erwähnt, wobei der Schwerpunkt auf der theologischen Interpretation liegt.
2. Übertragung der Reliquien / Entstehungsgeschichte des Schreins: Dieses Kapitel rekonstruiert den Weg der Reliquien der Heiligen Drei Könige nach Köln, basierend auf mittelalterlichen Legenden und historischen Überlieferungen. Es beschreibt die Überführung der Reliquien von Palästina nach Konstantinopel, weiter nach Mailand und schließlich nach Köln durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa und Erzbischof Rainald von Dassel. Die Bedeutung der Reliquien für die Stadt Köln und den Beginn einer gesteigerten Verehrung der Heiligen Drei Könige wird hervorgehoben. Der Auftrag zum Bau des Schreins durch Erzbischof Philipp von Heinsberg und die Einbettung der Reliquien werden ebenfalls erläutert.
3. Gestalt: Dieses Kapitel beschreibt die Gestalt des Dreikönigenschreins, dessen zweigeschossiger Aufbau ihn von anderen romanischen Schreinen unterscheidet. Die architektonische Form, vergleichbar mit einer Basilika, wird analysiert und die Bedeutung der Erweiterung der einfachen Kastenform für das ikonographische Programm wird diskutiert. Die um 1200 erfolgte Planänderung mit der Einfügung der abnehmbaren Trapezplatte und die damit verbundene Veränderung der Reliquienverehrung werden erläutert. Verschiedene Interpretationen der Gestaltung, insbesondere der Stirn- und Rückseite, werden gegenübergestellt und die Rolle der Dreizahl im Aufbau wird diskutiert.
4. Darstellungsprogramm des Schreines: Dieses Kapitel analysiert das umfassende ikonographische Programm des Schreins, gegliedert nach Stirnseite, Rückseite und Langseiten. Die einzelnen Bildgruppen werden detailliert beschrieben und in ihren theologischen Kontext eingeordnet.
4.1 Stirnseite: Die detaillierte Analyse der Stirnseite konzentriert sich auf die zentrale Darstellung der thronenden Gottesmutter mit dem Jesuskind, die Anbetung der Heiligen Drei Könige, die Taufe Christi und die Darstellung Christi als Weltenrichter. Die Bedeutung des (ehemalig vorhandenen) Ptolomäer-Kameos und der anderen Edelsteine auf der Trapezplatte wird ausführlich erörtert, mit Berücksichtigung unterschiedlicher Forschungsergebnisse bezüglich der Interpretation und der ursprünglichen Gestaltung.
4.2 Rückseite: Die Rückseite des Schreins wird analysiert, wobei der Eindruck von drei nebeneinandergestellten Schreinen hervorgehoben wird. Die einzelnen Bildgruppen, analog zur Stirnseite, werden in Bezug auf die Passion Christi interpretiert. Die Darstellung Rainalds von Dassel als Stifterfigur und die Personifikationen von Tugenden werden ebenfalls erläutert. Die theologische Bedeutung der Bildkompositionen wird im Detail diskutiert.
4.3 Langseiten: Die Analyse der Langseiten berücksichtigt die umfassenden Restaurierungen und die dadurch bedingten Veränderungen. Die Gliederung nach Dreiergruppen, bestehend aus Propheten, Aposteln und Engeln, wird erläutert. Die Bedeutung der Prophetenreihen, die Szenen aus dem Leben Jesu (ehemals auf den Dachflächen), und die Darstellung der Apostel mit ihren Attributen werden besprochen. Der Bezug zu einer typologischen Auslegungstradition der Bibel und der umfassende heilsgeschichtliche Anspruch des Bildprogramms werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Dreikönigenschrein, Köln, Hochmittelalter, Goldschmiedekunst, Ikonographie, Theologie, Politik, Reliquien, Heilsgeschichte, Nikolaus von Verdun, Ptolomäer-Kameo, Rainald von Dassel, Propheten, Apostel, Weltgericht, Dreizahl, Typologie.
Häufig gestellte Fragen zum Dreikönigenschrein in Köln
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Dreikönigenschrein im Kölner Dom. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und abschließend ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der theologischen Interpretation des ikonographischen Programms des Schreins.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Die Übertragung der Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln und deren Bedeutung, die Gestalt des Schreins und seine architektonischen Besonderheiten, das theologische Darstellungsprogramm des Schreins (insbesondere Stirnseite mit Ptolomäer-Kameo, Rückseite und Langseiten), die Bedeutung der Dreizahl im ikonographischen Programm und die komplexe Entstehungs- und Restaurationsgeschichte des Schreins.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Übertragung der Reliquien und Entstehungsgeschichte des Schreins, Gestalt des Schreins, Darstellungsprogramm des Schreins (unterteilt in Stirnseite, Rückseite und Langseiten) und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Dokumentenzusammenfassung kurz beschrieben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, wesentliche Aspekte des Darstellungsprogramms des Dreikönigenschreins zu erläutern und darzustellen. Der Fokus liegt auf dem theologischen Gehalt des ikonographischen Programms, während die politische Dimension nur am Rande betrachtet wird.
Wie wird die Entstehungsgeschichte des Schreins behandelt?
Die Entstehungsgeschichte beschreibt den Weg der Reliquien nach Köln, beginnend in Palästina über Konstantinopel und Mailand. Der Auftrag zum Bau des Schreins durch Erzbischof Philipp von Heinsberg und die Einbettung der Reliquien werden erläutert. Die Bedeutung der Reliquien für Köln und den Beginn einer gesteigerten Verehrung der Heiligen Drei Könige wird hervorgehoben.
Wie wird die Gestalt des Schreins beschrieben?
Die Gestalt des Schreins wird als zweigeschossiger Aufbau beschrieben, der ihn von anderen romanischen Schreinen unterscheidet. Die architektonische Form, vergleichbar mit einer Basilika, wird analysiert. Die um 1200 erfolgte Planänderung mit der Einfügung der abnehmbaren Trapezplatte und deren Auswirkungen auf die Reliquienverehrung werden erläutert.
Wie wird das Darstellungsprogramm des Schreins analysiert?
Das Darstellungsprogramm wird nach Stirnseite, Rückseite und Langseiten gegliedert analysiert. Die einzelnen Bildgruppen werden detailliert beschrieben und in ihren theologischen Kontext eingeordnet. Die Analyse umfasst die Ikonographie der einzelnen Szenen und deren Bedeutung im Kontext der Heilsgeschichte. Die Rolle des Ptolomäer-Kameos und die Bedeutung der Dreizahl werden ausführlich diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Dreikönigenschrein, Köln, Hochmittelalter, Goldschmiedekunst, Ikonographie, Theologie, Politik, Reliquien, Heilsgeschichte, Nikolaus von Verdun, Ptolomäer-Kameo, Rainald von Dassel, Propheten, Apostel, Weltgericht, Dreizahl, Typologie.
- Arbeit zitieren
- Clemens Boch (Autor:in), 2012, Der Dreikönigenschrein im Kölner Dom. Theologische Aspekte der Darstellung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305248