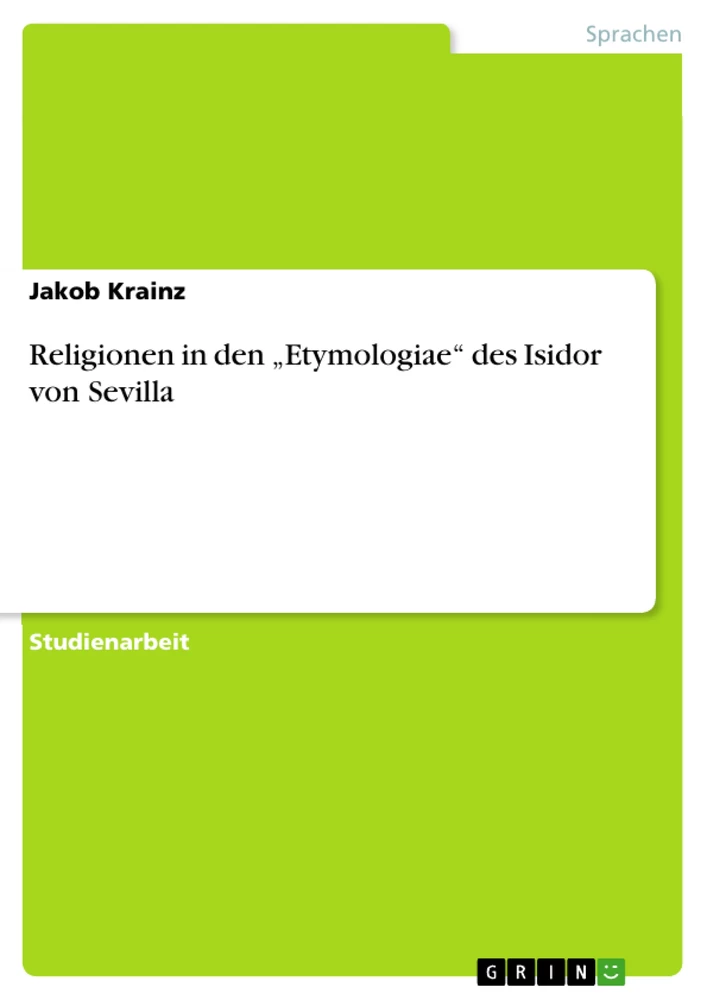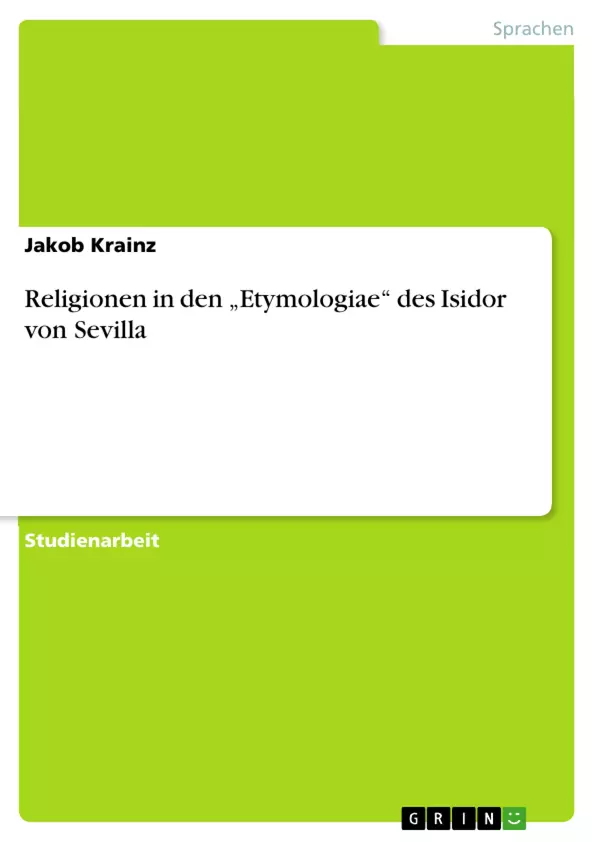Im Rahmen meiner Proseminararbeit möchte ich untersuchen, was Isidor von Sevilla in seinem Werk „Etymolgiae“ zu den, zu seiner Zeit bestehenden, verschiedenen Religionsgemeinschaften schrieb. Hierzu werde ich erst den zeitlichen Kontext unter besonderer Berücksichtigung der religiösen Lebensverhältnisse der westgotischen Gesellschaft umreißen. Danach versuche ich darzustellen, wie der katholische Bischof Isidor nicht katholische Religionen darstellt. Differenziert er hierbei zwischen verschiedenen Konfessionen und gänzlich anderen Religionen? Was sagen die Schriften Isidors über das Selbstverständnis, des katholischen Glaubens aus? Welche Verhaltensrichtlinien empfiehlt Isidor seinen Anhängern im Umgang mit Andersgläubigen? Und inwiefern spiegeln sich seine Vorstellungen in seinem Handeln im historischen Kontext?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Inhalt
- Einleitung
- Fragestellung
- Zum Forschungsstand
- Zeitlicher Kontext
- Isidor von Sevilla
- Biographisches zu Isidor
- Schriften von Isidor
- Religionen in Isidors Etymologie
- Heiden
- Häresien der Juden
- Häresien der Christen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Bücher
- Internetadressen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Proseminararbeit befasst sich mit der Darstellung von Religionen in Isidors Werk „Etymologiae“. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie Isidor verschiedene Religionsgemeinschaften seiner Zeit in seinen Schriften beschreibt. Dabei soll die Zeit und das religiöse Lebensumfeld der westgotischen Gesellschaft beleuchtet werden.
- Die Darstellung nicht-katholischer Religionen durch den katholischen Bischof Isidor.
- Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Konfessionen und anderen Religionen in Isidors Schriften.
- Die Aussagen über das Selbstverständnis des katholischen Glaubens in Isidors Werken.
- Verhaltensrichtlinien für den Umgang mit Andersgläubigen, die Isidor seinen Anhängern empfiehlt.
- Die Spiegelung von Isidors Vorstellungen in seinem Handeln im historischen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den zeitlichen Kontext der Arbeit dar. Sie erläutert den Forschungsstand und die Bedeutung der „Etymologiae“ als Quelle für das Verständnis der religiösen Lebenswelt im westgotischen Reich.
- Zeitlicher Kontext: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte des Westgotenreichs vom 5. bis zum 7. Jahrhundert, mit Fokus auf die religiösen Konflikte zwischen Arianern und Katholiken. Besonderes Augenmerk liegt auf der Konversion der Westgoten zum katholischen Glauben und den damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen.
- Isidor von Sevilla: Dieses Kapitel beleuchtet die Biographie von Isidor von Sevilla und seine Rolle als Bischof und Gelehrter. Es stellt seine wichtigsten Schriften vor und betont seine Bedeutung als Übermittler antiker Traditionen für das lateinische Mittelalter.
- Religionen in Isidors Etymologie: Dieses Kapitel analysiert, wie Isidor in seinen „Etymologiae“ verschiedene Religionen darstellt. Es untersucht seine Ansichten über Heiden, Häresien im Judentum und im Christentum.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die „Etymologiae“ von Isidor von Sevilla und ihre Darstellung verschiedener Religionen. Wichtige Schlüsselwörter sind: Westgoten, Arianismus, Katholizismus, Judentum, Heidentum, Häresie, Selbstverständnis des christlichen Glaubens, Umgang mit Andersgläubigen, historischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Etymologiae" von Isidor von Sevilla?
Es ist ein enzyklopädisches Werk des 7. Jahrhunderts, das das Wissen der Antike für das Mittelalter bewahrte und ordnete.
Wie stellte Isidor das Judentum dar?
Isidor betrachtete das Judentum oft im Kontext von Häresien und setzte sich kritisch mit deren Lehren aus einer katholischen Perspektive auseinander.
Welchen Standpunkt vertrat er gegenüber "Heiden"?
Heiden wurden als Menschen außerhalb des christlichen Glaubens beschrieben, deren Bräuche und Götter Isidor etymologisch herleitete und oft als Irrglauben darstellte.
In welchem religiösen Kontext lebte Isidor?
Er lebte im Westgotenreich während des Übergangs vom Arianismus zum Katholizismus, was sein Bestreben nach religiöser Einheit prägte.
Welche Verhaltensrichtlinien gab Isidor im Umgang mit Andersgläubigen?
Die Arbeit untersucht, ob Isidor zur Abgrenzung, Missionierung oder zu einem bestimmten rechtlichen Umgang mit religiösen Minderheiten riet.
- Quote paper
- Jakob Krainz (Author), 2015, Religionen in den „Etymologiae“ des Isidor von Sevilla, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305252