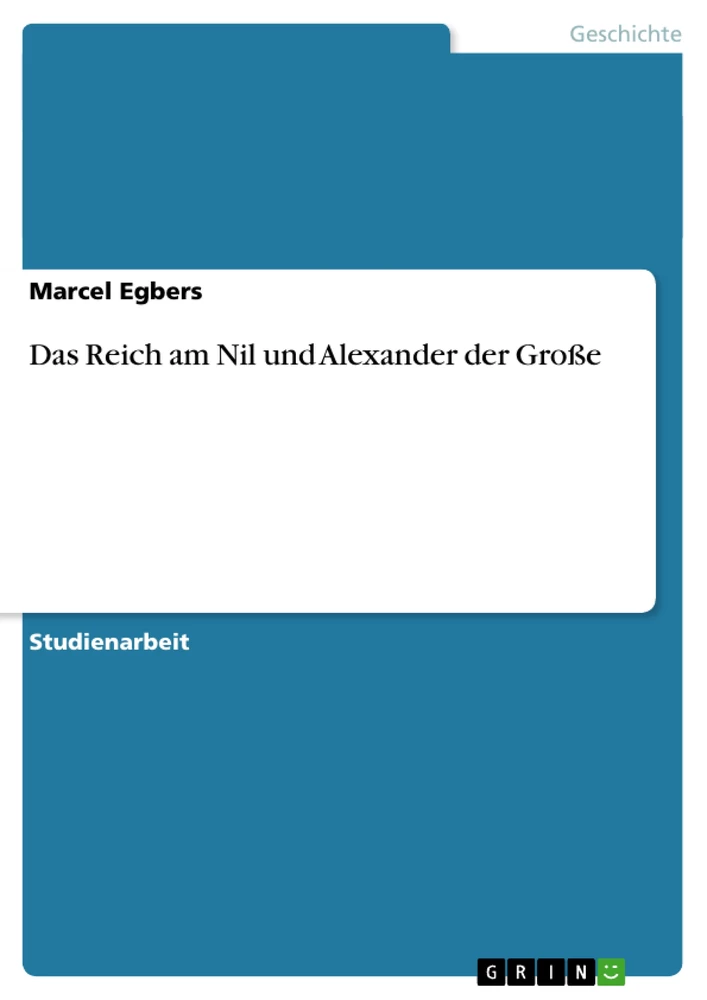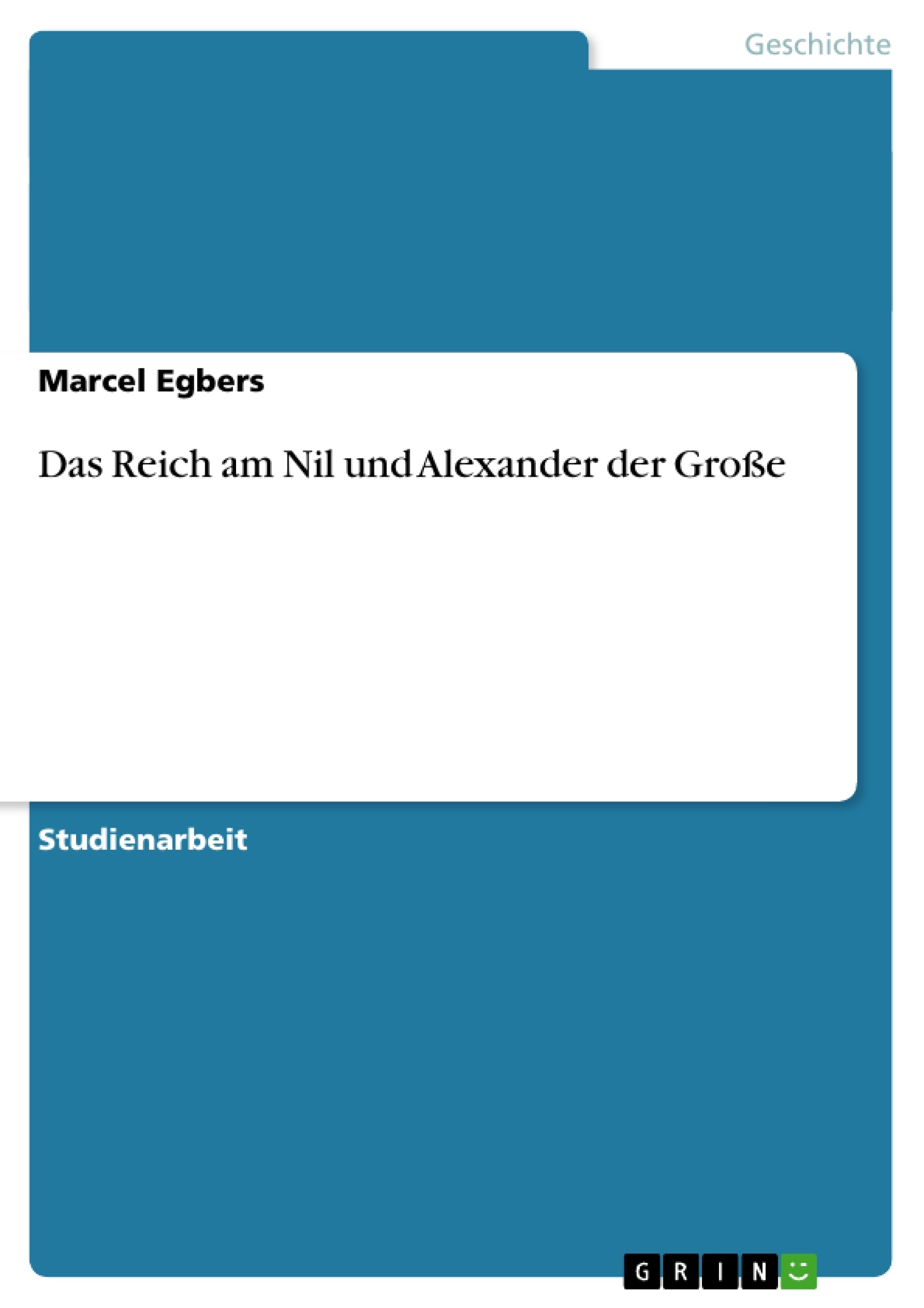Mit diesen Worten begann der bedeutende Historiker Johann Gustav Droysen seine „Geschichte des Hellenismus“. Und durch diese Worte werden gleich zwei Sachverhalte deutlich: Erstens, wie sehr das Wirken Alexanders die damalige Gesellschaft verändert hat und die Folgen seiner Taten der Welt ein vollkommen neues Gesicht verliehen. Zweitens, wie stark die Gestalt Alexanders des Großen zu einem personalisierten Geschichtsbild verlockt, in dem historische Ereignisse stets aus der Sicht Alexanders erklärt und verstanden werden - der Geschichtsverlauf stets mit dem Leben dieser „großen Persönlichkeit“ gleichgesetzt wird. Doch man kann Droysen kaum einen Vorwurf machen, dass er die Entwicklung und Ausbreitung der hellenistischen Kultur so sehr mit Alexander in Verbindung setzte, denn dieser makedonische Herrscher ist „vielleicht das beste Beispiel dafür, daß in der Tat ganz erhebliche Veränderungen von welthistorischer Bedeutung durch das Handeln eines Individuums möglich sind.“ 2
Aber trotz der immensen Bedeutung Alexanders des Großen sollte man bei historischer Forschung das Blickfeld nicht bloß auf ihn verengen. Wie der Philosoph Walter Benjamin treffend feststellte, läuft der Historiker schnell in Gefahr, sich zu sehr in die Sieger einzufühlen; die Besiegten erfahren dabei nur geringe Beachtung. 3 Und so erinnern viele Forschungsarbeiten an eine Kamerafahrt um Alexander, bei der allein seine Motive und Handlungen im Vo r-dergrund stehen. Was in den Jahren vor seiner Ankunft in den später eroberten Gebieten geschehen war, oder was die Motive der Unterworfenen waren, sich Alexander gegenüber so zu verhalten, wie sie es taten, das wird meist nur am Rande erwähnt.
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist Alexanders Zug nach Ägypten - seine Gründe für den Ägyptenmarsch, sein Vorgehen und die Herrschaftssicherung. Dabei sollen aber auch die Ägypter selbst und ihre Kultur gewürdigt werden. Insofern beschäftigen folgende Seiten sich nicht nur mit der Frage, was die Ziele Alexanders waren und wie er sie durchsetzte, sondern auch damit, wie die Ägypter auf den neuen Herrscher reagierten und warum sie so wenig Wi-derstand leisteten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Blick aus Ägypten
- 2.1. Der Pharao – ein göttlicher Herrscher
- 2.2. Von den libyschen Königen bis zu den persischen Eroberern
- 3. Das Wirken Alexanders in Ägypten
- 3.1. Die Herrschaftsübernahme
- 3.2. Die Gründung Alexandrias und der Marsch zum Orakel von Siwa
- 3.2.1. Eine neue Metropole
- 3.2.2. Die Befragung des Ammonorakels
- 4. Alexander der Große in Ägypten und sein Nachwirken – eine Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Alexanders Feldzug nach Ägypten, seine Gründe dafür, seine Vorgehensweise und die Sicherung seiner Herrschaft. Im Fokus steht nicht nur Alexanders Perspektive, sondern auch die der Ägypter und ihre Reaktion auf den neuen Herrscher. Die Arbeit beleuchtet die ägyptische Kultur und das vorherrschende Herrschaftssystem, um Alexanders Erfolg besser zu verstehen.
- Alexanders Eroberung Ägyptens
- Das ägyptische Herrschaftssystem vor Alexander
- Die Rolle des Pharaos
- Die Reaktion der Ägypter auf Alexanders Herrschaft
- Die Bedeutung der ägyptischen Kultur und Tradition
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung diskutiert die Bedeutung Alexanders des Großen für die Geschichte und die Tendenz, historische Ereignisse aus seiner Perspektive zu betrachten. Sie betont die Notwendigkeit, auch den Blickwinkel der Beherrschten einzubeziehen und kündigt das Thema der Arbeit an: Alexanders Feldzug nach Ägypten, unter Berücksichtigung der ägyptischen Sichtweise. Die Einleitung unterstreicht den Mangel an Forschung zu dieser Spätzeit des Alten Ägyptens und die Notwendigkeit, den historischen Kontext zu beleuchten, um Alexanders Machtübernahme zu verstehen.
2. Der Blick aus Ägypten: Dieses Kapitel untersucht das ägyptische Herrschaftssystem vor Alexanders Ankunft. Der Fokus liegt auf dem Pharao als göttlichem Herrscher und der engen Verflechtung von religiösen, kulturellen und politischen Entwicklungen. Es analysiert die Vorstellung des Pharaos als Horus und Sohn des Ra, sein Monopol auf den Kontakt zur göttlichen Welt, und die Bedeutung kultischer Handlungen für den Erhalt der kosmischen Ordnung (Maat). Das Kapitel diskutiert auch die unterschiedlichen Interpretationen des Gottstatus des Pharaos und die mögliche Abnahme des Glaubens an eine personelle Göttlichkeit im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Alexander der Große, Ägypten, Hellenismus, Pharao, Maat, Isfet, Herrschaftsübernahme, ägyptische Kultur, religiöse und politische Entwicklung, historische Forschungsperspektive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Alexanders Feldzug nach Ägypten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Alexanders Feldzug nach Ägypten. Sie beleuchtet nicht nur Alexanders Perspektive, sondern auch die der Ägypter und ihre Reaktion auf den neuen Herrscher. Der Fokus liegt auf Alexanders Eroberung, seiner Herrschaftssicherung und dem ägyptischen Herrschaftssystem vor seiner Ankunft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Alexanders Eroberung Ägyptens, das ägyptische Herrschaftssystem vor Alexander, die Rolle des Pharaos, die Reaktion der Ägypter auf Alexanders Herrschaft und die Bedeutung der ägyptischen Kultur und Tradition. Sie analysiert die ägyptische Kultur und das vorherrschende Herrschaftssystem, um Alexanders Erfolg besser zu verstehen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel über den Blick aus Ägypten (inkl. Pharao und Herrschaftssystem), ein Kapitel über Alexanders Wirken in Ägypten (inkl. Gründung Alexandrias und Orakel von Siwa) und eine Zusammenfassung.
Wie wird der Pharao in der Arbeit dargestellt?
Das Kapitel "Der Blick aus Ägypten" untersucht den Pharao als göttlichen Herrscher und die enge Verflechtung von religiösen, kulturellen und politischen Entwicklungen. Es analysiert seine Vorstellung als Horus und Sohn des Ra, sein Monopol auf den Kontakt zur göttlichen Welt und die Bedeutung kultischer Handlungen für den Erhalt der kosmischen Ordnung (Maat).
Welche Quellen werden verwendet? (Diese Frage kann erst beantwortet werden, wenn die vollständigen Quellenangaben verfügbar sind.)
Diese Information ist im vorliegenden Text nicht enthalten. Die Quelle der Informationen ist als OCR-Daten eines Verlags bezeichnet, die für die akademische Analyse bestimmt sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alexander der Große, Ägypten, Hellenismus, Pharao, Maat, Isfet, Herrschaftsübernahme, ägyptische Kultur, religiöse und politische Entwicklung, historische Forschungsperspektive.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht Alexanders Feldzug nach Ägypten, seine Gründe, seine Vorgehensweise und die Sicherung seiner Herrschaft. Sie betont die Notwendigkeit, den Blickwinkel der Beherrschten (der Ägypter) einzubeziehen und den historischen Kontext zu beleuchten, um Alexanders Machtübernahme zu verstehen.
Welche Perspektive wird in der Arbeit eingenommen?
Die Arbeit nimmt nicht nur Alexanders Perspektive ein, sondern betont die Notwendigkeit, auch die Sichtweise der Ägypter und ihre Reaktion auf den neuen Herrscher zu berücksichtigen. Sie versucht, ein umfassenderes Bild des historischen Ereignisses zu zeichnen.
- Quote paper
- Marcel Egbers (Author), 2004, Das Reich am Nil und Alexander der Große, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30532