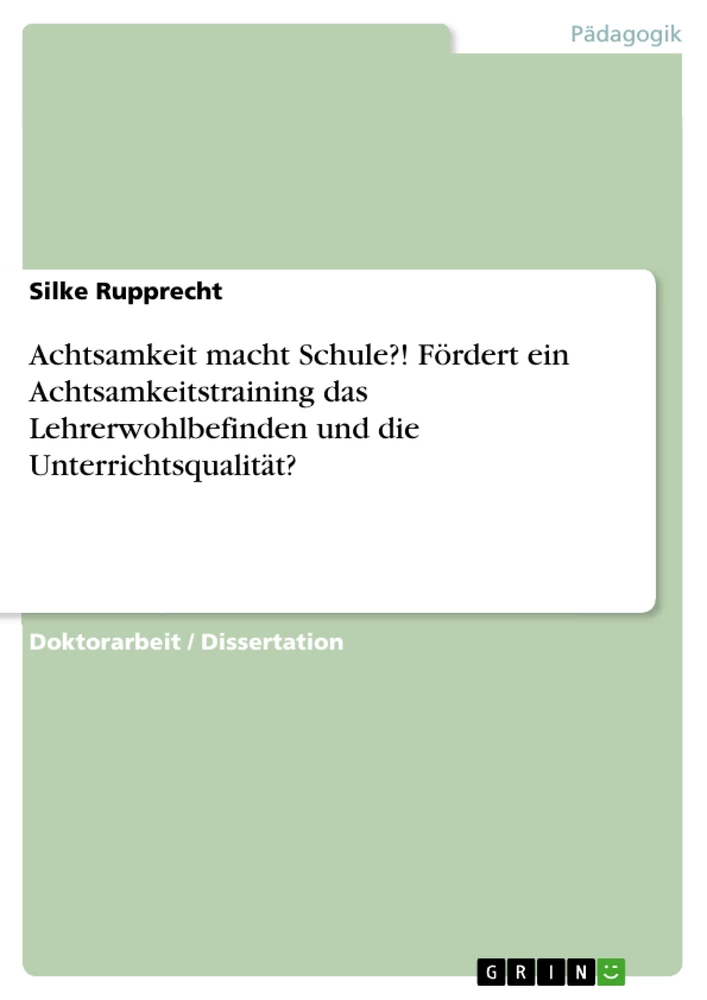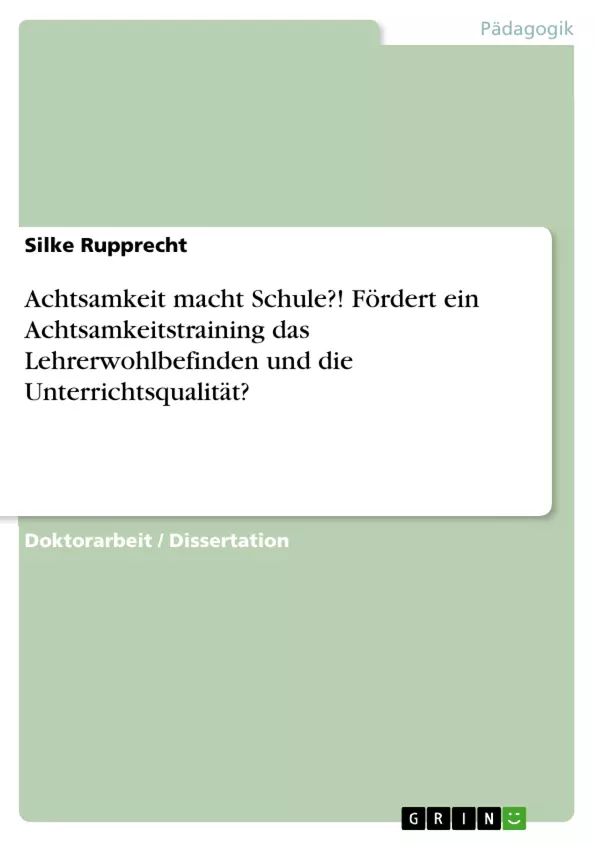Selbstregulative Fähigkeiten stehen in Zusammenhang mit Lehrergesundheit und mit erfolgreichem Lehrerhandeln. Es ist bislang jedoch kaum erforscht, wie Lehrkräfte ihre selbstregulativen Fähigkeiten entwickeln und beibehalten können. Diese Dissertation verfolgte das Ziel, die Wirksamkeit eines Achtsamkeitstrainings (Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) für die Förderung des Wohlbefindens, der Selbstregulationsfähigkeit und der Unterrichtsqualität von Lehrkräften zu untersuchen.
Methode: Die Stichprobe umfasste 32 Lehrkräfte (94 % weiblich) aus Hamburg, die auf eine Wartekontrollgruppe (n=14) und eine Interventionsgruppe (n=18) aufgeteilt wurden. Das Lehrerwohlbefinden und die selbstregulativen Fähigkeiten wurden vor dem Training, direkt nach dem Training und drei Monate nach dem Training erfasst. Zusätzlich schätzten Schüler_innen (n=320) die Unterrichts-und Beziehungsqualität der Lehrkraft ein. Qualitative Interviews wurden mit den Lehrkräften nach dem Training durchgeführt, um mehr über die Trainingseffekte auf das Unterrichtshandeln zu erfahren.
Ergebnisse: Das Training zeigte mittlere bis hohe Effekte auf das Lehrerwohlbefinden und die Selbstregulationsfähigkeiten. Mediationsanalysen zeigten, dass die Zunahme von achtsamer Präsenz und achtsamer Akzeptanz zum Nachtest viele Verbesserungen in den Ergebnisvariablen zum Follow-Up mediierten. Das Lehrerwohlbefinden im Vortest stand unter anderem in bedeutsamen Zusammenhang mit der Lehrerzufriedenheit aus Schülersicht. Obwohl keine Trainingseffekte auf die Unterrichtsqualität aus Schülersicht gefunden wurden, zeigten die qualitativen Interviews mit den Lehrkräften auf, wie Achtsamkeit Lehrkräfte unterstützen kann, mit den beruflichen Anforderungen auf eine gesunde Weise umzugehen und ihre Unterrichtsqualität zu verbessern. Implikationen dieser Ergebnisse und ihre Anwendbarkeit in der Lehrerbildung und –weiterbildung werden diskutiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Forschungsstand und Forschungslücken
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Inklusive und exklusive Bildung
- Bildungsqualität
- Methoden der Untersuchung
- Forschungsdesign
- Stichprobenbeschreibung
- Ergebnisse der Untersuchung
- Befragung der Schüler
- Soziale Beziehungen
- Lernmotivation
- Selbstkonzept
- Befragung der Lehrer
- Lehrkräfte-Schüler-Beziehung
- Unterrichtsqualität
- Unterrichtliche Gestaltung des Inklusionsprozesses
- Diskussion der Ergebnisse
- Zusammenfassende Ergebnisse
- Zusammenhänge und Einflussfaktoren
- Implikationen für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der Inklusion auf die Bildungsqualität und die soziale Integration von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in der Sekundarstufe I. Im Fokus der Arbeit stehen die Perspektiven der Schüler und Lehrer auf die Inklusion und deren Auswirkungen auf wichtige Aspekte der Bildungs- qualität wie die soziale Integration, die Lernmotivation und das Selbstkonzept der Schüler sowie die Gestaltung des Unterrichts durch die Lehrer.
- Inklusion in der Sekundarstufe I
- Bildungsqualität aus Schüler- und Lehrerperspektive
- Soziale Integration von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf
- Lernmotivation und Selbstkonzept
- Gestaltung des Unterrichts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die Untersuchung und führt in die Thematik der Inklusion in der Sekundarstufe I ein. Es werden die wichtigsten theoretischen Ansätze zur Inklusion vorgestellt und die Forschungs- lücken sowie die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Inklusion, insbesondere die Konzepte der inklusiven und exklusiven Bildung und die Bedeutung der Bildungsqualität.
- Methoden der Untersuchung: Hier werden das Forschungsdesign und die Methoden der Datenerhebung und -analyse vorgestellt. Außerdem wird die Stichproben- beschreibung und die Auswahl der Untersuchungsschulen dargestellt.
- Ergebnisse der Untersuchung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Schüler- und Lehrerbefragung präsentiert und analysiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Inklusion, Bildungsqualität, Sekundarstufe I, sozialer Integration, Lernmotivation, Selbstkonzept, Unterrichts- qualität, empirische Forschung, quantitative Methoden, Befragung, Schülerperspektive, Lehrerperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Kann Achtsamkeitstraining das Wohlbefinden von Lehrkräften steigern?
Ja, Studien zeigen, dass MBSR-Trainings (Mindfulness-Based Stress Reduction) positive Effekte auf das Wohlbefinden und die Selbstregulationsfähigkeiten von Lehrern haben.
Was ist MBSR im schulischen Kontext?
MBSR ist ein strukturiertes Programm zur Stressbewältigung durch Achtsamkeit, das Lehrkräften hilft, gelassener mit beruflichen Anforderungen umzugehen.
Beeinflusst die Achtsamkeit der Lehrer die Unterrichtsqualität?
Obwohl direkte Effekte auf die fachliche Qualität oft schwer messbar sind, verbessert Achtsamkeit die Beziehungsqualität zu den Schülern und die Präsenz im Unterricht.
Wie hängen Lehrergesundheit und Schülerzufriedenheit zusammen?
Ein höheres Wohlbefinden der Lehrkraft korreliert oft mit einer höheren Zufriedenheit der Schüler, da die soziale Interaktion positiver gestaltet wird.
Welche Rolle spielt Inklusion für die Bildungsqualität?
Inklusion erfordert eine hohe Anpassungsfähigkeit der Lehrkräfte. Achtsamkeit kann dabei helfen, die vielfältigen Bedürfnisse der Schüler im Inklusionsprozess besser wahrzunehmen.
- Quote paper
- Dr Silke Rupprecht (Author), 2014, Achtsamkeit macht Schule?! Fördert ein Achtsamkeitstraining das Lehrerwohlbefinden und die Unterrichtsqualität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305415