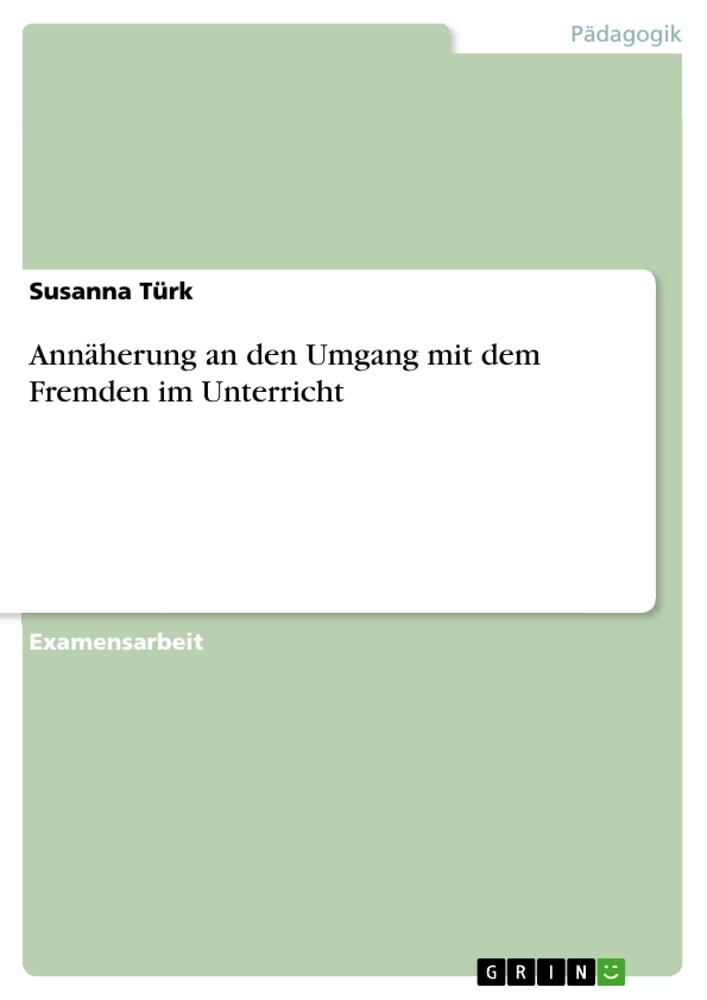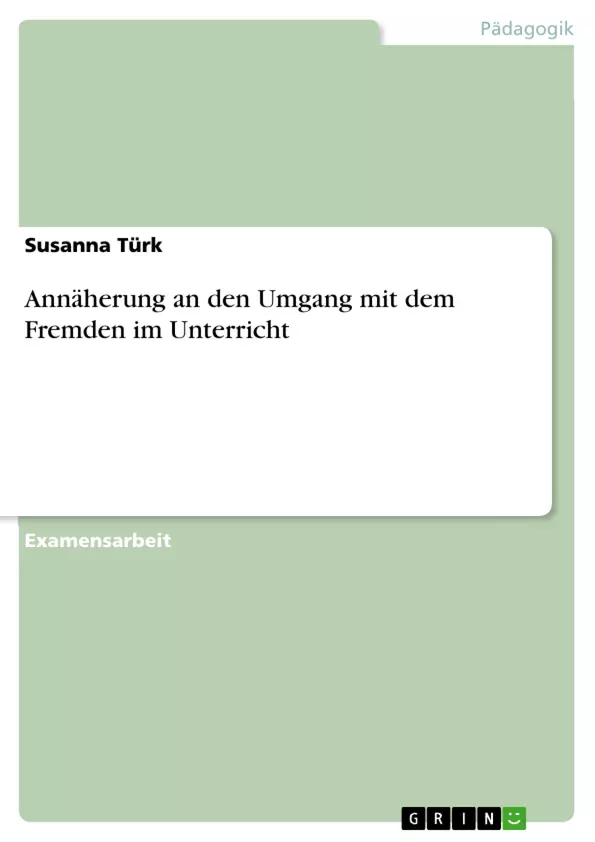In heutigen Zeiten gehören bewusste Konfrontationen mit dem Fremden fast schon zum Alltag. Entsprechend sinnvoll erscheinen pädagogische Hilfestellungen, um Kinder frühzeitig für dieses allgegenwärtige Phänomen zu öffnen.
Was ist Eigenes? Wie unterscheidet sich Fremdes von Eigenem bzw schlichtweg Anderem? Warum wird das Fremde vielfach als Bedrohung wahrgenommen und welche Bedeutung hat das Fremde für das Eigene? Diesen und ähnlichen Fragen gehen die theoretischen Kapitel dieser Arbeit nach. Dabei dienen insbesondere die philosophisch-phänomenologischen Analysen von Bernhard Waldenfels als hilfreiche Grundlage, um die schwer zu fassenden Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem greifbar erscheinen zu lassen.
Weiterhin werden unterschiedliche Steigerungsgrade des Fremden beleuchtet, welche das Fremde gleichermaßen als unbemerkter Begleiter sowie allgegenwärtige Herausforderung des Eigenen erkennen lassen. Aus diesen Ausführungen leitet sich der besondere Anspruch des Fremden ab. Das Fremde zeigt sich als eine ernst zu nehmende Krisenerfahrung, welcher vielfach mit Abwehr begegnet wird. In diesem Kontext werden auch gesellschaftliche Phänomene wie z.B. Rassismus, Stereotype und Vorurteile näher beleuchtet. Gleichzeitig wird das Fremde als notwendige Voraussetzung für die Entwicklung des Eigenen erkannt.
So bietet der theoretische Rahmen jedem Leser vielseitige Einblicke in das Phänomen des Fremden, um es eigenen Reflektionen zugänglich zu machen, während sich ein spannendes Wechselspiel zwischen den destruktiven und konstruktiven Kräften des Fremden eröffnet.
Der praktische Teil stellt eine qualitative Forschungsarbeit zum Umgang mit dem Fremden von Schülern im Unterricht vor. Dabei sind insbesondere zwei Fragen von Interesse:
1. Wie ist der Umgang von (insbesondere kleinen) Kindern mit dem Fremden?
2. Ist es möglich, Kinder im Falle von Abgrenzung im Unterricht für einen positiven Umgang mit dem Fremden zu sensibilisieren?
Mittels dieser Fragen wird herausgearbeitet, mit welchen Schwierigkeiten bei den Kindern/Schülern zu rechnen ist und mit welchen Mitteln eine angemessene Unterstützung möglich erscheint. Weiterhin werden Aufbau und Durchführung dieser qualitativen Forschungsarbeit ausführlich und nachvollziehbar dargestellt.
So beinhaltet diese Arbeit einige Grundlagen und Ideen für eigene Unterrichtsentwürfe und/oder weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema, welche den (eigenen) Schulalltag hoffentlich langfristig bereichern!
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Eigene, das Andere und das Fremde
- Das Eigene
- Das Andere und das Fremde
- Das „Anderswo“ und das „Außer-ordentliche“
- Der Anspruch des Fremden und seine Wirkungen
- Die Entdeckung der Fremderfahrung durch das Anderswo und das…
- Ein Wandel festgefahrener Denkgewohnheiten
- Möglichkeiten des Umgangs mit dem Fremden
- Aneignung
- Positive Aneignung
- Positive Aneignung durch das Fremde im Eigenen
- Stereotype und Vorurteile
- Rassismus
- Aneignung
- Bildung im Anspruch des Fremden
- Einleitung der praktischen Arbeit
- Das eigene Vorverständnis in Bezug auf das Fremde
- Das eigene Erkenntnisinteresse
- Methodologisches Positionieren und Vorgehen
- Der Zugang zum Feld
- Lerngruppenbeschreibung
- Methode der Untersuchung und Datenerhebung
- Methode der Transkription
- Methode der Auswertung
- Auswertung
- Auswertungsphase 1
- Konkrete Befragung zur Fremderfahrung
- Zuordnung der Bildergalerie zum Fremden und Bekannten
- Auswertungsphase 1 Die Diskussion der Collagenzuordnung
- Experiment zum Umgang mit dem Fremden
- Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch „Irgendwie Anders“
- Auswertungsphase 2
- Auswertungsphase 1
- Schwierigkeiten im Forschungsprozess
- Ergebnis
- Fazit und offene Fragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Fremderfahrungen auf die Entwicklung des Eigenen und die Herausforderungen, die sich aus dem Umgang mit dem Fremden im Unterricht ergeben. Susanna Türk analysiert verschiedene theoretische Ansätze, um die vielschichtigen Beziehungen zwischen Eigenem und Fremdem zu beleuchten und untersucht anschließend in einem praktischen Teil, wie sich Schüler mit dem Fremden auseinandersetzen.
- Die Problematik der Fremderfahrung und ihre Auswirkungen auf das Eigene
- Die Abgrenzung des Fremden durch Ordnungssysteme
- Die Möglichkeiten des Umgangs mit dem Fremden: Aneignung, Stereotype und Rassismus
- Das Potenzial von Bildungsprozessen im Umgang mit Fremdheit
- Die Rolle von Unterricht bei der Entwicklung eines positiven Umgangs mit dem Fremden
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der philosophischen Theorien von Bernhard Waldenfels, um das schwer greifende Phänomen des Fremden zu verstehen. Waldenfels argumentiert, dass das Fremde als das nicht vergleichbare Andere erscheint, das sich der eigenen Ordnung entzieht und den eigenen Vertrautheitshorizont überschreitet.
Kapitel 3 beleuchtet den Anspruch des Fremden auf das Eigene und dessen Wirkungen. Das Fremde stört die eigenen Ordnungssysteme, provoziert Sinn und stellt die eigenen Verstehensmöglichkeiten in Frage.
In Kapitel 4 werden verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit dem Fremden diskutiert, darunter die Aneignung, Stereotype und Rassismus. Waldenfels kritisiert die negative Aneignung, welche das Fremde dem Eigenen unterordnet.
Kapitel 5 behandelt die Bedeutung von Bildung im Hinblick auf den Umgang mit dem Fremden. Bildungsprozesse können die Transformation bestehender Strukturen ermöglichen und neue Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit dem Fremden eröffnen.
Der praktische Teil der Arbeit untersucht den Umgang von Schülern mit dem Fremden im Unterricht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Fremdheit, Aneignung, Stereotype, Rassismus, Bildung, Unterricht, Selbstreflexion und Problemorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Bernhard Waldenfels und was ist sein Beitrag zum Thema Fremdheit?
Waldenfels ist ein Philosoph, der die Phänomenologie des Fremden prägte. Er beschreibt das Fremde als etwas, das sich der eigenen Ordnung entzieht und den Vertrautheitshorizont überschreitet.
Warum wird das Fremde oft als Bedrohung wahrgenommen?
Weil es bestehende Ordnungssysteme stört und die eigenen Verstehensmöglichkeiten in Frage stellt, was oft zu Abwehrreaktionen wie Stereotypen führt.
Kann man Kindern einen positiven Umgang mit Fremdheit beibringen?
Ja, durch pädagogische Sensibilisierung im Unterricht können Kinder lernen, Fremdheit nicht als Krise, sondern als Bereicherung und Voraussetzung für die eigene Entwicklung zu sehen.
Welche Rolle spielen Bilderbücher wie „Irgendwie Anders“?
Sie dienen als methodisches Werkzeug, um Kindern Empathie für das „Andere“ zu vermitteln und über Ausgrenzungserfahrungen ins Gespräch zu kommen.
Was unterscheidet „Aneignung“ von echtem Verstehen?
Negative Aneignung versucht, das Fremde dem Eigenen unterzuordnen und passend zu machen, während echtes Verstehen die Andersartigkeit des Fremden bestehen lässt.
- Citar trabajo
- Susanna Türk (Autor), 2014, Annäherung an den Umgang mit dem Fremden im Unterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305459