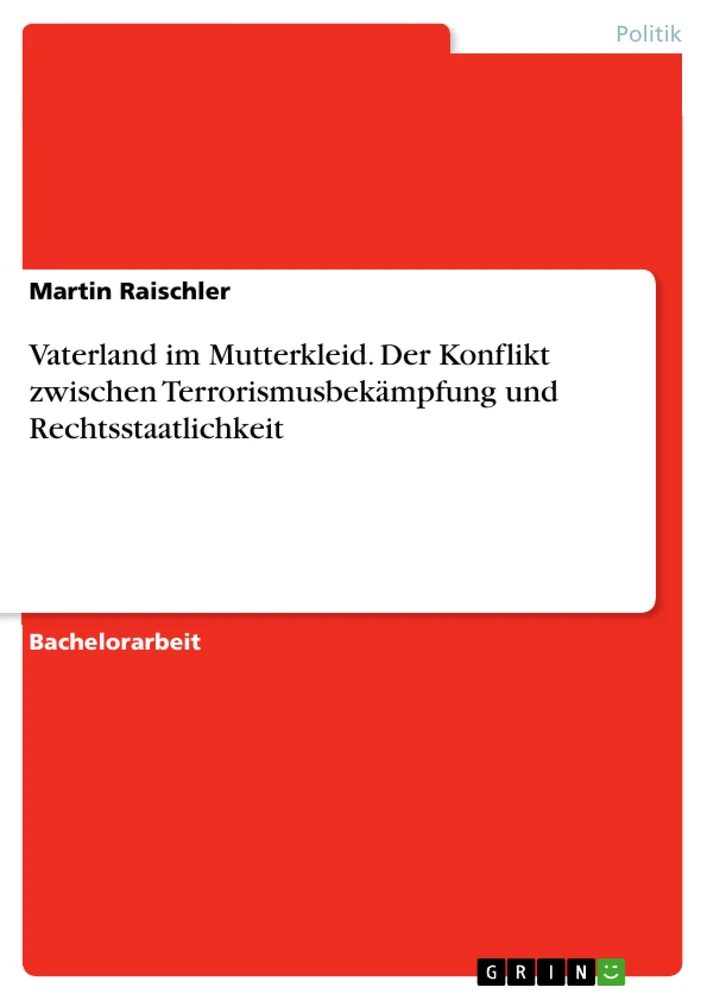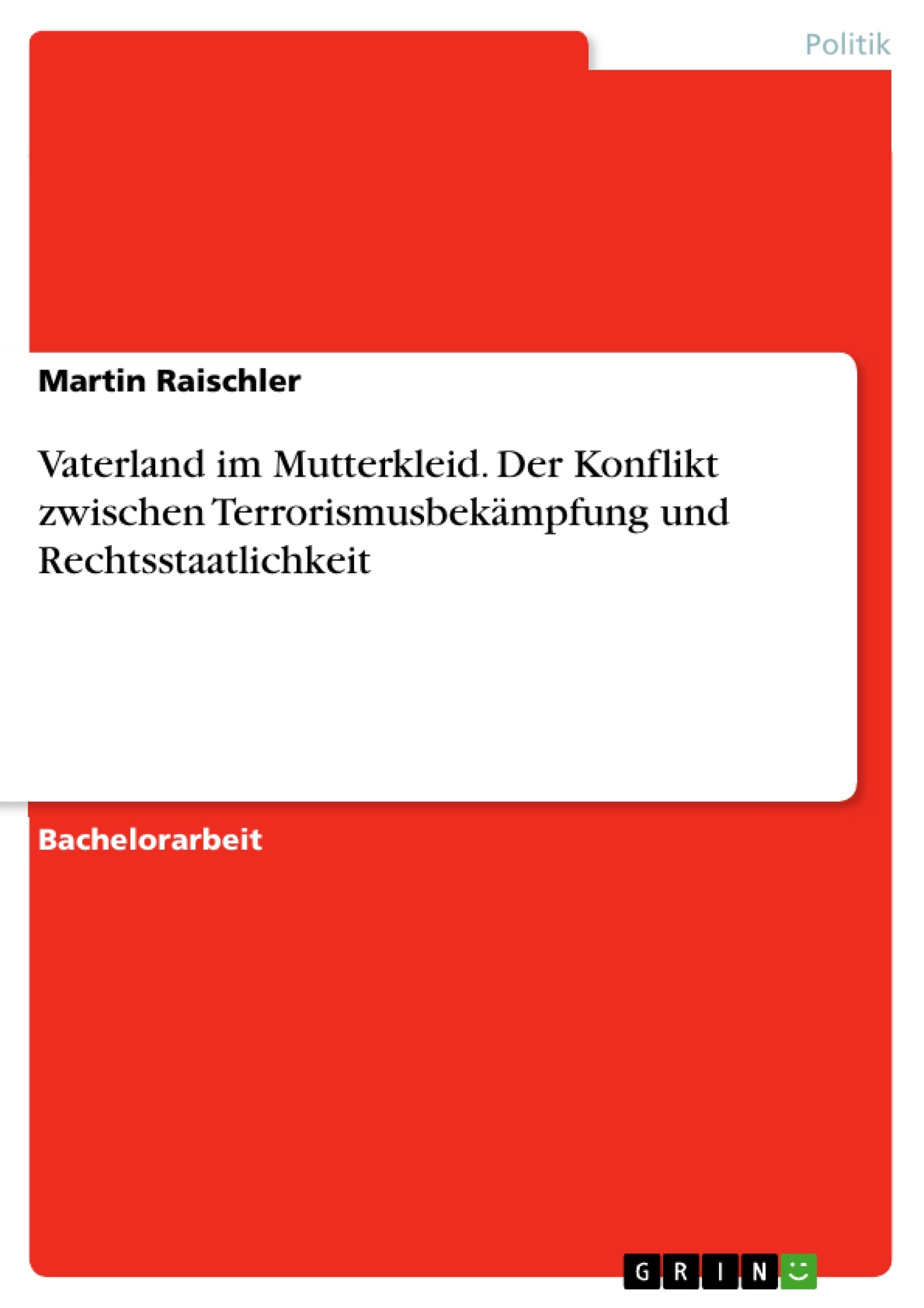„Der 11. September 2001 – der Tag, der die Welt veränderte.“
Wer sich eingehend mit wissenschaftlichen Quellen zum politischen Themenkomplex der Inneren Sicherheit befasst, wird Sätze wie diesen in der Einleitung unzähliger Ausarbeitungen finden.
In der Tat sind die Ereignisse dieses Tages Auslöser für mannigfaltige Entwicklungen im Bereich der sicherheitspolitischen Ausrichtung geworden. Auf Grundlage dieses medienwirksam inszenierten Massenmordes wurden zahlreiche Gesetze verabschiedet, die die Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten erheblich ausgeweitet haben. Hieran lässt sich das wahre Ausmaß der Anschläge bemessen. Präventive Verhaftungen auf Verdacht und ohne gerichtliche Kontrolle sind jetzt in „Rechtsstaaten“ legitim. Auch Gefangenenlager, in denen Menschen ohne Kriegsgefangenenstatus, ohne Anklage und unter eindeutiger Missachtung der Menschenrechte festgehalten und gefoltert werden, sind gesellschaftlich etabliert und erregen nur noch wenige Gemüter. Im Anti-Terror-Krieg scheinen Werte keine Bedeutung mehr zu haben.
Deutschland betreibt noch keine Gefangenenlager wie die USA und auch die umstrittenen Verhaftungen, wie sie in Großbritannien durchgeführt werden, sind hierzulande unzulässig. Bedenkenswerte Veränderungen haben sich jedoch durch länderübergreifende Bündnisse und Verträge, aber auch durch übereifrige Politiker sehr wohl ergeben. So spricht man im Bezug auf das polizeiliche Aufgabenspektrum beispielsweise schon von der neuen „Dreiheit des polizeilichen Sicherheitsauftrags: a) Gefahrenabwehr, b) Repression (Strafverfolgung) und c) Prävention.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themas
- Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Terrorismus
- Historische Entwicklung
- Versuch einer Definition
- Strategie des Terrorismus
- Bedrohungslage in Deutschland
- Von der Angst, den Medien und der Politik
- Zur Angst
- Zu den Medien
- Zur Politik
- Terrorismusbekämpfung in Deutschland
- Sicherheit im Verfassungsrecht
- Freiheit im Verfassungsrecht
- Die Sicherheitspakete
- Kritische Betrachtung einzelner Anti-Terror-Maßnahmen
- Folter und Luftsicherheitsgesetz
- Anti-Terror-Datei und Projektdateien
- Rasterfahndung
- Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen Terrorismusbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit. Ziel ist es, die Herausforderungen für den Rechtsstaat in Zeiten des Terrorismus zu beleuchten und die Auswirkungen von Anti-Terror-Maßnahmen auf die Grundrechte zu analysieren.
- Definition und historische Entwicklung des Terrorismus
- Analyse der terroristischen Strategie und Bedrohungslage in Deutschland
- Bedeutung von Freiheit und Sicherheit im Verfassungsrecht
- Bewertung ausgewählter Anti-Terror-Maßnahmen auf ihre Rechtmäßigkeit
- Zusammenhang zwischen Medien, Politik und Angst im Kontext des Terrorismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas und stellt den Aufbau der Arbeit dar. Kapitel 2 definiert Terrorismus, untersucht seine historische Entwicklung und analysiert seine Strategie sowie die Bedrohungslage in Deutschland. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Rolle der Medien, Politik und Angst im Kontext des Terrorismus. Kapitel 4 betrachtet die staatliche Schutzpflicht und die Bedeutung von Freiheit und Sicherheit im Verfassungsrecht. Abschließend werden in Kapitel 5 ausgewählte Anti-Terror-Maßnahmen kritisch beleuchtet und auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Rechtsstaatlichkeit, Anti-Terror-Maßnahmen, Grundrechte, Freiheit, Sicherheit, Medien, Politik, Angst, Verfassungsrecht, Wehrhafte Demokratie, Folterverbot, Luftsicherheitsgesetz, Anti-Terror-Datei, Rasterfahndung, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Bedrohungslage.
Häufig gestellte Fragen zu Terrorismusbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit
Wie hat der 11. September 2001 die Sicherheitspolitik verändert?
Die Anschläge führten weltweit zu zahlreichen Gesetzen, die die Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten massiv ausgeweitet haben, oft zulasten von Grundrechten und Transparenz.
Was versteht man unter der neuen „Dreiheit“ des polizeilichen Sicherheitsauftrags?
Man spricht heute von Gefahrenabwehr, Repression (Strafverfolgung) und zunehmend von Prävention als zentralen Säulen der Polizeiarbeit.
Welche Anti-Terror-Maßnahmen stehen in der Kritik?
Kritisch betrachtet werden unter anderem die Rasterfahndung, die Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchungen sowie die Anti-Terror-Datei.
Was ist das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit?
Der Rechtsstaat muss die Sicherheit seiner Bürger garantieren (staatliche Schutzpflicht), darf dabei aber die individuellen Freiheitsrechte nicht unverhältnismäßig einschränken.
Welche Rolle spielen Medien im Kontext des Terrorismus?
Medien können durch die Verbreitung von Angst die politische Agenda beeinflussen und den Ruf nach immer schärferen Sicherheitsgesetzen verstärken.
Gibt es in Deutschland rechtliche Schranken für Anti-Terror-Maßnahmen?
Ja, das Verfassungsrecht setzt klare Grenzen, wie etwa das Folterverbot oder die Unantastbarkeit der Menschenwürde, auch wenn Politiker oft versuchen, diese Grenzen zu erweitern.
- Quote paper
- Martin Raischler (Author), 2014, Vaterland im Mutterkleid. Der Konflikt zwischen Terrorismusbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305473