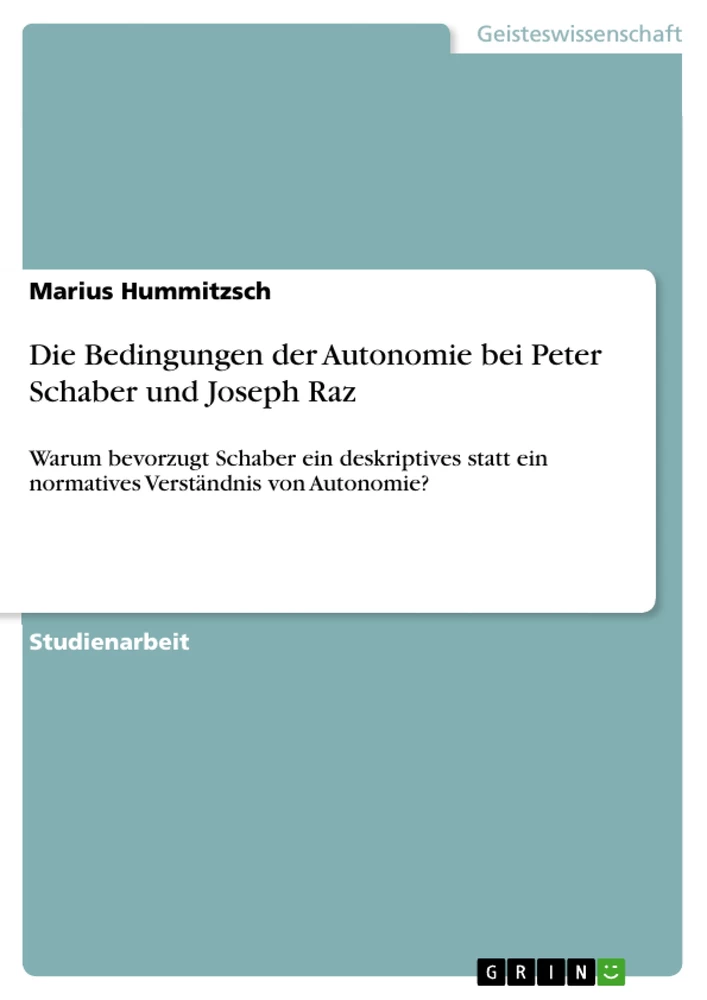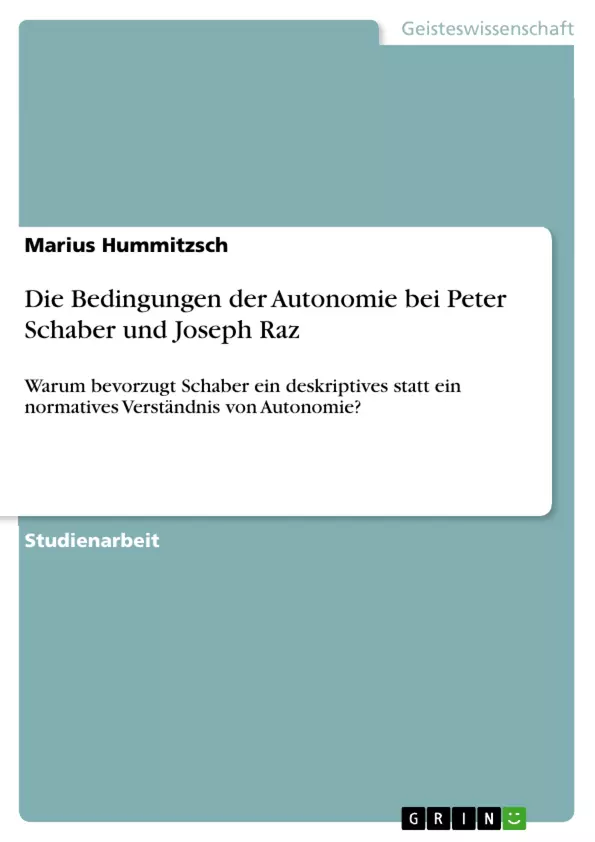Im zurückliegenden Seminar "Menschwürde: Neuere Arbeiten" haben wir uns intensiv mit dem für die Moralphilosophie zentralen Begriff der Würde auseinandergesetzt und versucht, eine genauere Begriffsbestimmung vorzunehmen. Hierbei haben wir uns vor allem mit Peter Schabers Instrumentalisierung und Würde befasst. Schon im zweiten Kapitel wurden wir dabei mit dem Begriff der Autonomie konfrontiert, den Schaber – wie auch den Begriff der Würde – als einen enorm wichtigen Terminus in der Moralphilosophie ansieht, wenngleich er ebenso stark interpretationsbedürftig sei.
Meine Referatsgruppe hatte zu einem späteren Zeitpunkt das Kapitel Autonomy and Pluralism aus der Monographie The Morality of Freedom von Joseph Raz vorzustellen, in dem es dann deutlich ausführlicher um den Begriff der Autonomie gehen sollte. Als ich mich in diesem Kontext nochmals mit Schabers Konzeption des Autonomiebegriffs und vor allem seinen Bedingungen auseinandergesetzt habe, kam bei mir die Frage auf, warum er sich in seiner Monographie offensichtlich stark am Autonomiebegriff und den Bedingungen der Autonomie bei Raz orientiert, jedoch nicht auf dessen normatives Begriffsbild sondern auf ein deskriptives zurückgegriffen hat.
Es soll daher das Anliegen der vorliegenden Arbeit sein, zu hinterfragen, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Schaber und Raz mit Blick auf die Bedingungen der Autonomie liegen und wie sich die eben angesprochene Entscheidung begründen ließe. Ich werde mich dafür überwiegend auf die beiden genannten Autoren beschränken, die das Seminar auch inhaltlich wesentlich bestimmt haben.
Strukturell wird in Kapitel 2 zunächst von Schabers Begriff der Autonomie ausgegangen. Zum einen wird untersucht, welche Bedingungen der Autonomie sich ausmachen lassen (Kapitel 2.1) und zum anderen wird geprüft, welche Gründe er für die deskriptive Begriffsverwendung anführt (Kapitel 2.2). Anschließend gilt es, die für den Kontext der Arbeit besonders relevanten Aspekte des Autonomiebegriffs bei Raz signifikant darzustellen (Kapitel 3). Auch hier wird im ersten Schritt – nun vergleichend – nach den Bedingungen gefragt (Kapitel 3.1), bevor in Kapitel 3.2 eine Bedingungserweiterung erfolgen soll. Ehe das Fazit gezogen wird, soll in Kapitel 4 der deskriptive und der normative Begriffszugang der Autoren abschließend diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schabers Autonomiebegriff
- Die Bedingungen
- Gründe für ein deskriptives Autonomieverständnis
- Die Bedingungen der Autonomie bei Raz
- Die expliziten Bedingungen der Autonomie
- Angemessene mentale Fähigkeiten
- Eine adäquate Breite an Wahlmöglichkeiten
- Unabhängigkeit
- Die normative Bedingungserweiterung
- Die expliziten Bedingungen der Autonomie
- Normativer oder deskriptiver Autonomiebegriff?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Konzeptionen von Autonomie bei Peter Schaber und Joseph Raz. Der Fokus liegt auf der Begründung von Schabers Präferenz für ein deskriptives statt normatives Verständnis von Autonomie, ausgehend von den jeweiligen Bedingungen, die beide Autoren für Autonomie definieren.
- Schabers deskriptives Autonomieverständnis im Vergleich zu Raz' normativem Ansatz
- Die Bedingungen der Autonomie nach Schaber (Handlungsfreiheit, ausreichendes Situationswissen, Rationalität)
- Die Bedingungen der Autonomie nach Raz (mentale Fähigkeiten, Wahlmöglichkeiten, Unabhängigkeit)
- Die Begründung der deskriptiven Herangehensweise bei Schaber
- Der Vergleich der beiden Autonomiekonzepte im Hinblick auf deren Anwendung in der Moralphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Autonomiebegriffe bei Schaber und Raz vor. Sie begründet die Relevanz der Frage im Kontext der Moralphilosophie und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Bedingungen der Autonomie bei beiden Autoren und die Begründung von Schabers deskriptivem Ansatz.
Schabers Autonomiebegriff: Dieses Kapitel analysiert Schabers Autonomiebegriff. Es identifiziert drei zentrale Bedingungen für autonomes Handeln nach Schaber: Freiheit von Manipulation, Täuschung und Bedrohung; ausreichendes Situationswissen; und grundlegende Rationalität. Schabers Fokus liegt auf der deskriptiven Erfassung des Autonomiebegriffs, der im Kontext seiner Argumentation zur Würde und Instrumentalisierung steht. Die Wahl des deskriptiven Ansatzes wird durch seinen Bezug auf den Alltagsgebrauch des Begriffs begründet, ohne implizit ein normatives Verständnis auszuschließen. Schaber betont dabei, dass autonomes Handeln nicht notwendigerweise mit moralisch gutem Handeln gleichzusetzen ist.
Die Bedingungen der Autonomie bei Raz: Dieses Kapitel beschreibt Raz' explizite Bedingungen für Autonomie, nämlich angemessene mentale Fähigkeiten, eine adäquate Breite an Wahlmöglichkeiten und Unabhängigkeit. Im Gegensatz zu Schaber verfolgt Raz einen eher normativen Ansatz, der ein Idealbild von Autonomie als Selbstbestimmung und Kontrolle des eigenen Lebens entwirft. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in der Formulierung und Begründung der jeweiligen Bedingungen.
Normativer oder deskriptiver Autonomiebegriff?: Dieses Kapitel vergleicht den deskriptiven Ansatz Schabers mit dem normativen Ansatz Raz'. Es untersucht die Konsequenzen der jeweils gewählten Herangehensweise für die Anwendung des Autonomiebegriffs in der Moralphilosophie, ohne die Diskussion vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Autonomie, Peter Schaber, Joseph Raz, deskriptiv, normativ, Bedingungen der Autonomie, Moralphilosophie, Würde, Instrumentalisierung, Selbstbestimmung, Handlungsfreiheit, Rationalität, Wahlmöglichkeiten, Unabhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich der Autonomiekonzepte von Schaber und Raz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Autonomiekonzepte von Peter Schaber und Joseph Raz. Im Fokus stehen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer jeweiligen Definitionen von Autonomie, insbesondere die Begründung von Schabers Präferenz für einen deskriptiven statt normativen Ansatz.
Welche Autonomie-Bedingungen definiert Schaber?
Schaber definiert drei Bedingungen für autonomes Handeln: Handlungsfreiheit (Freiheit von Manipulation, Täuschung und Bedrohung), ausreichendes Situationswissen und grundlegende Rationalität. Sein Ansatz ist deskriptiv und konzentriert sich auf die Beschreibung des Autonomiebegriffs im Alltagsgebrauch, ohne ein normatives Verständnis auszuschließen.
Welche Autonomie-Bedingungen definiert Raz?
Raz formuliert explizite Bedingungen für Autonomie: angemessene mentale Fähigkeiten, eine adäquate Breite an Wahlmöglichkeiten und Unabhängigkeit. Im Gegensatz zu Schaber verfolgt Raz einen normativen Ansatz, der ein Idealbild von Autonomie als Selbstbestimmung und Kontrolle des eigenen Lebens entwirft.
Was ist der Unterschied zwischen Schabers deskriptivem und Raz' normativem Ansatz?
Schaber favorisiert einen deskriptiven Ansatz, der den Autonomiebegriff im Alltagsverständnis beschreibt. Raz hingegen vertritt einen normativen Ansatz, der ein Idealbild von Autonomie als normatives Ziel formuliert. Diese unterschiedlichen Ansätze haben Konsequenzen für die Anwendung des Autonomiebegriffs in der Moralphilosophie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Schabers Autonomiebegriff, ein Kapitel zu Raz' Autonomiebedingungen, ein Kapitel zum Vergleich des deskriptiven und normativen Ansatzes und ein Fazit.
Wie wird Schabers deskriptiver Ansatz begründet?
Schaber begründet seinen deskriptiven Ansatz mit dem Bezug auf den Alltagsgebrauch des Autonomiebegriffs. Er möchte den Begriff so erfassen, wie er im Alltag verwendet wird, ohne implizit ein normatives Verständnis auszuschließen. Autonomes Handeln wird dabei nicht automatisch mit moralisch gutem Handeln gleichgesetzt.
Welche Rolle spielt die Moralphilosophie in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konsequenzen der unterschiedlichen Autonomiekonzepte (deskriptiv vs. normativ) für deren Anwendung in der Moralphilosophie. Der Vergleich der Ansätze von Schaber und Raz trägt dazu bei, das Verständnis von Autonomie im moralischen Kontext zu vertiefen.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Autonomie, Peter Schaber, Joseph Raz, deskriptiv, normativ, Bedingungen der Autonomie, Moralphilosophie, Würde, Instrumentalisierung, Selbstbestimmung, Handlungsfreiheit, Rationalität, Wahlmöglichkeiten, Unabhängigkeit.
- Arbeit zitieren
- Marius Hummitzsch (Autor:in), 2013, Die Bedingungen der Autonomie bei Peter Schaber und Joseph Raz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305556