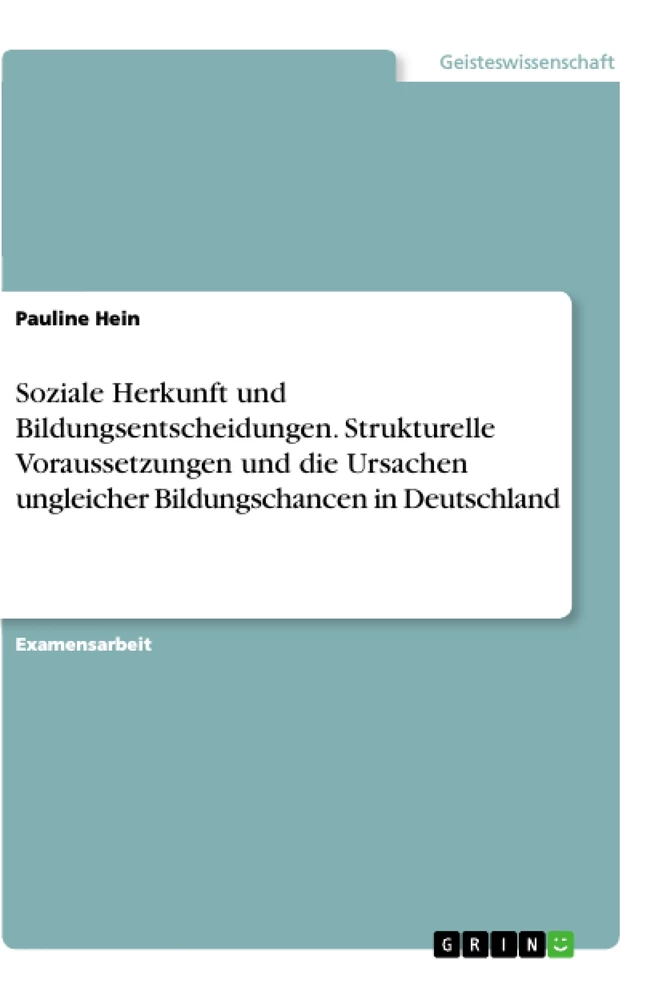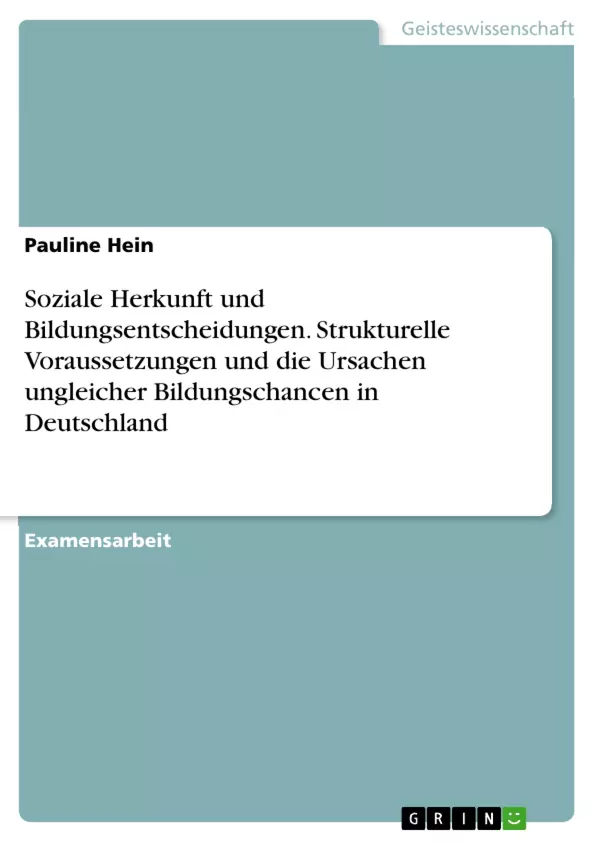Ziel meiner Arbeit ist es, bestimmte Bildungsprozesse im Kontext der gesellschaftlichen Ungleichheit systematisch zu beschreiben und die sich ergebenden Folgeerscheinungen für die gesamte Gesellschaft, das Individuum sowie die Institutionen zu erklären. Die enge Relation von ungleichen materiellen Ressourcen und den sie verursachenden (oder auf sie folgenden) Bildungsmängeln sollen dargestellt werden.
Beginnen werde ich den theoretischen Teil meiner Arbeit mit einigen Begriffsdefinitionen. Dabei werde ich auf die Bildungssoziologie und Bildung an sich eingehen, wobei ich unterschiedliche Konzepte von Bildungsidealen kurz vorstellen werde. Anschließend setze ich mich ebenfalls im Sinne einer Begriffsklärung mit fünf verschiedenen Dimensionen von Chancengleichheit im Bildungswesen auseinander. Darauf folgt der Begriff der Erziehung. Des Weiteren soll der Themenkomplex der sozialen Ungleichheit bearbeitet werden, in dem ich diverse grundlegende Theorien zur Analyse der Struktur von sozialer Ungleichheit erläutern werde. Der letzte Abschnitt des theoretischen Teils beinhaltet das klassentheoretische Modell Pierre Bourdieus.
Der zweite Teil meiner Arbeit stellt die empirischen Elemente des Themas dar. Zunächst sind das die vielseitigen Ursachen von Bildungsungleichheit, die eine Verknüpfung zu den im ersten Teil erläuterten Theorien herstellen und sich auf Aspekte der sozialen Herkunft und institutionelle Gegebenheiten beziehen. Des Weiteren werde ich einen kleinen Exkurs zum Vergleich des deutschen Schulsystems mit Teilen des Bildungswesens in skandinavischen Ländern einführen, um ein Beispiel für eine gelingende Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg liefern zu können. Anschließend sollen zwei von mir ausgewählte Schulleistungsstudien, PISA und IGLU, im Sinne einer empirischen Bestätigung von herrschenden Bildungsungleichheiten vorgestellt werden, wobei ich mich größtenteils auf die Veränderungen und aktuellen Zustände in Deutschland beziehen werde.
Durch den Vergleich mit anderen Staaten wird die mögliche Kompetenzentwicklung bei gleichzeitig geringen sozialen Disparitäten sichtbar, bei den Beschreibungen der sozialen Gesellschaftsstrukturen werde ich mich jedoch ausschließlich auf Deutschland beziehen. Lediglich innerhalb des Exkurses zu den skandinavischen Schulsystemen und stellenweise im Zuge der Schulleistungsstudien werde ich den Vergleich mit anderen Ländern heranziehen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Begriffsdefinitionen
- Bildungssoziologie und Bildung
- Chancengleichheit im Bildungswesen
- Erziehung
- Soziale Ungleichheit
- Theorien sozialer Ungleichheit
- Prestige und Status
- Milieutheorien
- Pierre Bourdieu und sein klassentheoretisches Modell vom sozialen Raum
- Die Kapitalsorten
- Der soziale Raum
- Die Habitustheorie
- Soziale Vererbung von Ungleichheiten
- Begriffsdefinitionen
- Empirischer Teil
- Ursachen von Bildungsungleichheiten
- Soziale Herkunft
- Primäre und sekundäre Herkunftseffekte nach Boudon
- Die Familie
- Formelle vs. informelle Bildung
- Kulturelles Kapital und Habitusbildung
- Sozioökonomische Verhältnisse
- Frühkindliche Bildung
- Erziehungsstile und Folgen
- Bildungsniveau der Eltern
- Migrationshintergrund
- Gesamtgesellschaftliche und institutionelle Faktoren
- Wachsende Bildungsungleichheit durch die Bildungsexpansion
- Struktur des Bildungssystems
- Der Übergang auf eine weiterführende Schule nach dem vierten Grundschuljahr
- Durchlässigkeit und Differenzierungen
- Soziale Herkunft
- Ein Exkurs: Skandinavische Bildungssysteme
- Das deutsche Schulsystem im Spiegel von Schulleistungsstudien: Empirische Bestätigung ungleicher Bildungschancen
- Die PISA-Studie
- IGLU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit zielt darauf ab, die engen Verbindungen zwischen sozialen Ungleichheiten und Bildungsungleichheiten systematisch zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der Erläuterung von Bildungsungleichheiten in Deutschland und deren Folgen für Individuen, Institutionen und die Gesellschaft insgesamt. Die Arbeit untersucht insbesondere die Rolle sozialer Herkunft und institutioneller Faktoren bei der Entstehung von Bildungsungleichheiten.
- Theoretische Grundlagen von Bildungssoziologie, Chancengleichheit und sozialer Ungleichheit
- Pierre Bourdieus klassentheoretisches Modell vom sozialen Raum und seine Bedeutung für die Analyse von Bildungsungleichheiten
- Empirische Ursachen von Bildungsungleichheiten, insbesondere soziale Herkunft und institutionelle Faktoren
- Vergleichende Analyse des deutschen Schulsystems im Kontext von Schulleistungsstudien wie PISA und IGLU
- Die Bedeutung von Bildungsaspirationen und deren Einfluss auf die Bildungschancen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Bildungsungleichheiten ein und stellt die Bedeutung von Chancengleichheit im Bildungswesen in den Kontext gesellschaftlicher Ungleichheiten. Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Definition zentraler Begriffe, darunter Bildungssoziologie, Bildung, Chancengleichheit und Erziehung. Er beleuchtet außerdem Theorien der sozialen Ungleichheit, wie z.B. Prestige- und Statusunterschiede sowie Milieutheorien, und führt in Pierre Bourdieus klassentheoretisches Modell vom sozialen Raum ein.
Der empirische Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Ursachen von Bildungsungleichheiten. Hierbei werden sowohl Aspekte der sozialen Herkunft, wie z.B. die Familie, der sozioökonomische Hintergrund und das Bildungsniveau der Eltern, als auch institutionelle Faktoren, wie z.B. die Struktur des Bildungssystems und die Bildungsexpansion, untersucht. Ein Exkurs widmet sich den skandinavischen Bildungssystemen und zeigt beispielhaft, wie eine Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg gelingen kann.
Schließlich werden die Ergebnisse von Schulleistungsstudien wie PISA und IGLU vorgestellt, um die empirische Bestätigung ungleicher Bildungschancen zu belegen und Veränderungen im deutschen Schulsystem im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit aufzuzeigen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Bildungssoziologie, Bildungsungleichheit, Chancengleichheit, Soziale Ungleichheit, Pierre Bourdieu, Sozialer Raum, Habitus, Soziale Herkunft, Institutionelle Faktoren, Schulleistungsstudien, PISA, IGLU, Bildungsexpansion, Skandinavische Bildungssysteme, Bildungsaspirationen.
- Ursachen von Bildungsungleichheiten
- Quote paper
- Pauline Hein (Author), 2015, Soziale Herkunft und Bildungsentscheidungen. Strukturelle Voraussetzungen und die Ursachen ungleicher Bildungschancen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305920