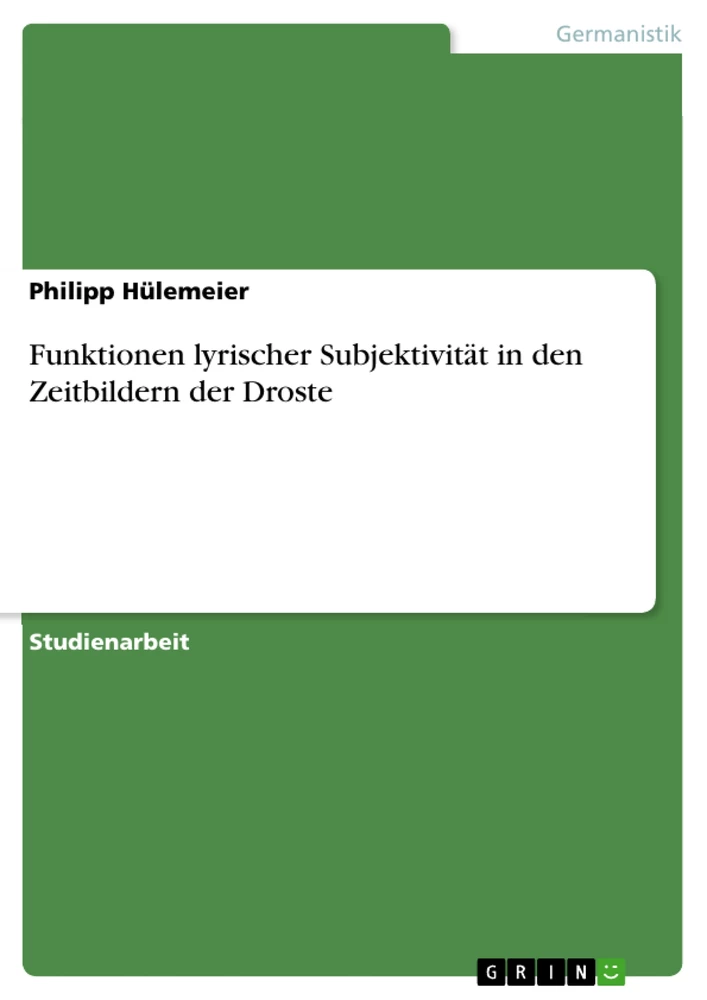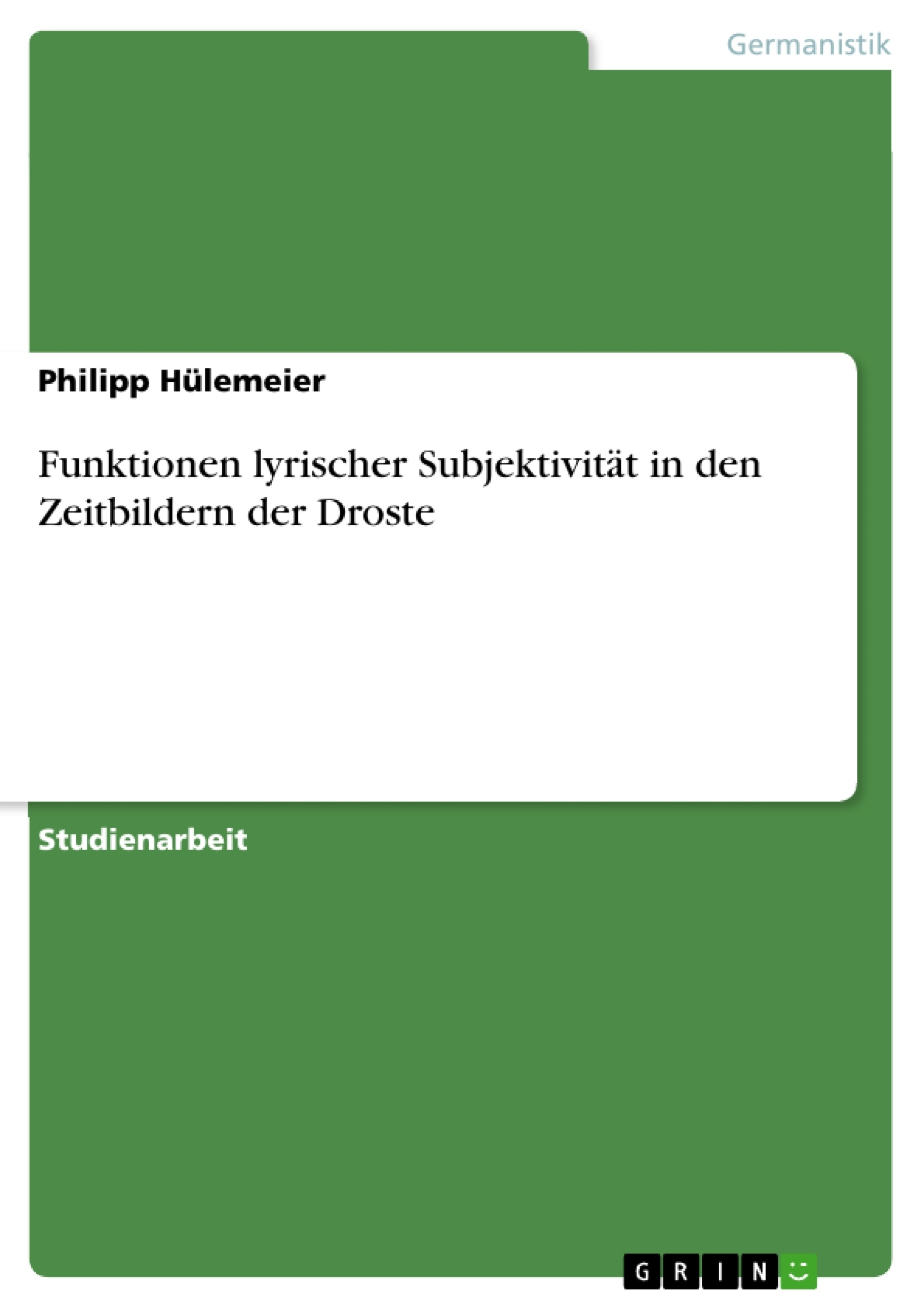Mit den Zeitbildern der Droste wurde ein Untersuchungsgegenstand gewählt, der über das bei der Droste Erwartbare, d.h. beschaulich-biedermeierliche, hinausgeht. Wenn sie betont, sie möchte der als „blasi[e]rt“ charakterisierten Zeit am liebsten den Rücken zukehren, so kann dies als eine Flucht in das Private, eine Abwendung von der Öffentlichkeit verstanden werden. Das Paradoxon, sich aber gleichzeitig sehend mit dem Rücken den Ereignissen zuzuwenden, erfasst zugleich die Ambivalenz, die sich auch aus Drostes Zeitbildern ablesen lässt. Genötigt zu einer Positionsbestimmung in der Gegenwart und doch dem Vergangenen verhaftet – in diesem Spannungsfeld bewegt sich dieser Gedichtzyklus der Annette von Droste-Hülshoff.
Ein besonderes Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit ist hierbei der Untersuchung der verschiedenen Funktionen unterschiedlich hervortretender lyrischer Subjektivität bzw. lyrischer Subjekte gewidmet. Auffällig variantenreich wendet sich die Droste mal an ein „Du“, ein „Wir“, ein „Ihr“ oder bleibt beim „Ich“ stehen. Dieser Auffälligkeit soll mit einer Untersuchung der Verwendungsweisen und Funktionen eben dieser lyrischen Subjekte entsprochen werden.
Es sollen zunächst theoretische Grundlagen gelegt werden: Die Verwendung des Terminus „lyrisches Subjekt“ wird begründet eingeordnet und entwickelt. Außerdem sollen auch implizite Formen des Erscheinens lyrischer Subjektivität vorgestellt werden.
Hierauf folgt eine Einordnung der Droste und der Zeitbilder in den politisch-historischen Kontext. Schließlich werden auf dieser Basis die unterschiedlichen Formen lyrischer Subjektivität untersucht und am Schluss der Arbeit die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst.
Dabei soll das Untersuchen lyrischer Subjektivität einen besonderen Fokus für das Verständnis der politischen Lyrik Drostes herstellen. Adressaten und Funktionsweisen der teilweise auch recht suggestiv wirkenden Lyrik dieses Gedichtzyklus sollen herausgearbeitet werden. Dies kann auch helfen zu klären, wie sehr das lyrische Subjekt der Droste-Zeit der „blasi[e]rte[n] Zeit“ verfallen, durch sie verletzt oder beeinflusst war.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Terminologie: das lyrische Subjekt und lyrische Subjektivität
- 2.1. Lyrisches Ich oder lyrisches Subjekt?
- 2.2. Implizite und explizite Subjektivität
- 3. Zum politisch-historischen Kontext: die Droste in ihrer Zeit
- 4. Das „lyrische Subjekt“ in den Zeitbildern
- 4.1. „Lyrisches Wir“
- 4.2. „Lyrisches Ihr“
- 4.3. „Lyrisches Du“
- 4.4. „Lyrisches Ich“
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktionen lyrischer Subjektivität in den Zeitbildern Annette von Drostes. Das Hauptziel ist es, die variantenreiche Verwendung von „Ich“, „Du“, „Wir“ und „Ihr“ in Drostes Gedichten zu analysieren und deren Funktionen im Kontext der politischen und historischen Situation ihrer Zeit zu verstehen. Dabei soll der Fokus auf die politische Dimension von Drostes Lyrik gelegt werden.
- Analyse der verschiedenen Funktionen lyrischer Subjekte (Ich, Du, Wir, Ihr) in den Zeitbildern.
- Untersuchung des Verhältnisses zwischen dem lyrischen Subjekt und dem Autor (Droste).
- Einordnung der Zeitbilder in den politisch-historischen Kontext des Biedermeier.
- Klärung der Adressaten und Funktionsweisen der Lyrik.
- Analyse des Einflusses der "blasierten Zeit" auf das lyrische Subjekt.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den Untersuchungsgegenstand – die Zeitbilder der Annette von Droste-Hülshoff – vor. Sie hebt die Ambivalenz der Droste hervor, die sich sowohl der "blasierten" Zeit zuwendet als auch von ihr abwendet. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Funktionen unterschiedlicher lyrischer Subjekte in den Gedichten und legt den Grundstein für die theoretische Einordnung des Begriffs "lyrisches Subjekt".
2. Zur Terminologie: das lyrische Subjekt und lyrische Subjektivität: Dieses Kapitel klärt den Begriff des "lyrischen Subjekts" im Vergleich zum "lyrischen Ich". Es diskutiert historische Aspekte der Begriffsentwicklung, von Hegels Gleichsetzung von Dichter- und lyrischem Subjekt bis hin zu modernen Ansätzen, die eine stärkere Trennung zwischen Autor und lyrischem Subjekt betonen. Die verschiedenen Positionen werden kritisch bewertet, und es wird ein systematischer Begriff des lyrischen Subjekts entwickelt, der als Grundlage für die weitere Analyse dient. Die Diskussion um die Definition des lyrischen Subjekts liefert wichtige Ansatzpunkte für die Interpretation von Drostes Werk.
3. Zum politisch-historischen Kontext: die Droste in ihrer Zeit: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext und muss hinzugefügt werden, basierend auf den Informationen im gegebenen Text) Dieses Kapitel würde den Kontext der Zeitbilder von Droste-Hülshoff beleuchten, indem es ihre politische und gesellschaftliche Lage im Biedermeier beschreibt. Es wäre zu analysieren, wie die gesellschaftlichen und politischen Strömungen ihre Lyrik beeinflusst haben und inwiefern sich diese Einflüsse in den verschiedenen lyrischen Subjekten widerspiegeln.
4. Das „lyrische Subjekt“ in den Zeitbildern: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Formen lyrischer Subjektivität in Drostes Zeitbildern („Ich“, „Du“, „Wir“, „Ihr“). Es analysiert die Funktionen dieser unterschiedlichen Perspektiven und wie sie zur Gesamtdeutung der Gedichte beitragen. Die Analyse würde untersuchen, wie die Wahl des jeweiligen Subjekts die Aussage und Wirkung der Gedichte prägt und welche Aspekte der politischen Situation und des persönlichen Erlebens der Dichterin dadurch hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Lyrisches Subjekt, lyrisches Ich, Annette von Droste-Hülshoff, Zeitbilder, Biedermeier, politische Lyrik, Subjektivität, Dichter-Subjekt, Adressaten, Funktionsweisen, politischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der lyrischen Subjektivität in Annette von Drostes Zeitbildern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Funktionen lyrischer Subjektivität in den Zeitbildern Annette von Drostes. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der vielfältigen Verwendung von „Ich“, „Du“, „Wir“ und „Ihr“ in ihren Gedichten und deren Bedeutung im politischen und historischen Kontext des Biedermeier.
Welche Ziele werden verfolgt?
Das Hauptziel ist die Analyse der unterschiedlichen Funktionen der lyrischen Subjekte (Ich, Du, Wir, Ihr) in Drostes Zeitbildern. Weitere Ziele sind die Untersuchung des Verhältnisses zwischen lyrischem Subjekt und Autorin, die Einordnung der Gedichte in den historischen Kontext, die Klärung der Adressaten und Funktionsweisen der Lyrik sowie die Analyse des Einflusses der "blasierten Zeit" auf das lyrische Subjekt.
Wie wird der Begriff "lyrisches Subjekt" definiert?
Das Kapitel "Zur Terminologie" klärt den Unterschied zwischen "lyrischem Ich" und "lyrischem Subjekt". Es werden verschiedene historische und moderne Ansätze diskutiert, um einen systematischen Begriff des lyrischen Subjekts zu entwickeln, der als Grundlage für die Analyse dient. Die Arbeit geht auf die Problematik der Trennung zwischen Autor und lyrischem Subjekt ein.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Zur Terminologie: das lyrische Subjekt und lyrische Subjektivität, 3. Zum politisch-historischen Kontext: die Droste in ihrer Zeit, 4. Das „lyrische Subjekt“ in den Zeitbildern, und 5. Zusammenfassung und Fazit. Jedes Kapitel widmet sich einem spezifischen Aspekt der Analyse, beginnend mit der Begriffsklärung und dem Kontext, bis hin zur detaillierten Untersuchung der lyrischen Subjekte in den Gedichten.
Wie wird der politische und historische Kontext berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet die Zeitbilder von Droste-Hülshoff im Kontext des Biedermeier. Es wird untersucht, wie gesellschaftliche und politische Strömungen ihre Lyrik beeinflusst haben und wie sich diese Einflüsse in den verschiedenen lyrischen Subjekten widerspiegeln. Die "blasierte Zeit" wird als wichtiger Einflussfaktor auf das lyrische Subjekt betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Lyrisches Subjekt, lyrisches Ich, Annette von Droste-Hülshoff, Zeitbilder, Biedermeier, politische Lyrik, Subjektivität, Dichter-Subjekt, Adressaten, Funktionsweisen, politischer Kontext.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die jeweils den Inhalt und die Schwerpunkte der einzelnen Kapitel kurz beschreiben. Die Zusammenfassung zu Kapitel 3 ("Zum politisch-historischen Kontext") ist im Originaltext unvollständig und muss ergänzt werden, basierend auf dem gegebenen Material.
- Citation du texte
- Philipp Hülemeier (Auteur), 2015, Funktionen lyrischer Subjektivität in den Zeitbildern der Droste, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305926