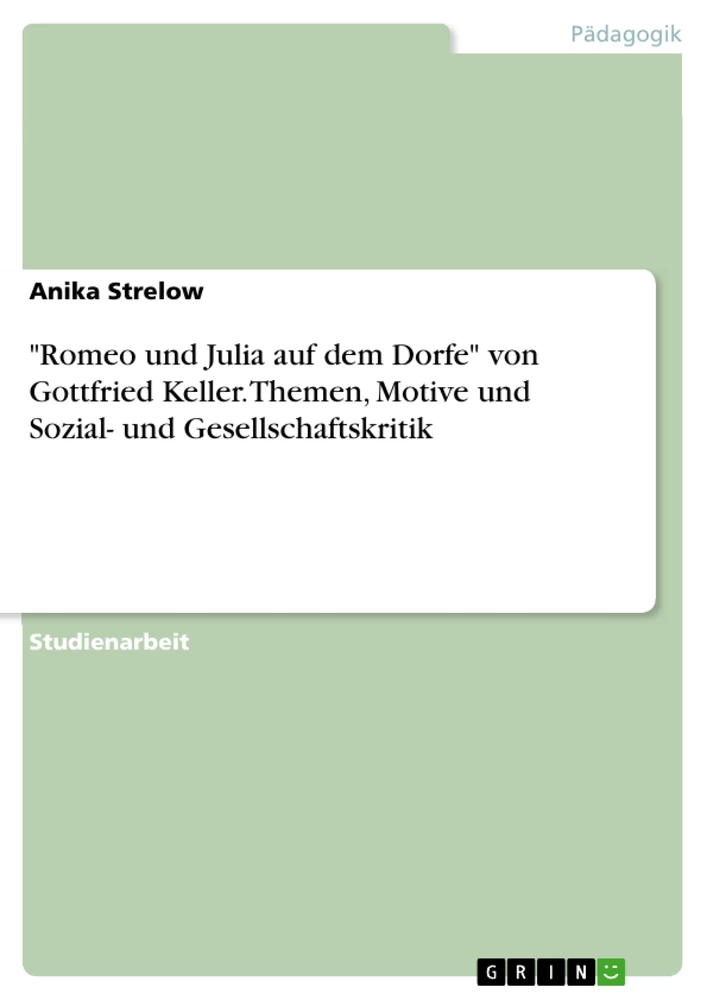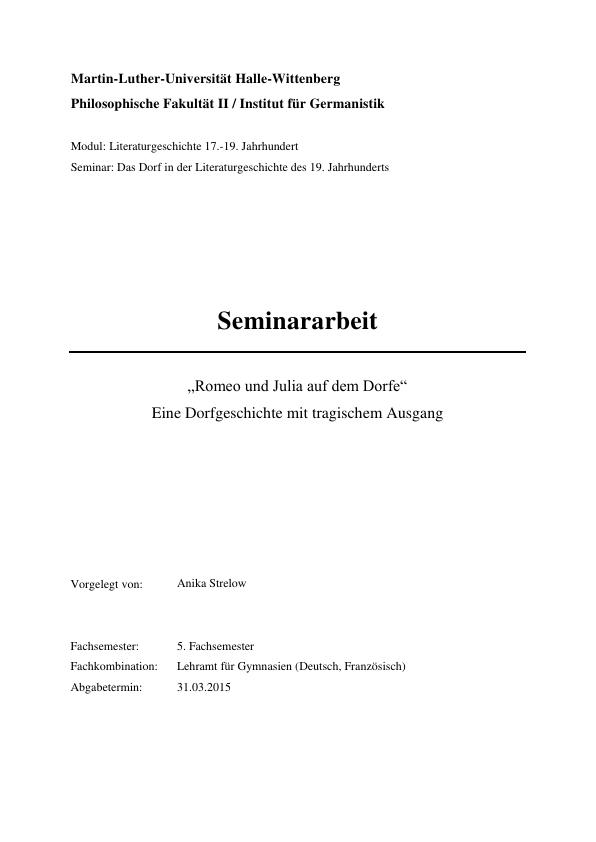„Ihr ‚Romeo und Julie‘ wird leben, solange die deutsche Zunge lebt“ bescheinigte Hermann Hettner seinem Freund Gottfried Keller (1819-1890) in einem Brief vom 12. April 1856. Tatsächlich schaffte es Kellers Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe, nach ihrer Veröffentlichung im Jahr 1856, in den Kanon der deutschsprachigen Literatur, hielt bundesweit Einzug als Pflichtlektüre in den deutschen Schullehrplänen und wurde mehrfach illustriert, musikalisch bearbeitet und verfilmt.
Bei Kellers Erzählung handelt es sich allerdings nicht bloß um eine „müßige Nachahmung“ des altbekannten Romeo-und-Julia-Stoffes, der an William Shakespeares Tragödie erinnert. Durch den Zusatz auf dem Dorfe verweist der Autor bereits im Titel auf den Schauplatz seiner tragischen Liebesgeschichte. Er verortet die Handlung seiner Erzählung ins bäuerlich-dörfliche Milieu und versucht gleichsam die dort befindlichen Lebensverhältnisse und Gesellschaftsnormen der damaligen Zeit aufzuzeigen. Kellers tragische Liebesgeschichte um Romeo und Julia auf dem Dorfe wird als „höchste Erfüllung“ der Gattung ‚Dorfgeschichte‘ betrachtet. Auch Berthold Auerbach, welcher als Erfinder der Dorfgeschichte gilt, äußerte sich anerkennend, Keller habe mit seiner Erzählung „ein Kunstwerk geschaffen, das nicht viele seines Gleichen in der Literatur hat“.
Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist es, wesentliche Merkmale der Dorfgeschichte in Kellers Erzählung aufzuzeigen und die Sozial- und Gesellschaftskritik des Autors, die durch die Tragik und Schicksalhaftigkeit seiner Dorfgeschichte zum Ausdruck kommt, herauszustellen. Dazu wird zunächst auf gattungstheoretische Merkmale des Genres ‚Dorfgeschichte‘ eingegangen sowie eine literaturwissenschaftliche Einordnung der Erzählung vorgenommen. Den Hauptteil der Arbeit bildet eine ausführliche Analyse zur Darstellung der ländlichen Idylle am Beispiel des Getreideackers, den Keller mehrfach als Schauplatz der Erzählhandlung nutzte, sowie zum dörflichen Leben der Protagonisten. Motive wie Sittlichkeit, Ehre und Recht sollen hier eine übergeordnete Rolle spielen. Anschließend wird der in Kellers Erzählung dargebotene Gegensatz zwischen Stadt und Land thematisiert und auf mögliche Sozial- und Gesellschaftskritik des Autors eingegangen. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein zusammenfassendes Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und gattungstheoretische Merkmale der „Dorfgeschichte“ im 19. Jahrhundert
- Literaturgeschichtliche Einordnung der Erzählung
- Themen, Stoffe und Motive in Romeo und Julia auf dem Dorfe
- Zur Darstellung der ländlichen Idylle – Am Beispiel des Getreideackers
- Das Leben auf dem Dorf zwischen Sittlichkeit, Ehre und Recht
- Der Stadt-Land-Gegensatz
- Zur Sozial- und Gesellschaftskritik der Dorfgeschichte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gottfried Kellers Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ im Kontext der Dorfgeschichte des 19. Jahrhunderts. Ziel ist es, die gattungsspezifischen Merkmale in Kellers Erzählung aufzuzeigen und die darin vermittelte Sozial- und Gesellschaftskritik zu analysieren. Die Tragik der Liebesgeschichte wird dabei als Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse betrachtet.
- Gattungsspezifische Merkmale der Dorfgeschichte
- Darstellung der ländlichen Idylle und ihre Ambivalenz
- Konflikt zwischen Tradition und Moderne im dörflichen Milieu
- Der Stadt-Land-Gegensatz als Spiegel gesellschaftlicher Ungleichheiten
- Sozial- und Gesellschaftskritik in Kellers Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Bedeutung von Gottfried Kellers Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" für die deutschsprachige Literatur heraus. Sie betont den Bezug zu Shakespeares Tragödie, hebt aber die Verortung der Handlung im dörflichen Milieu und die Darstellung der dortigen Lebensverhältnisse hervor. Die Arbeit selbst wird umrissen, wobei die Analyse der gattungsspezifischen Merkmale der Dorfgeschichte und die Herausstellung der Sozial- und Gesellschaftskritik im Mittelpunkt stehen.
2. Begriffsbestimmung und gattungstheoretische Merkmale der „Dorfgeschichte“ im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Dorfgeschichte als literarische Untergattung der bäuerlichen Epik und Heimatliteratur. Es beleuchtet die Merkmale dieser Gattung, wie die Verortung der Handlung im dörflichen Milieu, die Darstellung des bäuerlichen Lebens und der dörflichen Traditionen, sowie den oft idealisierten Gegensatz zur Stadt. Die Entwicklung der Dorfgeschichte vom idyllischen Bild hin zu sozialkritischen Elementen ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird ebenfalls thematisiert, wobei der Bezug zu sozioökonomischen und politischen Entwicklungen des Vormärz hergestellt wird. Bekannte Beispiele der Gattung werden genannt.
3. Literaturgeschichtliche Einordnung der Erzählung: Dieses Kapitel ordnet Kellers Novelle in den literaturgeschichtlichen Kontext ein. Es verweist auf die Inspiration durch eine Zeitungsnotiz, die einen realen Fall von Liebenden beschreibt, die sich aufgrund elterlicher Feindschaft das Leben nahmen. Keller adaptiert diesen realen Stoff, transponiert den klassischen Romeo-und-Julia-Stoff ins bäuerliche Milieu und verleiht ihm damit eine neue Bedeutung im Kontext der sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts.
4. Themen, Stoffe und Motive in Romeo und Julia auf dem Dorfe: Dieses Kapitel analysiert zentrale Themen, Stoffe und Motive der Novelle. Es untersucht die Darstellung der ländlichen Idylle, insbesondere am Beispiel des Getreideackers, als scheinbar harmonischen, aber letztlich konfliktträchtigen Schauplatz. Die Aspekte Sittlichkeit, Ehre und Recht im dörflichen Leben werden beleuchtet und in Bezug zur Tragödie der Liebenden gesetzt. Schließlich wird der Gegensatz zwischen Stadt und Land thematisiert und als Ausdruck der sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse interpretiert.
Schlüsselwörter
Dorfgeschichte, Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe, ländliches Milieu, Sozialkritik, Gesellschaftskritik, Stadt-Land-Gegensatz, Idylle, Tragödie, bäuerliches Leben, Sittlichkeit, Ehre, Recht, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu Gottfried Kellers "Romeo und Julia auf dem Dorfe"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gottfried Kellers Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" im Kontext der Dorfgeschichte des 19. Jahrhunderts. Sie untersucht die gattungsspezifischen Merkmale der Erzählung und analysiert die darin vermittelte Sozial- und Gesellschaftskritik. Die Tragik der Liebesgeschichte wird als Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse betrachtet. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Begriffsbestimmung der Dorfgeschichte, eine literaturgeschichtliche Einordnung der Novelle, eine Themenanalyse und ein Fazit.
Welche Themen werden in der Novelle behandelt und wie werden sie analysiert?
Die Analyse umfasst die Darstellung der ländlichen Idylle und ihre Ambivalenz, den Konflikt zwischen Tradition und Moderne im dörflichen Milieu, den Stadt-Land-Gegensatz als Spiegel gesellschaftlicher Ungleichheiten und die Sozial- und Gesellschaftskritik in Kellers Novelle. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der ländlichen Idylle (am Beispiel des Getreideackers), den Aspekten Sittlichkeit, Ehre und Recht im dörflichen Leben und ihrer Beziehung zur Tragödie der Liebenden sowie dem Gegensatz zwischen Stadt und Land als Ausdruck sozialer und gesellschaftlicher Verhältnisse.
Wie wird die Dorfgeschichte als literarische Gattung definiert?
Die Arbeit definiert die Dorfgeschichte als literarische Untergattung der bäuerlichen Epik und Heimatliteratur. Sie beleuchtet Merkmale wie die Verortung der Handlung im dörflichen Milieu, die Darstellung des bäuerlichen Lebens und der dörflichen Traditionen sowie den oft idealisierten Gegensatz zur Stadt. Die Entwicklung der Dorfgeschichte vom idyllischen Bild hin zu sozialkritischen Elementen ab Mitte des 19. Jahrhunderts und deren Bezug zu sozioökonomischen und politischen Entwicklungen des Vormärz wird ebenfalls thematisiert.
Wie wird Kellers Novelle literaturgeschichtlich eingeordnet?
Die Novelle wird in ihren literaturgeschichtlichen Kontext eingeordnet, wobei auf die Inspiration durch eine Zeitungsnotiz über einen realen Fall verliebter Menschen verwiesen wird, die sich aufgrund elterlicher Feindschaft das Leben nahmen. Keller adaptiert diesen Stoff und transponiert den klassischen Romeo-und-Julia-Stoff ins bäuerliche Milieu, wodurch er im Kontext der sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts eine neue Bedeutung erhält.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dorfgeschichte, Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe, ländliches Milieu, Sozialkritik, Gesellschaftskritik, Stadt-Land-Gegensatz, Idylle, Tragödie, bäuerliches Leben, Sittlichkeit, Ehre, Recht, 19. Jahrhundert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Begriffsbestimmung und gattungstheoretischen Merkmale der Dorfgeschichte, einem Kapitel zur literaturgeschichtlichen Einordnung, einem Kapitel zur Analyse der Themen, Stoffe und Motive in "Romeo und Julia auf dem Dorfe" und einem Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Novelle und ihrer Einordnung in den Kontext der Dorfgeschichte des 19. Jahrhunderts, wie oben detailliert beschrieben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die gattungsspezifischen Merkmale der Dorfgeschichte in Kellers Erzählung aufzuzeigen und die darin vermittelte Sozial- und Gesellschaftskritik zu analysieren. Die Tragik der Liebesgeschichte wird dabei als Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse betrachtet.
- Quote paper
- Anika Strelow (Author), 2015, "Romeo und Julia auf dem Dorfe" von Gottfried Keller. Themen, Motive und Sozial- und Gesellschaftskritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305972