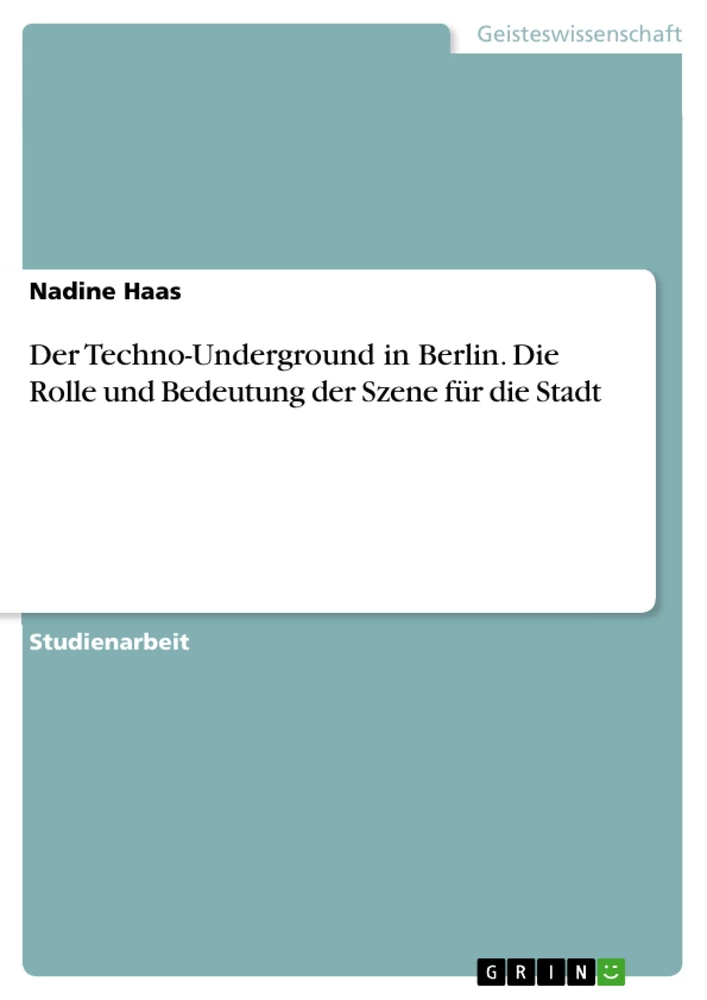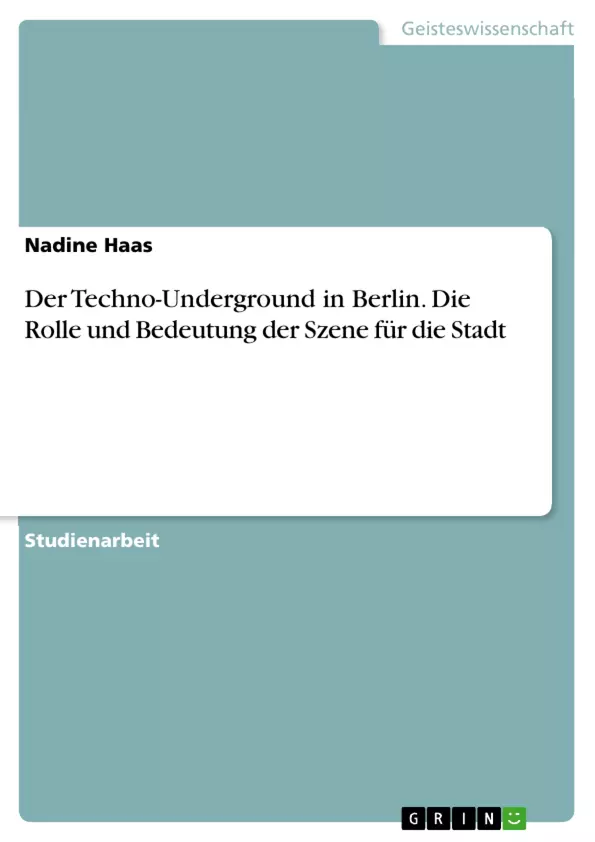In dieser Arbeit geht es um die Akteure der Techno-Szene, welche in der Stadt Berlin angesiedelt sind, und darum, welche Rolle sie für das Bild und die Entwicklung der Stadt spielen.
Die Szene wurde in Berlin stark durch den Mauerfall 1989 und der daraus entstehenden Stadtstruktur geprägt. Viele Häuser und Industriegebäude standen nach der Wende leer, hatten unklare Besitzverhältnisse und boten der Szene viel Raum für neue Ideen. Es herrschte gerade bei vielen Ostberlinern und denen, die neu hinzugezogen waren, eine Stimmung des Aufbruchs, was dazu führte, dass sich der Techno weiterentwickelte. Die Akteure der Szene bewegen sich im Stadtraum umher und funktionieren die Leerstände zu Orten um, an denen sie ihre Feste inszenieren und prägen und verändern damit das Stadtbild. Mit den Jahren entwickelte sich Berlin so zu einem zentralen Treffpunkt der Techno-Szene weltweit, der jedes Wochenende zahlreiche Fans der Musikrichtung anlockt. Mittlerweile genießt die Stadt Berlin den Ruf als Welthauptstadt der Clubkultur.
Grundlage dieser Arbeit stellt die ethnografische Untersuchung von Anja Schwanhäußer dar, die Kommunikationsweisen, Praktiken, Einflüsse sowie den Lebensstil des „Techno-Underground“ durch mehrere Monate Feldforschung genau untersucht hat.
Dabei geht es um die Frage, was die Techno-Szene auszeichnet. Zuerst wird darauf eingegangen, wie sich der „Techno-Underground“ nach der Wende in Berlin entwickelte.
Danach werden verschiedene grundlegende Szenen-Aspekte wie etwa die Raumnutzung, Hierarchien, subkulturelle Inszenierung oder der Konsum von Drogen beschrieben. Dann wird noch dargestellt, was die Musik Techno ausmacht und wie die Arbeitsverhältnisse in der Szene aussehen. Daraufhin folgt ein Exkurs zum Thema Individualität einer Stadt und abschließend gibt es ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Berlin nach der Wende
- Techno-Szene
- Ordnungen und Hierarchien
- Subkulturelle Inszenierung
- Drogen und Genuss
- Techno-Musik für den Moment
- Arbeiten in der Techno-Szene
- Flyer und andere Medien
- Exkurs: Individualität einer Stadt
- Bezug zum Film „Berlin Calling“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Berliner Techno-Szene nach der Wende und ihre Rolle in der Stadtentwicklung. Die Analyse basiert auf der ethnografischen Studie von Anja Schwanhäußer. Es wird untersucht, wie die Szene leerstehende Gebäude nutzte und das Stadtbild prägte.
- Die Entwicklung der Berliner Techno-Szene nach dem Mauerfall.
- Die Nutzung von leerstehenden Gebäuden und Brachen als Partylocations.
- Die subkulturelle Inszenierung und die damit verbundenen Praktiken.
- Die Rolle von Drogenkonsum im Kontext der Szene.
- Die Arbeitsverhältnisse innerhalb der Techno-Szene.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Berliner Techno-Szene ein und beschreibt deren Relevanz und die verbreiteten, oft oberflächlichen Vorurteile. Sie benennt den Fokus der Arbeit auf die Akteure der Szene in Berlin und deren Einfluss auf die Stadtentwicklung, insbesondere im Kontext der Nachwendezeit und des damit verbundenen Leerstandes. Die Arbeit stützt sich auf die ethnografische Studie von Anja Schwanhäußer, die den „Techno-Underground“ untersucht.
Berlin nach der Wende: Dieses Kapitel analysiert die räumlichen und gesellschaftlichen Bedingungen in Berlin nach dem Mauerfall, die die Entwicklung des Techno-Underground begünstigten. Der massive Leerstand, die unklare Besitzverhältnisse vieler Gebäude und die allgemeine Stimmung des Aufbruchs boten der Szene ideale Bedingungen zur „subkulturellen Umfunktionierung“ von Stadtteilen. Der historische Kontext Berlins mit seinen Brüchen und Narben wird als Hintergrund für die Entstehung dieser einzigartigen Szene beleuchtet. Das Kapitel thematisiert auch die Ursachen des Leerstandes, die von der DDR-Ideologie und den Folgen der Deindustrialisierung bis hin zu den komplizierten Rückübertragungen jüdischen Eigentums reichten. Die Besetzung von leerstehenden Gebäuden wird nicht als illegaler Akt, sondern als Teil einer Strategie zur Aufwertung der Stadtatmosphäre dargestellt.
Techno-Szene: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Techno-Szene selbst. Es beschreibt die Szene als Verkörperung des post-mauerfall-Lebensgefühls in Berlin, die die leerstehenden Gebäude und Brachen als „Locations“ umfunktionierte. Das Konzept des „Umherschweifens“ als offene und vielseitige Haltung gegenüber der Umwelt wird eingeführt, um die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Szene zu verdeutlichen. Die weiteren Kapitel dieser Sektion (Ordnungen und Hierarchien, Subkulturelle Inszenierung etc.) untersuchen verschiedene Aspekte der Szene - ihre inneren Strukturen, ihren Ausdruck und ihren Lebensstil im Detail.
Schlüsselwörter
Techno-Szene, Berlin, Mauerfall, Nachwendezeit, Subkultur, Stadtentwicklung, Raumnutzung, Leerstand, Deindustrialisierung, Urbaner Raum, Ethnografie, Anja Schwanhäußer, „Techno-Underground“, kollektiver Lebensstil, subkulturelle Umfunktionierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über die Berliner Techno-Szene nach der Wende
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Berliner Techno-Szene nach dem Mauerfall und ihre Rolle in der Stadtentwicklung. Der Fokus liegt auf der ethnografischen Studie von Anja Schwanhäußer und analysiert, wie die Szene leerstehende Gebäude nutzte und das Stadtbild prägte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Berliner Techno-Szene nach dem Mauerfall, die Nutzung leerstehender Gebäude als Partylocations, die subkulturelle Inszenierung, den Drogenkonsum im Kontext der Szene, die Arbeitsverhältnisse innerhalb der Szene und den Einfluss der Szene auf die Stadtentwicklung im Kontext des Leerstands nach der Wende.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert primär auf der ethnografischen Studie von Anja Schwanhäußer über den „Techno-Underground“ in Berlin. Sie analysiert die Szene aus soziologischer Perspektive und betrachtet ihre Bedeutung für die Stadtentwicklung nach dem Mauerfall.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Berlin nach der Wende, ein umfangreiches Kapitel zur Techno-Szene mit Unterkapiteln zu Ordnung, Hierarchien, subkultureller Inszenierung, Drogenkonsum, Arbeit und Medien, einen Exkurs zur Individualität der Stadt, einen Bezug zum Film „Berlin Calling“ und abschließend ein Fazit.
Welche Aspekte der Techno-Szene werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die inneren Strukturen der Szene (Ordnungen und Hierarchien), ihre subkulturelle Inszenierung, ihren Umgang mit Drogen, die Arbeitsverhältnisse innerhalb der Szene und die Verwendung von Medien wie Flyern zur Kommunikation und Organisation.
Wie wird der Zusammenhang zwischen der Techno-Szene und der Stadtentwicklung dargestellt?
Die Arbeit zeigt, wie die Techno-Szene die masssiven Leerstände nach dem Mauerfall nutzte, um alternative Partylocations zu schaffen und dadurch die Stadtatmosphäre und das Stadtbild aktiv mitzugestalten. Der Leerstand selbst wird im Kontext der DDR-Ideologie, Deindustrialisierung und Rückübertragungen jüdischen Eigentums erklärt.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Techno-Szene, Berlin, Mauerfall, Nachwendezeit, Subkultur, Stadtentwicklung, Raumnutzung, Leerstand, Deindustrialisierung, Urbaner Raum, Ethnografie, Anja Schwanhäußer, „Techno-Underground“, kollektiver Lebensstil, subkulturelle Umfunktionierung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Das Fazit der Arbeit wird in der vorliegenden Zusammenfassung nicht explizit wiedergegeben, da der Fokus auf den Kapiteln und der Struktur liegt. Das Fazit wird jedoch im vollständigen Text enthalten sein.)
- Quote paper
- Nadine Haas (Author), 2015, Der Techno-Underground in Berlin. Die Rolle und Bedeutung der Szene für die Stadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305976