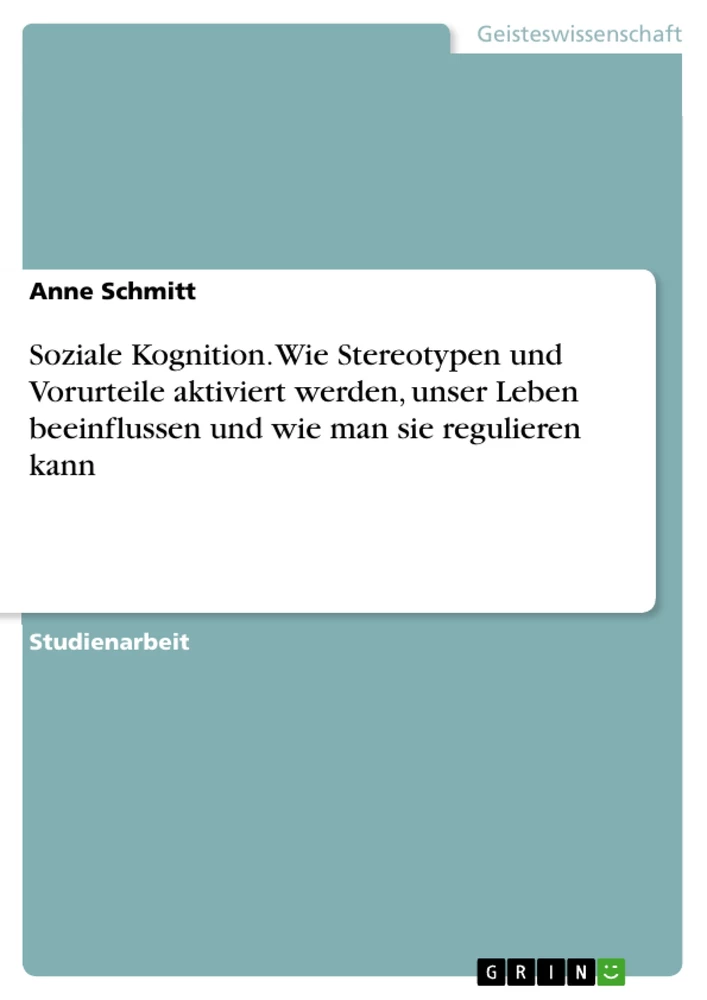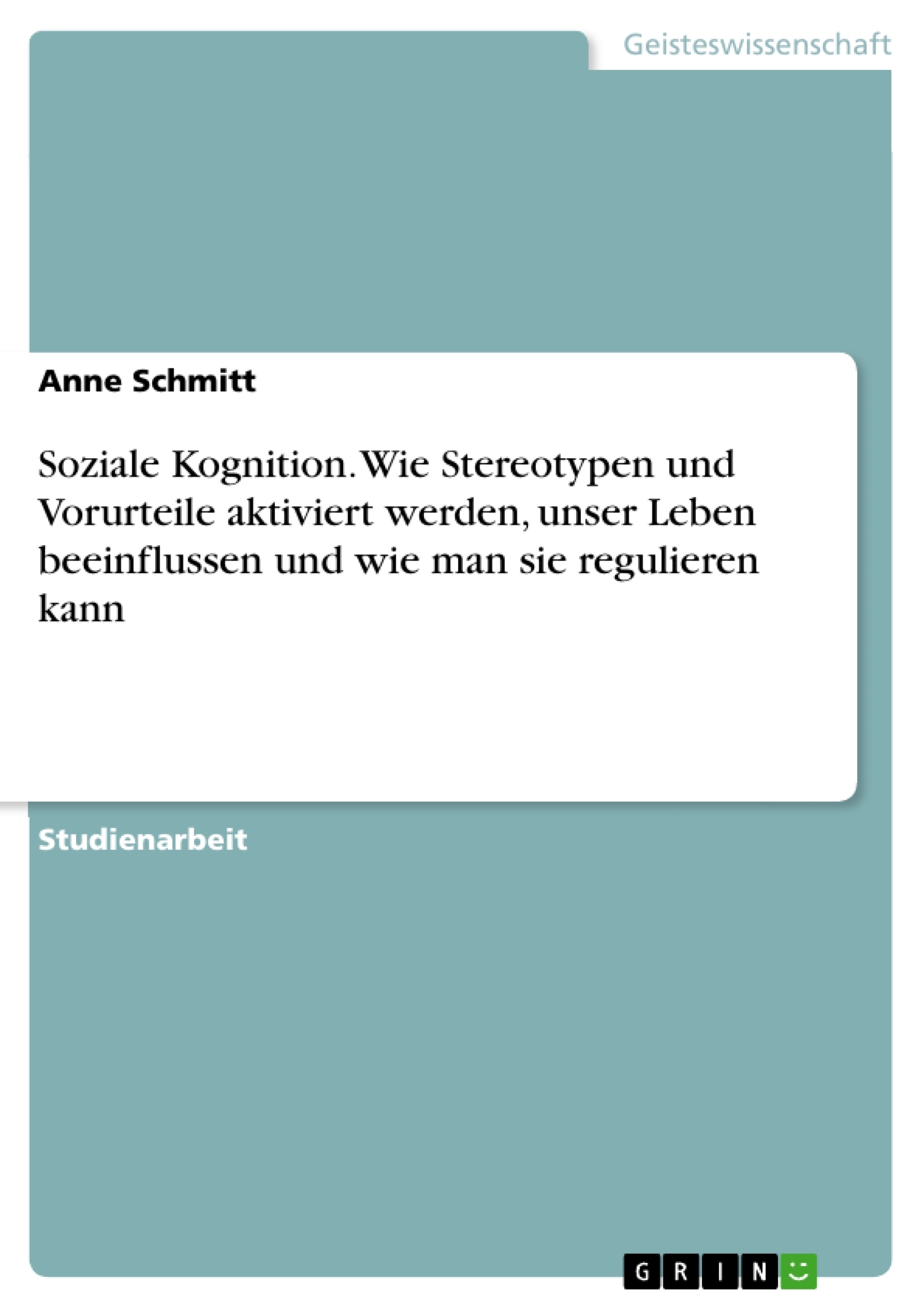Soziale Kognition ist ein umfassendes Thema innerhalb der Sozialpsychologie, das sich damit beschäftigt, zu verstehen, wie wir über uns selbst und über andere Menschen denken und wie die beteiligten Prozesse unsere Urteile und unser Verhalten in sozialen Kontexten beeinflussen.
Dabei stellen wir uns zum Beispiel folgende Fragen:
„Warum nahm ich an, der Mann an der Kaffeemaschine im Vorstandszimmer sei der Chef der Firma, während er doch tatsächlich der Sekretär ist?“ oder „Warum nahm ich an, dass Dr. Alex James männlich und weiß ist?“
Diese und viele weitere Fragen sind Bestandteil der sozialen Kognition, und somit auch das Phänomen, voreilig Schlüsse zu ziehen bzw. sich ein Bild von einem Menschen zu machen, den man gar nicht kennt.
Ziel dieser Arbeit ist es zu erläutern, was man unter soziale Kognition versteht, wie Stereotypen und Vorurteile aktiviert werden, welche Einflüsse diese auf uns haben und wie man es schafft, die Aktivierung von Vorurteilen und Stereotypen zu verhindern bzw. diese abzuschwächen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Was versteht man unter Kategorisierung?
- Stereotypen
- Vorurteile
- Diskriminierung
- automatischer vs. Kontrollierter Prozess
- Heuristiken
- Repräsentativitätsheuristik
- Verfügbarkeitsheuristik
- Anker- & Anpassungsheuristik
- Schemata und Priming
- Messung von Stereotypen und Vorurteilen
- Bogus Pipeline
- Verdeckte Beobachtung
- Erfassung psychologischer Reaktionen
- Messung implizierter Assoziationen
- Aktivierung von Stereotypen
- Automatische Aktivierung vs. Bewusste Regulierung von Stereotypen
- Aktivierung von Schemata
- Schema-Aktivierung und Verhalten
- Kontrolle gegenüber Vorurteilen und Stereotypen
- Automatische Aktivierung des Stereotyps verhindern
- Die Folgen der Unterdrückung stereotyper Gedankeninhalte
- Der Stroop-Effekt
- Der Bumerang- oder auch Rebound-Effekt
- Die Kontakthypothese
- Was tun, wenn Stereotypen bereits aktiviert sind?
- Das Kontinuummodell der Eindrucksbildung
- Dissoziationsmodell der Stereotypisierung
- Moderatorvariablen beim Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Verhalten
- Vorurteile in Mensch und Gesellschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sozialen Kognition, insbesondere mit der Entstehung, Aktivierung und Regulierung von Stereotypen und Vorurteilen. Ziel ist es, ein Verständnis für die automatischen und kontrollierten Prozesse zu entwickeln, die diese Phänomene beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Messmethoden und Strategien zur Kontrolle und Reduktion von Vorurteilen.
- Begriffsbestimmung und Kategorisierungsprozesse
- Messmethoden für Stereotype und Vorurteile
- Aktivierung und Regulierung von Stereotypen
- Der Einfluss von Stereotypen auf das Verhalten
- Strategien zur Kontrolle von Vorurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Kognition und der Bedeutung von Stereotypen und Vorurteilen ein. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die zu behandelnden Forschungsfragen.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen zu Kategorisierung, Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung. Es differenziert zwischen automatischen und kontrollierten Prozessen und erläutert wichtige Konzepte wie Heuristiken und Schemata. Die verschiedenen Arten von Heuristiken (Repräsentativitäts-, Verfügbarkeits- und Anker- & Anpassungsheuristik) werden detailliert beschrieben und ihre Relevanz für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Stereotypen und Vorurteilen herausgestellt. Der Einfluss von Schemata und Priming auf die Informationsverarbeitung wird ebenfalls beleuchtet.
Messung von Stereotypen und Vorurteilen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Methoden zur Erfassung von Stereotypen und Vorurteilen, darunter die Bogus Pipeline, verdeckte Beobachtung und die Erfassung psychologischer Reaktionen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Messung impliziter Assoziationen, die verdeutlicht, wie unbewusste Einstellungen und Assoziationen gemessen werden können. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Methoden werden kritisch diskutiert und ihre Anwendung in der Forschung illustriert.
Aktivierung von Stereotypen: Dieses Kapitel untersucht die Mechanismen der Stereotypenaktivierung, sowohl automatisch als auch bewusst kontrolliert. Es wird der Unterschied zwischen automatischer Aktivierung, die unbewusst und schnell abläuft, und bewusster Regulierung, die Anstrengung und Kontrolle erfordert, hervorgehoben. Der Einfluss von Schemata und der Kontext der Aktivierung werden ebenfalls beleuchtet. Es werden Beispiele aus der Forschung angeführt um die komplexen Interaktionen und Dynamiken zu verdeutlichen.
Schema-Aktivierung und Verhalten: Dieses Kapitel analysiert den direkten Zusammenhang zwischen der Aktivierung von Stereotypen und dem daraus resultierenden Verhalten. Es wird erläutert, wie aktivierte Schemata unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen können, und wie diese Prozesse zu Stereotypisierung und Diskriminierung führen können. Konkrete Beispiele veranschaulichen, wie Stereotypen unser Verhalten unbewusst steuern können.
Kontrolle gegenüber Vorurteilen und Stereotypen: Dieses Kapitel befasst sich mit Strategien zur Kontrolle und Reduktion von Vorurteilen. Es diskutiert die Schwierigkeit, die automatische Aktivierung von Stereotypen zu verhindern und analysiert die Folgen der Unterdrückung stereotyper Gedanken, wie den Stroop-Effekt und den Bumerang-Effekt. Es stellt die Kontakthypothese vor und untersucht Strategien, wie man mit bereits aktivierten Stereotypen umgehen kann, wobei das Kontinuummodell der Eindrucksbildung und das Dissoziationsmodell der Stereotypisierung detailliert erläutert werden. Der Einfluss von Moderatorvariablen wird auch berücksichtigt.
Vorurteile in Mensch und Gesellschaft: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Vorurteilen im gesellschaftlichen Kontext. Es beleuchtet den Einfluss sozialer und kultureller Faktoren auf die Entstehung und Verbreitung von Vorurteilen. Die Bedeutung von gesellschaftlichen Normen und die Rolle von Medien und Politik wird untersucht.
Schlüsselwörter
Stereotypen, Vorurteile, Diskriminierung, soziale Kognition, automatische Prozesse, kontrollierte Prozesse, Heuristiken, Schemata, Priming, Messmethoden, implizite Assoziationen, Stereotypenaktivierung, Verhaltenskontrolle, Kontakthypothese, Kontinuummodell der Eindrucksbildung, Dissoziationsmodell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Soziale Kognition, Stereotype und Vorurteile
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über soziale Kognition, insbesondere die Entstehung, Aktivierung und Regulierung von Stereotypen und Vorurteilen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf dem Verständnis automatischer und kontrollierter Prozesse, die diese Phänomene beeinflussen, sowie auf Messmethoden und Strategien zur Kontrolle und Reduktion von Vorurteilen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernthemen: Begriffsbestimmung und Kategorisierungsprozesse (inkl. Stereotypen, Vorurteile, Diskriminierung, Heuristiken und Schemata); Messmethoden für Stereotype und Vorurteile (z.B. Bogus Pipeline, verdeckte Beobachtung, implizite Assoziationstests); Aktivierung und Regulierung von Stereotypen (automatische vs. kontrollierte Prozesse); Einfluss von Stereotypen auf das Verhalten; Strategien zur Kontrolle von Vorurteilen (z.B. Kontakthypothese, Kontinuummodell der Eindrucksbildung, Dissoziationsmodell); und Vorurteile in Mensch und Gesellschaft.
Welche Methoden zur Messung von Stereotypen und Vorurteilen werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene Methoden zur Erfassung von Stereotypen und Vorurteilen, darunter die Bogus Pipeline (Simulation eines Lügendetektors), verdeckte Beobachtung, die Erfassung physiologischer Reaktionen (z.B. Hautleitfähigkeit) und insbesondere die Messung impliziter Assoziationen (IAT), die unbewusste Einstellungen und Assoziationen aufdeckt.
Wie werden Stereotype aktiviert und reguliert?
Das Dokument differenziert zwischen automatischer Stereotypenaktivierung, die unbewusst und schnell abläuft, und bewusster Regulierung, die Anstrengung und Kontrolle erfordert. Es beleuchtet den Einfluss von Schemata und Priming auf die Aktivierung und die Herausforderungen bei der Unterdrückung stereotyper Gedanken (Stroop-Effekt, Bumerang-Effekt).
Welche Strategien zur Kontrolle von Vorurteilen werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert verschiedene Strategien zur Kontrolle und Reduktion von Vorurteilen, darunter die Kontakthypothese (positiver Kontakt mit Mitgliedern der stereotypisierten Gruppe), das Kontinuummodell der Eindrucksbildung (systematische Informationsverarbeitung zur Korrektur von Stereotypen), das Dissoziationsmodell der Stereotypisierung (Trennung zwischen automatischer Aktivierung und bewusster Ablehnung von Stereotypen), und die Berücksichtigung von Moderatorvariablen, die den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Verhalten beeinflussen.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Stereotypen, Vorurteile, Diskriminierung, soziale Kognition, automatische Prozesse, kontrollierte Prozesse, Heuristiken (Repräsentativitäts-, Verfügbarkeits-, Anker- & Anpassungsheuristik), Schemata, Priming, Messmethoden (implizite Assoziationen), Stereotypenaktivierung, Verhaltenskontrolle, Kontakthypothese, Kontinuummodell der Eindrucksbildung und Dissoziationsmodell.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, die jeweils einen Aspekt der sozialen Kognition, Stereotypen und Vorurteile behandeln. Die Kapitel befassen sich mit der Einleitung, der Begriffsbestimmung, der Messung von Stereotypen und Vorurteilen, der Aktivierung von Stereotypen, dem Einfluss der Schema-Aktivierung auf das Verhalten, Strategien zur Kontrolle von Vorurteilen, der Rolle von Vorurteilen in der Gesellschaft und einem Fazit.
- Citar trabajo
- Anne Schmitt (Autor), 2015, Soziale Kognition. Wie Stereotypen und Vorurteile aktiviert werden, unser Leben beeinflussen und wie man sie regulieren kann, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306020