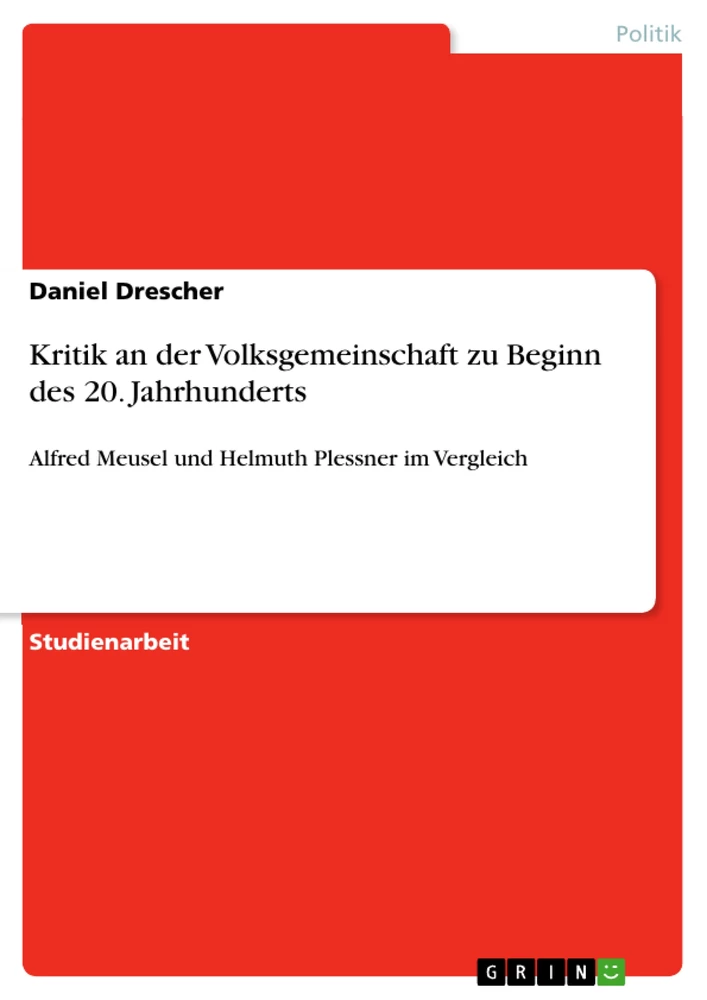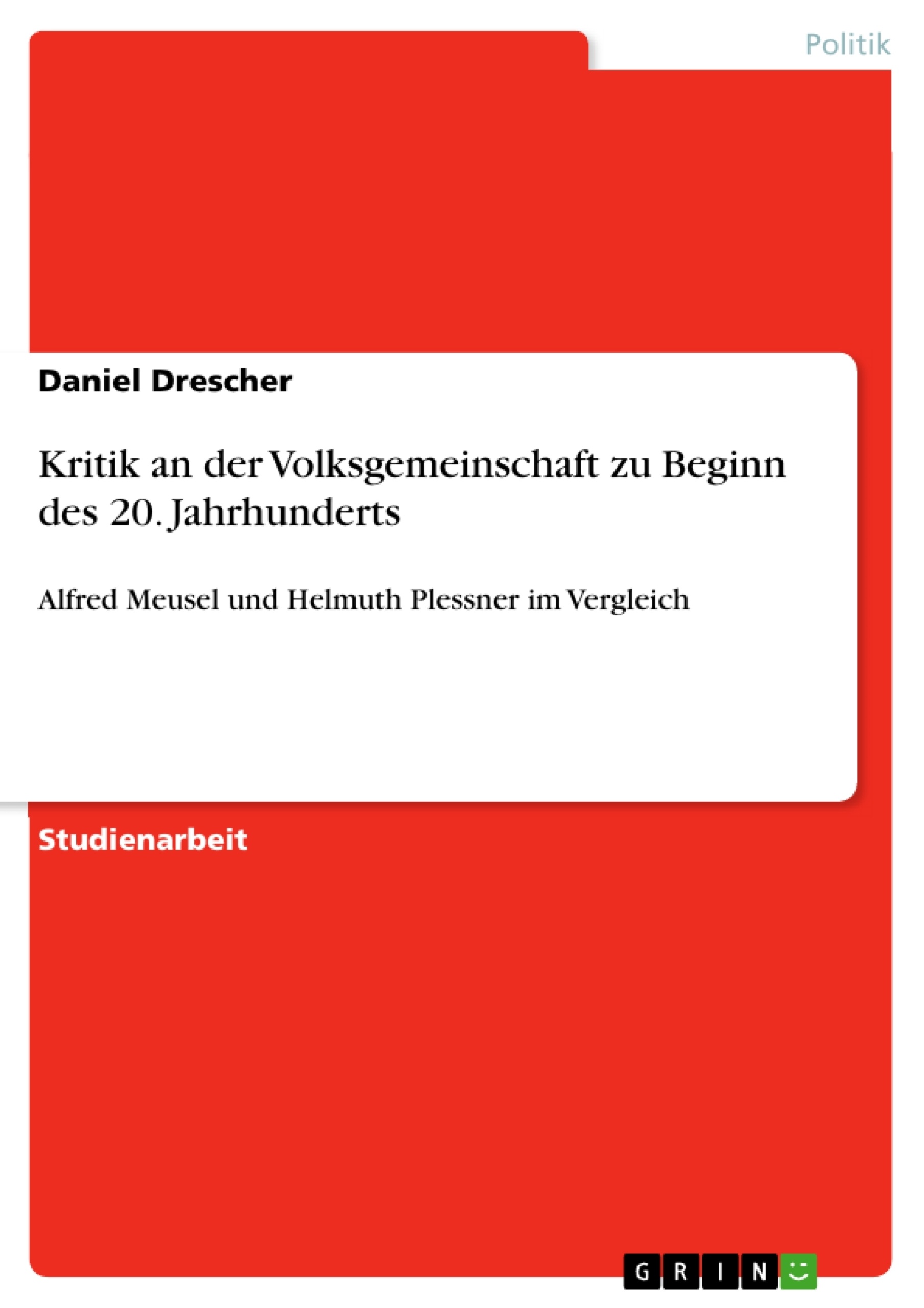Mit Beginn des 20. Jahrhunderts gewann der Begriff der „Volksgemeinschaft“ in allen politischen Strömungen an Konjunktur und war spätestens mit der politischen und ökonomischen Krise der Weimarer Republik das dominante Deutungsmodell. Im Zuge der Inflation 1923 und den darauf folgenden bürgerkriegsähnlichen Zuständen wurden in allen politischen Lagern Bekenntnisse zu einer parteien- und klassenübergreifenden Gemeinschaft formuliert.
In seinem 1887 erschienenen Hauptwerk „Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie“ wurden von Ferdinand Tönnies zwei gegensätzliche Prinzipien des menschlichen Lebens formuliert, welche zugleich eine historische Abfolge kennzeichnen. Gemeinschaft bezeichnet dabei traditionelle Lebensformen, die von einem ganzheitlichen „Wesenswillens“ gekennzeichnet sind; Gesellschaft meint dagegen den modernen bürgerlichen Kapitalismus, welcher von partikularen individualistischen „Kürwillen“ bestimmt wird. Die Bestrebungen zur Formierung einer deutschen Volksgemeinschaft bedienten sich dieser Gegenüberstellung, indem der künstlich-geschaffenen Zivilisation eine Höherwertigkeit der natürlich-gewachsenen Kultur entgegengehalten wurde. Die Vorstellung einer unentfremdeten, klassenübergreifenden Volksgemeinschaft entfaltende ihre Wirkungsmächtigkeit insbesondere aufgrund der versprochenen Versöhnung von Individuum und Masse sowie von Kapital und Arbeit.
Da die politische Kultur der Weimarer Republik von einer weitverbreiteten Befürwortung der deutschen Volksgemeinschaft geprägt war, haben Wissenschaftler, welche die politisierte Anwendung des Gemeinschaftsbegriffs kritisierten, nur wenig zeitgenössische Resonanz erfahren. Zu diesen verkannten Autoren können Helmuth Plessner und Alfred Meusel gezählt werden. Die von Plessner in „Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus“ formulierten Analysen galten noch bis Ende der 1980er unter Intellektuellen und Wissenschaftlern als Geheimtipp. Demgegenüber steht für die zwei Aufsätze „Der Radikalismus“ und „Das Kompromiß“ von Alfred Meusel immer noch ein intensiver wissenschaftlicher Diskurs aus. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich bei der Kritik von Helmuth Plessner und Alfred Meusel am Gemeinschaftsideal Anfang des 20. Jahrhundert finden? Lässt sich die marxistisch-theoretische Perspektive Meusel`s mit der philosophisch-anthropologischen Sichtweise Plessner`s verbinden oder widersprechen sich beide gegenseitig in ihren Analysen?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Das Ideal der Gemeinschaft in Deutschland - Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts
- Biographischer Werdegang der beiden Autoren
- Differenz in der Methodik
- Theoretische Parallelen?
- Der Einzelne in der Gemeinschaft
- Das Individuum innerhalb der Gesellschaft
- Radikalismus innerhalb der Gesellschaft
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Kritik von Helmuth Plessner und Alfred Meusel am Gemeinschaftsideal zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihren Ansätzen und untersucht, ob sich die marxistisch-theoretische Perspektive Meusels mit der philosophisch-anthropologischen Sichtweise Plessners verbinden lässt oder ob beide Analysen widersprüchlich sind.
- Die Entwicklung des Gemeinschaftsideals in Deutschland im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert
- Der Einfluss der Industrialisierung auf die deutsche Gesellschaft und die Sehnsucht nach einer „Volksgemeinschaft“
- Die biographischen Hintergründe und methodischen Unterschiede in den Analysen von Plessner und Meusel
- Der Vergleich der theoretischen Konzeptionen beider Autoren hinsichtlich der Rolle des Einzelnen in der Gemeinschaft, der Beziehungen des Individuums innerhalb der Gesellschaft und des Verhaltens von Radikalismus innerhalb der Gesellschaft
- Die Frage nach der Vereinbarkeit oder Widersprüchlichkeit der beiden theoretischen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor und skizziert die Relevanz von Plessners und Meusels Kritik am Gemeinschaftsideal im Kontext der Weimarer Republik.
- Das Ideal der Gemeinschaft in Deutschland - Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Gemeinschaftsideals in Deutschland vor dem Hintergrund der Industrialisierung und den damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen. Es zeigt auf, wie die Sehnsucht nach einer „Volksgemeinschaft“ als Reaktion auf die Verunsicherung der Massen entstand.
- Biographischer Werdegang der beiden Autoren: Dieses Kapitel stellt die Biographien von Plessner und Meusel gegenüber und beleuchtet ihre wissenschaftlichen und politischen Lebensläufe bis zur Veröffentlichung ihrer jeweiligen Werke.
- Differenz in der Methodik: Dieses Kapitel vergleicht die Methoden von Plessner und Meusel und analysiert die Ursachen für ihre unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze. Es untersucht, wie ihre biographischen Hintergründe ihre wissenschaftlichen Disziplinen beeinflussten.
- Theoretische Parallelen?: Dieses Kapitel untersucht die theoretischen Konzeptionen von Meusel und Plessner anhand von drei zentralen Dimensionen: der Bindung des Einzelnen in der Gemeinschaft, der Beziehungen des Individuums innerhalb der Gesellschaft und dem Verhalten von Radikalismus innerhalb der Gesellschaft. Es analysiert, ob und wie sich die beiden Perspektiven ergänzen oder widersprechen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Gemeinschaft, Volksgemeinschaft, Radikalismus, Tönnies, Plessner, Meusel, Weimarer Republik, Industrialisierung, Individualismus, Gesellschaft, Moderne, Kritik, Soziologie, Philosophie, Anthropologie, Marxismus.
- Citation du texte
- Daniel Drescher (Auteur), 2015, Kritik an der Volksgemeinschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306098