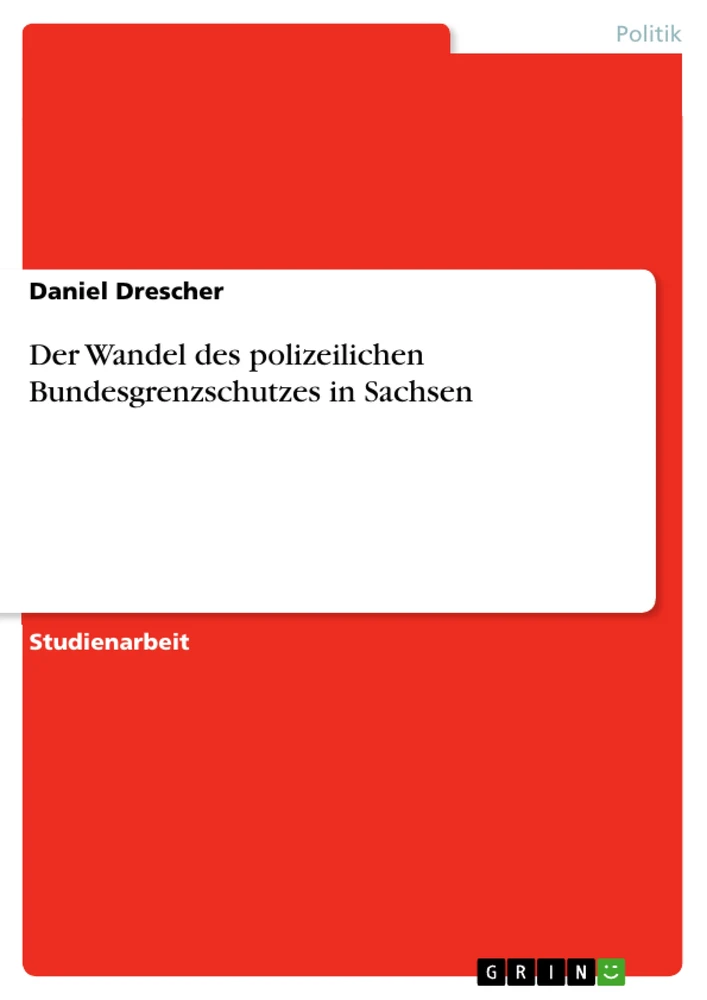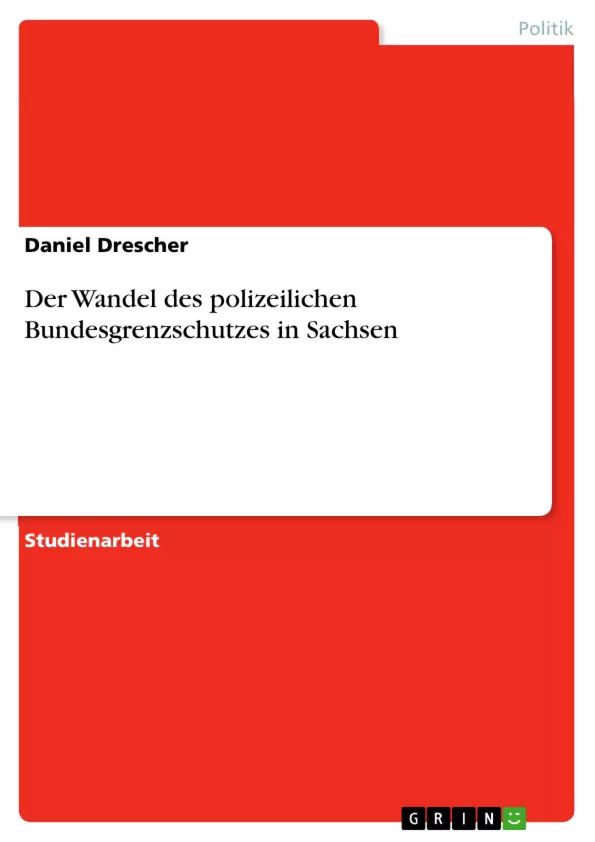In den letzten 25 Jahren erfuhr der Schutz der ostdeutschen Grenze gleich zwei Zäsuren: Der plötzliche Wegfall der innerdeutschen Grenze 1990 forderte die Exekutive, eine zügige und ausreichende Sicherung der neuen Ostgrenze zu errichten. 2007 erfolgte dann der Wegfall stationärer Binnengrenzkontrollen an der tschechisch-deutschen und polnisch-deutschen Grenze.
Dies hatte Kompetenzerweiterungen des Bundeskriminalamtes und des Bundesgrenzschutzes, später der Bundespolizei, zur Folge. Beide wurden im März 1951 gegründet und unterstehen dem Bundesministerium des Inneren. Die gesetzliche Grundlage bieten dazu Art. 73 Nr. 3 GG, wonach der Grenzschutz zur ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes gehört und Art. 87 Satz 2 GG, der besagt, dass Bundesgrenzschutzbehörden und Zentralstellen für den Informationsaustausch zwischen den Polizeien errichtet werden können. Für alle anderen polizeilichen Aufgaben sind auf Basis Art. 30 GG im Kern die Länder zuständig.
Zunehmende internationale Verflechtungen durch neue Kommunikations- und Transportmöglichkeiten ermöglichen es der Schleuserkriminalität, dem illegalen Waren- und Drogenhandel in global organisierten Banden zu agieren. Dies erfordert eine bessere Zusammenarbeit in der Strafverfolgung und Prävention zwischen den betroffenen Staaten. Eine Plattform bietet dazu die EU. Im Zusammenhang mit dem Ziel einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu errichten, fördert die Union nach Art. 67 Abs. 3 AEUV die justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten. Die Unterzeichnung von Schengen I 1985 und die Unterzeichnung von Schengen II 1990 erforderten eine Aufgabenerweiterung des BGS. Folglich nahmen neben der klassischen Aufgabe des Grenzschutzes und des Grenzkontrolldienstes die Einsatzbereiche des BGS stetig zu.
Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit, inwiefern sich der Schutz der Grenze durch den BGS beziehungsweise der BPol am Beispiel der sächsischen Bundesgrenze verändert hat. Als erstes wird die Entwicklung des Grenzschutzes in zwei Phasen eingeteilt, wobei die Eingangs erwähnte zweite Zäsur die Trennlinie darstellt. Die beiden Phasen sind vergleichend gegenübergestellt. Dabei wird jeweils als erstes die Methode des Grenzschutzes dargestellt. Danach erfolgt jeweils die Darstellung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Am Ende erfolgt der direkte Vergleich der beiden Phasen und es werden Schlussfolgerungen gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grenzschutz in Deutschland am Beispiel Sachsen zwischen 1990 und 2007
- Klassischer Grenzschutz
- Bilaterale Zusammenarbeit
- Grenzschutz in Deutschland am Beispiel Sachsen seit 2007
- Neuer Grenzschutz
- Bilaterale Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union
- Zusammenarbeit mit der Sächsischen Polizei
- Fundamentaler Wandel des Grenzschutzes in Sachsen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung des Grenzschutzes an der sächsischen Bundesgrenze zwischen 1990 und 2007 und analysiert die Veränderungen im Grenzschutz nach 2007. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Herausforderungen, die sich aus dem Wegfall der innerdeutschen Grenze und der Einführung neuer Sicherheitskonzepte ergeben.
- Entwicklung des Grenzschutzes in Deutschland am Beispiel Sachsen
- Veränderungen im Grenzschutz durch den Wegfall stationärer Binnengrenzkontrollen
- Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei und Landespolizei
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Rahmen der Europäischen Union
- Schlussfolgerungen zum Wandel des Grenzschutzes in Sachsen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in zwei Phasen: die erste Phase (1990-2007) beschreibt den klassischen Grenzschutz in Sachsen mit Fokus auf die Aufgaben des Bundesgrenzschutzes und die bilaterale Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Die zweite Phase (nach 2007) behandelt die Veränderungen im Grenzschutz durch den Wegfall stationärer Binnengrenzkontrollen, die neue Aufgaben für die Bundespolizei mit sich brachten. Diese Phase umfasst auch die Beschreibung der Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union und die Kooperation mit der Sächsischen Polizei.
Schlüsselwörter
Grenzschutz, Bundesgrenzschutz, Bundespolizei, Sachsen, Europäische Union, bilaterale Zusammenarbeit, grenzüberschreitende Kriminalität, innerdeutsche Grenze, Wegfall stationärer Binnengrenzkontrollen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Grenzschutz in Sachsen nach 1990 verändert?
Nach dem Wegfall der innerdeutschen Grenze musste zügig eine neue Sicherung der Ostgrenze aufgebaut werden, die 2007 durch den Wegfall stationärer Binnengrenzkontrollen erneut grundlegend reformiert wurde.
Was sind die Aufgaben der Bundespolizei an der sächsischen Grenze?
Neben dem klassischen Grenzschutz umfasst der Dienst heute verstärkt die Bekämpfung von Schleuserkriminalität, illegalem Waren- und Drogenhandel sowie die länderübergreifende Strafverfolgung.
Welche Bedeutung hat das Schengener Abkommen für Sachsen?
Durch Schengen entfielen die stationären Kontrollen zu Tschechien und Polen, was eine Aufgabenerweiterung des BGS/der Bundespolizei hin zu Schleierfahndung und internationaler Kooperation erforderte.
Wie arbeiten Bundes- und Landespolizei in Sachsen zusammen?
Die Arbeit beleuchtet die enge Kooperation in der Grenzregion, um Sicherheitslücken zu schließen, die durch den Wegfall fester Kontrollpunkte entstanden sind.
Welche Rolle spielt die Europäische Union beim Grenzschutz?
Die EU fördert nach Art. 67 AEUV die polizeiliche Zusammenarbeit, um einen Raum der Freiheit und Sicherheit zu schaffen und global organisierte Kriminalität effektiver zu bekämpfen.
- Citar trabajo
- Daniel Drescher (Autor), 2014, Der Wandel des polizeilichen Bundesgrenzschutzes in Sachsen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306103