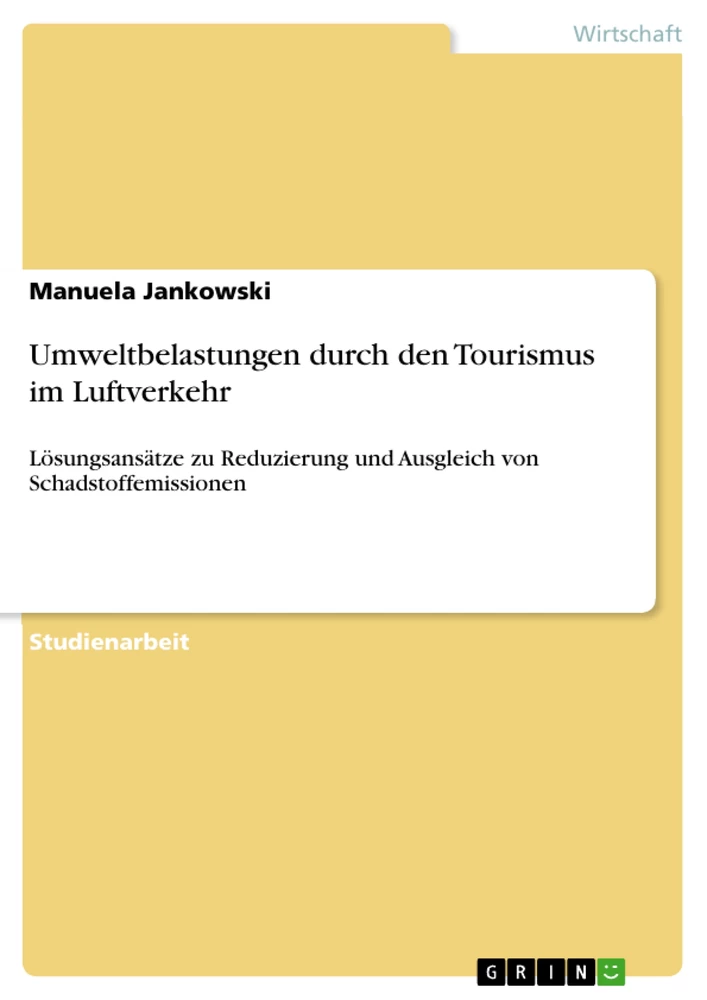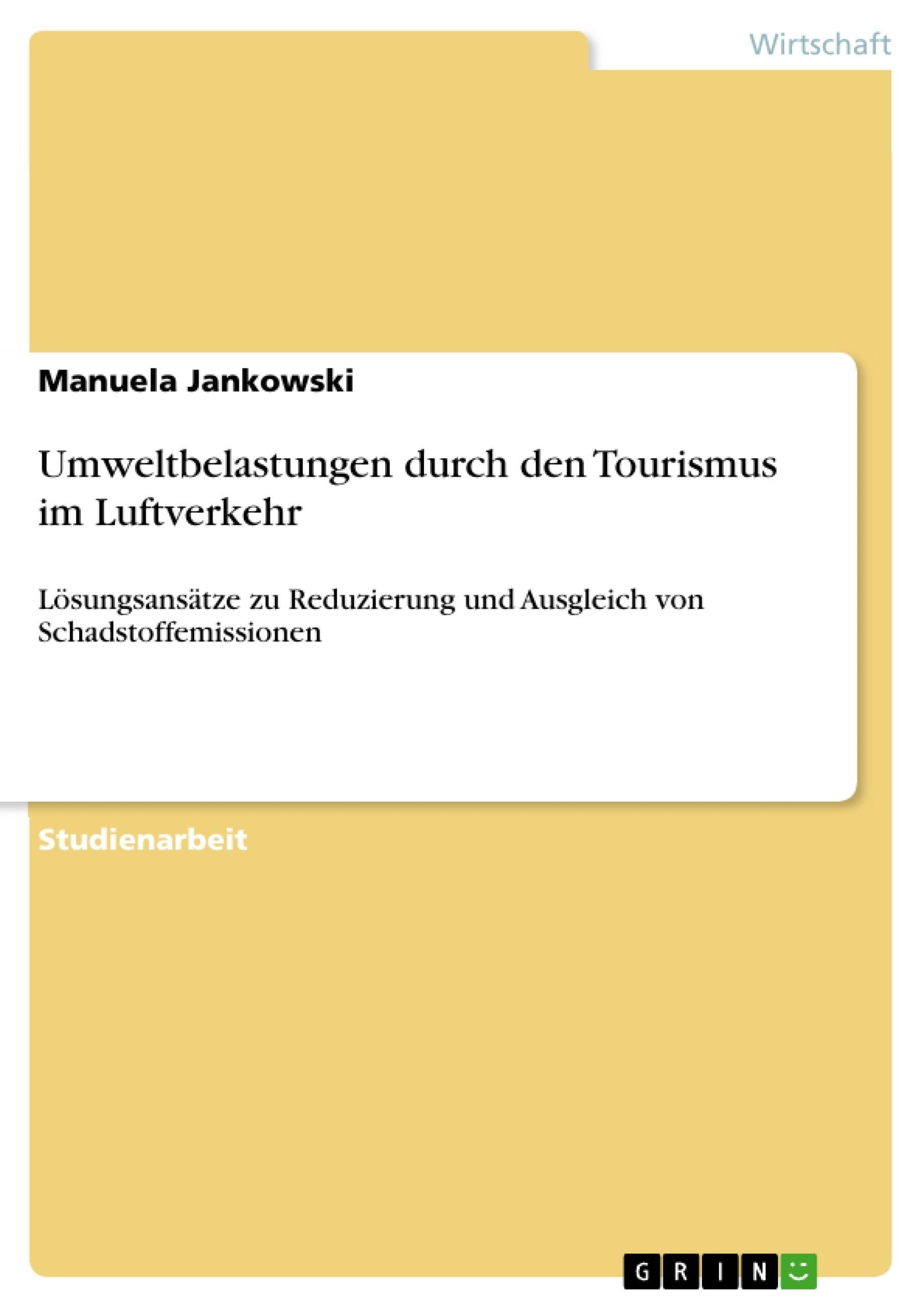Diese Arbeit soll sich mit dem Wachstum des Tourismus, das damit erhöhte Reiseaufkommen und die Auswirkungen auf Umwelt und Klima beschäftigen. Dabei soll auf die Möglichkeiten der Schadstoffreduzierung und Schadstoffausgleichsprojekte eingegangen werden.
Das Wachstum der Tourismusbranche bringt eine erhöhte Nutzung von Verkehrsmittel durch die Urlaubsreisenden mit sich und führt so zu einer stetigen Ausweitung und Verbesserung der Verkehrswege. Damit einher erfreut sich das Flugzeug als Reiseverkehrsmittel immer größerer Beliebtheit, da es eine schnelle Raumüberwindung insbesondere zu fernen Reisezielen bietet und so neue Reisedestinationen oder Geschäftsfelder attraktiv macht. Durch den wachsenden Tourismus steigen jedoch auch die Schadstoffemissionen, die unsere Umwelt und unser Klima negativ beeinflussen. Eine nachhaltige Nutzung und Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz sind daher heute unumgänglich.
Gerade der neue Trend von ‚Bioprodukten‘ und ‚nachhaltigem Denken und Verhalten‘ signalisiert das gestiegene Bewusstsein der Bevölkerung am Schutz und der Erhaltung der Umwelt für uns und zukünftige Generationen. Die Anforderungen der Kunden an Leistungsträger, wie Hotels oder Verkehrsmittelunternehmen, nach umweltbewusstem Handeln und Verhalten steigt immer mehr, so dass diese, dadurch angeregt, immer mehr die Nachhaltigkeit zu einem der Leitbilder Ihres Unternehmens machen. Investitionen in umweltbewusste Technologien, Reduzierungen der Schadstoffausstöße durch technische und operationelle Verbesserungen, sowie die Förderung schadstoffausgleichender Projekte stehen dabei unter besonderer Betrachtung der Studienarbeit.
Im Rahmen des Kyoto-Protokoll 1997, welches dem Ziel nachgeht die globale Klimaerwärmung durch Reduzierung der Treibhausgase zu verlangsamen und so dem weltweiten Klimaschutz nach kommen soll, wird die Arbeit Handlungserfordernisse zu Reduzierung und Ausgleichsmöglichkeiten der Schadstoffausstöße erläutern. Dabei soll auch der neue EU- Emissionshandel für den Luftverkehr betrachtet werden, der weiterhin unter einer großen Kritik steht.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Zielsetzung der Arbeit
- Entwicklung des Tourismus und seine Ansätze an Nachhaltigkeit
- Entwicklung des Tourismus
- Geschichtlicher Rückblick
- Definition Tourismus
- Tourismus heute
- Prognosen und Trends
- Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche
- Umwelt und Klimaprobleme durch den Tourismus
- Beziehungen zwischen Umwelt und Tourismus
- Positive Effekte des Tourismus
- Negative Effekte des Tourismus
- Umweltbelastungen durch touristische Verkehrsmittel
- Umweltbelastungen durch den Flugverkehrssektor
- Schadstoffreduzierung im Flugverkehrssektor
- Technologische und operationelle Verbesserungen
- Triebwerke
- Sitzplatzkapazität
- Passagierauslastung
- Flugzeugtypen im Vergleich
- Airbus A 380 - 800
- Boeing B 747-800
- Schadstoffausgleichszahlungen im Flugverkehr
- Emissionshandel
- Handel mit Emissionsrechten
- Handel mit Gutschriften aus Schadstoffminderungsprojekten
- Emissionshandel für den Luftverkehr
- Befürworter des EU- Emissionshandelssystem im Luftverkehr
- Kritik am EU-Emissionshandelssystem im Luftverkehr
- Schlussbemerkung und Ausblick
- Entwicklung des Tourismus und seine Auswirkungen auf die Umwelt
- Umweltbelastungen durch den Luftverkehr und die Auswirkungen auf das Klima
- Technologische und operationelle Ansätze zur Reduzierung von Schadstoffemissionen im Luftverkehr
- Politische Instrumente zur Steuerung von Emissionen im Luftverkehr, wie z.B. Emissionshandel
- Bewertung der Effektivität verschiedener Lösungsansätze zur Reduzierung und zum Ausgleich von Schadstoffemissionen im Flugverkehr
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit den Umweltbelastungen, die durch den Tourismus verursacht werden, wobei der Fokus auf den Luftverkehr liegt. Das Ziel der Arbeit ist es, die Zusammenhänge zwischen Tourismus und Umweltbelastung zu analysieren und Lösungsansätze zur Reduzierung und zum Ausgleich von Schadstoffemissionen im Flugverkehr zu erforschen.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
In Kapitel 2 werden die Entwicklung des Tourismus und seine Ansätze an Nachhaltigkeit beleuchtet. Es wird die historische Entwicklung des Tourismus beschrieben, eine Definition des Begriffs "Tourismus" geliefert und der aktuelle Stand des Tourismus beleuchtet. Darüber hinaus werden Prognosen und Trends für die Zukunft des Tourismus diskutiert. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung des Konzepts der Nachhaltigkeit im Kontext der Tourismusbranche.
Kapitel 3 befasst sich mit den Umwelt- und Klimaproblemen, die durch den Tourismus verursacht werden. Es wird die Beziehung zwischen Umwelt und Tourismus betrachtet, wobei sowohl positive als auch negative Effekte des Tourismus auf die Umwelt analysiert werden. Der Fokus liegt dabei auf den Umweltbelastungen, die durch touristische Verkehrsmittel entstehen, insbesondere durch den Flugverkehrssektor. Es werden die verschiedenen Arten von Umweltbelastungen durch den Flugverkehr, wie z.B. Treibhausgasemissionen und Lärm, erläutert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit Lösungsansätzen zur Reduzierung von Schadstoffemissionen im Flugverkehrssektor. Es werden technologische und operationelle Verbesserungen im Flugverkehr, wie z.B. effizientere Triebwerke und verbesserte Sitzplatzkapazität, betrachtet. Darüber hinaus werden alternative Flugzeugtypen im Vergleich analysiert, um ihre Effizienz in Bezug auf Schadstoffemissionen zu bewerten. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der behandelt wird, sind Schadstoffausgleichszahlungen im Flugverkehr, wie z.B. Emissionshandel. Es wird das Konzept des Emissionshandels und dessen Anwendung im Luftverkehr erläutert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieser Arbeit sind: Tourismus, Umweltbelastung, Luftverkehr, Schadstoffemissionen, Nachhaltigkeit, Emissionshandel, Technologie, Effizienz, Klimawandel, politische Steuerung, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich der Flugverkehr auf das Klima aus?
Der Flugverkehr trägt durch den Ausstoß von CO2 und Stickoxiden sowie durch die Bildung von Kondensstreifen signifikant zur globalen Erwärmung bei.
Was ist der EU-Emissionshandel für den Luftverkehr?
Es ist ein marktbasiertes Instrument, bei dem Fluggesellschaften Zertifikate für ihren Schadstoffausstoß erwerben müssen, um Anreize zur Emissionsminderung zu schaffen.
Welche technologischen Lösungen gibt es zur Schadstoffreduzierung?
Dazu gehören effizientere Triebwerke, aerodynamische Verbesserungen an Flugzeugen und der Einsatz von leichteren Materialien zur Treibstoffeinsparung.
Was versteht man unter Schadstoffausgleichsprojekten?
Passagiere oder Unternehmen können freiwillige Zahlungen leisten, die in Klimaschutzprojekte (z. B. Aufforstung) fließen, um die beim Flug entstandenen Emissionen rechnerisch zu kompensieren.
Wie verändert das Bewusstsein für Nachhaltigkeit den Tourismus?
Immer mehr Kunden fordern umweltbewusstes Handeln von Reiseanbietern, was dazu führt, dass Nachhaltigkeit zu einem zentralen Leitbild in der Tourismusbranche wird.
- Citar trabajo
- Manuela Jankowski (Autor), 2012, Umweltbelastungen durch den Tourismus im Luftverkehr, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306170