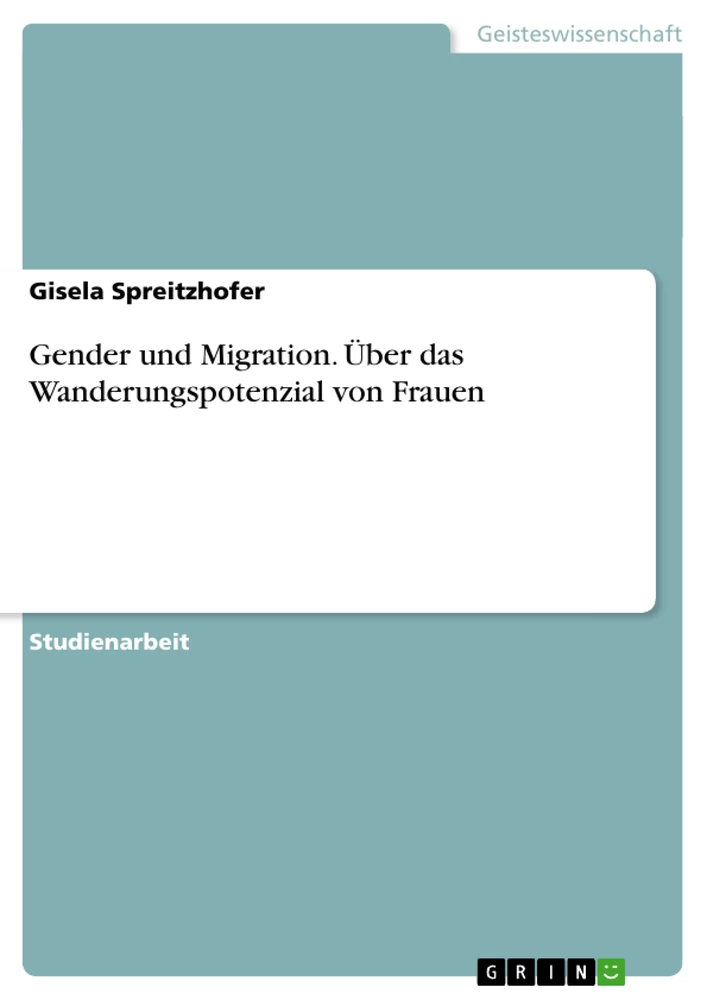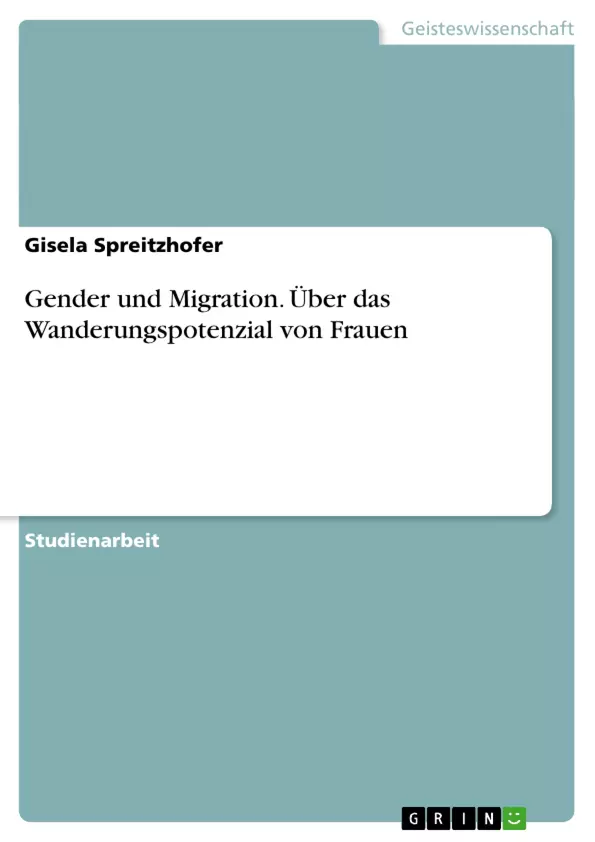Gängige migrationstheoretische Ansätze wurden in den vergangenen Jahren in zunehmendem Maße wegen ihrer "gender blindness" kritisiert. Vorwiegend männliche Forscher gingen vom Postulat des jungen, männlichen, abenteuerlustigen Migranten aus, der allein in der Hoffnung auf einen höheren Lebensstandard aufbricht; Frauen wurden allenfalls als begleitende oder nachwandernde "Anhängsel" ihrer Männer wahrgenommen.
Diese Arbeit zeigt u.a. auf, welch großes Wanderungspotenzial in Frauen steckt – schließlich nimmt seit einigen Jahrzehnten bei allen Migrationsformen in sämtlichen Regionen die "Feminisierung" der internationalen Migration zu. Anschließend wird erläutert, wie "Gender" als analytische Kategorie allmählich in die feministisch orientierte Forschung bzw. in die Migrationsforschung im Besonderen einfloss. In der Folge entstanden Theorien, die weibliche Migration zu erklären versuchten. Breiter Raum wird auch der Konstruktion und Rekonstruktion von Geschlechterrollen während des Migrationsvorgangs gewidmet. Gender & Migration im Entwicklungskontext stellen schließlich einen letzten Schwerpunkt dar.
Inhaltsverzeichnis
- Die Bedeutung von internationaler Migration zu Beginn des 21. Jahrhunderts
- Was ist Migration?
- Internationale Migration: Zahlen, regionale Unterschiede und Trends
- Warum Menschen wandern – Theorien zu Migration
- Neoklassische Ökonomie
- Theorie des dualen Arbeitsmarktes
- The New Economics of Migration
- Weltsystemtheorie und Neomarxismus
- Migrationsnetzwerke
- Transnationale Räume und Identitäten
- Die Ausblendung sowie Sichtbarmachung von Frauen in der Migrationsforschung
- Wo sind die Migrantinnen?
- Gender als analytische Kategorie
- Erklärungsansätze zu weiblicher Migration
- Neoklassik
- Behaviorismus
- Strukturalismus
- Haushaltsstrategien
- Migrantinnen als Opfer von Diskriminierungen
- Konstruktion und Rekonstruktion der Geschlechterrollen in der internationalen Migration
- (Re)konstruierte Weiblichkeit und Männlichkeit
- Die wechselseitige Beeinflussung von Geschlechterbeziehungen und Migrationsprozess
- Noch im Herkunftsland
- Der Grenzübertritt
- Im Aufnahmeland
- Gender, Migration und Entwicklung
- Klassifizierung von Bevölkerungsbewegungen in Entwicklungsländern
- Migrationsziel
- Migrationsdauer
- Migrationsform
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede geschlechtsspezifischer Migrationsmuster in Entwicklungsländern
- Thesen zur Einwanderung von Frauen aus Entwicklungsländern in Industrieländer
- Abschließende Bemerkungen
- Fazit: Die „femina migrans“ als „global player“
- Zukünftige Richtungen einer gendersensiblen Migrationsforschung
- Lehren für die Politik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Gender und Migration und untersucht die Bedeutung internationaler Migration zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie beleuchtet unterschiedliche Theorien zur Migration und analysiert die Rolle von Gender in der Migrationsforschung, insbesondere die Ausblendung und Sichtbarmachung von Frauen. Die Arbeit untersucht auch die Konstruktion und Rekonstruktion von Geschlechterrollen im Kontext der internationalen Migration sowie die Verbindung von Gender, Migration und Entwicklung.
- Die Bedeutung internationaler Migration im 21. Jahrhundert
- Theorien zur Migration und ihre Bedeutung für die Analyse von Gender
- Die Rolle von Frauen in der Migrationsforschung und die Erklärungsansätze für weibliche Migration
- Konstruktion und Rekonstruktion von Geschlechterrollen im Migrationsprozess
- Zusammenhänge zwischen Gender, Migration und Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung internationaler Migration zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Es wird eine Definition von Migration gegeben und es werden Zahlen, regionale Unterschiede und Trends in der internationalen Migration aufgezeigt. Kapitel zwei beschäftigt sich mit Theorien zu Migration und analysiert unterschiedliche Erklärungsansätze, wie z.B. die Neoklassische Ökonomie, die Theorie des dualen Arbeitsmarktes, die New Economics of Migration, die Weltsystemtheorie, Migrationsnetzwerke und Transnationale Räume und Identitäten. Das dritte Kapitel widmet sich der Ausblendung und Sichtbarmachung von Frauen in der Migrationsforschung. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Fokussierung auf männliche Migrationserfahrungen ergeben, und untersucht verschiedene Erklärungsansätze zu weiblicher Migration, wie z.B. die Neoklassik, den Behaviorismus, den Strukturalismus und Haushaltsstrategien. Zudem werden Migrantinnen als Opfer von Diskriminierungen thematisiert. Kapitel vier analysiert die Konstruktion und Rekonstruktion von Geschlechterrollen im Kontext der internationalen Migration. Es betrachtet die (Re)konstruktion von Weiblichkeit und Männlichkeit im Migrationsprozess und die wechselseitige Beeinflussung von Geschlechterbeziehungen und Migration, insbesondere im Herkunftsland, beim Grenzübertritt und im Aufnahmeland. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Gender, Migration und Entwicklung. Es untersucht die Klassifizierung von Bevölkerungsbewegungen in Entwicklungsländern, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede geschlechtsspezifischer Migrationsmuster in Entwicklungsländern sowie Thesen zur Einwanderung von Frauen aus Entwicklungsländern in Industrieländer.
Schlüsselwörter
Internationale Migration, Gender, Migrationsforschung, Geschlechterrollen, Migrantinnen, Diskriminierung, Entwicklung, Transnationale Räume, Identitäten, Neoklassische Ökonomie, Theorie des dualen Arbeitsmarktes, New Economics of Migration, Weltsystemtheorie, Migrationsnetzwerke.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet 'Gender Blindness' in der Migrationsforschung?
Es beschreibt die Tendenz älterer Theorien, Migration als rein männliches Phänomen zu betrachten und Frauen nur als begleitende „Anhängsel“ wahrzunehmen.
Was ist die 'Feminisierung der Migration'?
Dieser Trend beschreibt den weltweit steigenden Anteil von Frauen, die unabhängig und aus eigenen ökonomischen Motiven international migrieren.
Wie verändern sich Geschlechterrollen durch Migration?
Migration führt oft zu einer (Re-)Konstruktion von Weiblichkeit und Männlichkeit, da Frauen im Zielland neue Freiheiten gewinnen oder Männer ihre Rolle als Alleinernährer verlieren.
Welche ökonomischen Theorien erklären weibliche Migration?
Neben der Neoklassik werden Ansätze wie die „New Economics of Migration“ genutzt, die Migration als Haushaltsstrategie zur Risikominimierung sehen.
Warum sind Migrantinnen oft Opfer von Diskriminierung?
Sie erleben häufig eine Mehrfachdiskriminierung aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft und ihres oft prekären Aufenthaltsstatus oder Arbeitsverhältnisses.
Was ist die 'femina migrans' als Global Player?
Der Begriff betont die aktive Rolle von Migrantinnen in der globalen Wirtschaft, insbesondere durch Rücküberweisungen (Remittances) in ihre Heimatländer.
- Arbeit zitieren
- MMag. M.A. Gisela Spreitzhofer (Autor:in), 2004, Gender und Migration. Über das Wanderungspotenzial von Frauen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30617