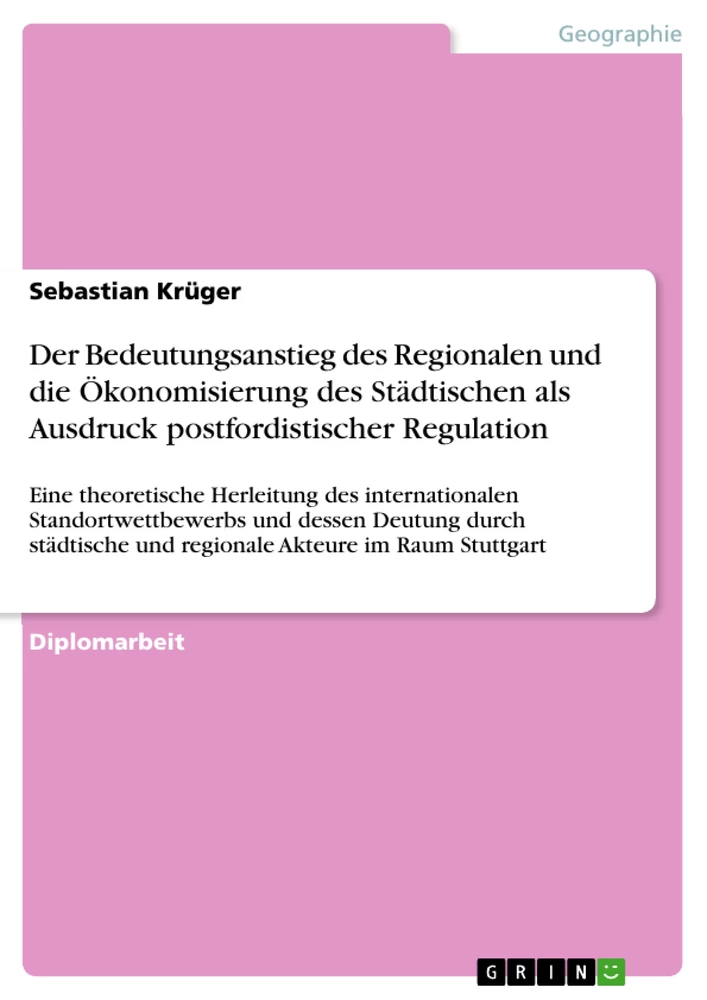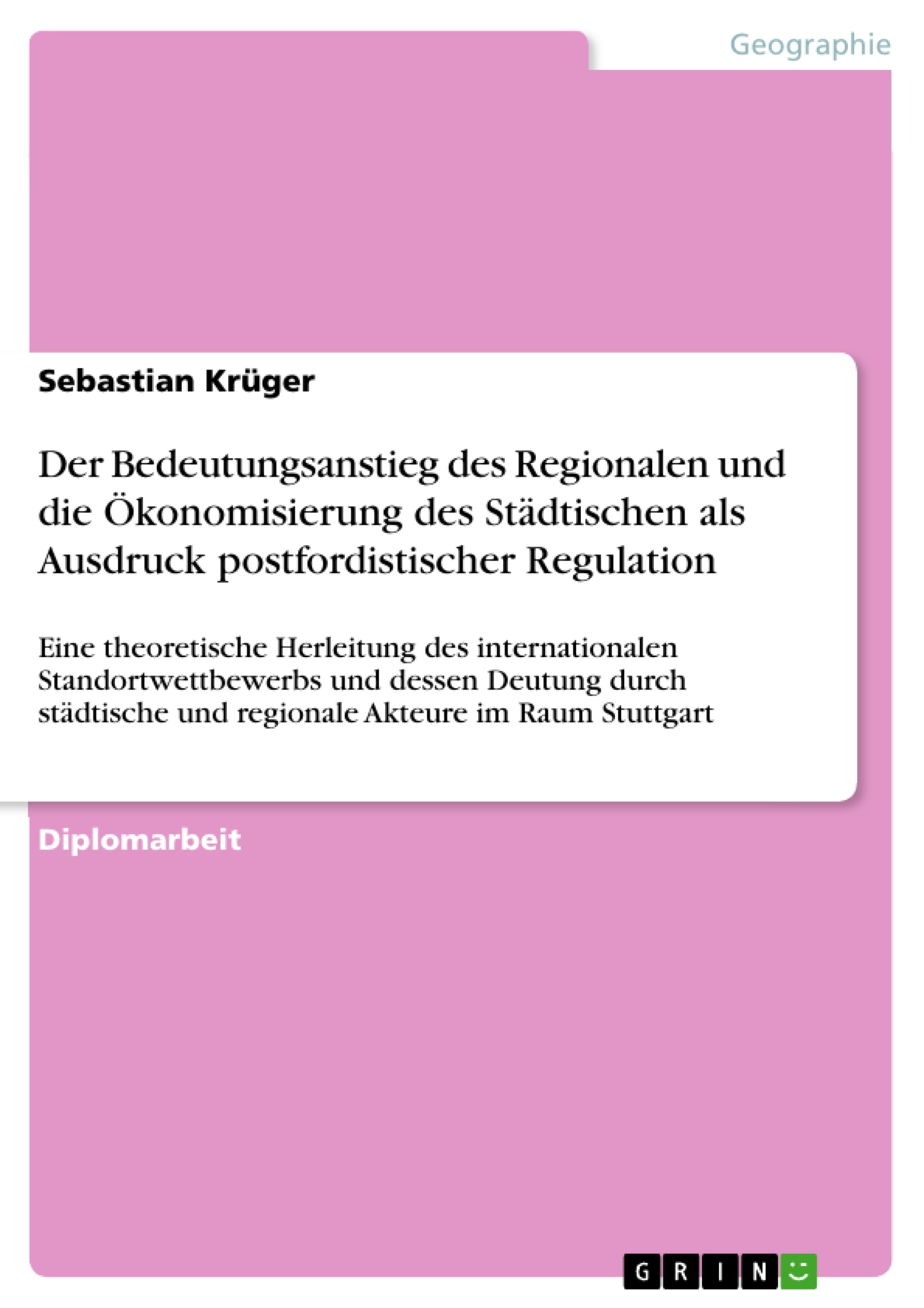Urbane Zentren sehen sich mit den wirtschaftlichen Konsequenzen des Strukturwandels, fiskalisch bedingten Mindereinnahmen, einer zunehmenden Arbeitslosigkeit und sozial-räumlicher Polarisierung konfrontiert und treten in Konkurrenz zu anderen (Stadt)Regionen um private und öffentliche Investitionen, Humankapital und Touristen. In diesem Zusammenhang ist ein allgemeiner Trend des neoliberalen Umbaus des Städtischen zu beobachten. Lokale Politik wird zusehends nach ökonomischen Gesichtspunkten betrieben und Großstädte gehen vermehrt wirtschaftliche und politische Kooperationsformen mit ihrem regionalen Umland ein. Obgleich sich hinsichtlich der skizzierten Entwicklung Gemeinsamkeiten zwischen Großstadtregionen konstatieren lassen, gilt es, spezifische Kausalitäten und lokale Pfadabhängigkeiten durch qualitative Fallstudien zu erforschen.
In seiner Diplomarbeit betrachtet Sebastian Krüger den Raum Stuttgart als 'Teilnehmer' im internationalen Standortwettbewerb und wirft die Frage auf, ob das räumliche Konkurrenzdenken ausgeprägter ist als es die tatsächliche Konkurrenzsituation zwischen Standorten rechtfertigen würde. Um diesbezüglich Erkenntnisse zu gewinnen, führt er Experteninterviews mit lokalen und regionalen Akteuren, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit die Stuttgarter Stadt- und Regionalentwicklung prägen und vice versa in ihrem raumwirksamen Handeln und Denken durch wahrgenommene räumliche Strukturen beeinflusst werden. Das übergeordnete Forschungsziel besteht darin, herauszufinden, wie sich der Standortwettbewerb sowohl in seiner materiellen Form als auch in seiner diskursiven Praxis in Stuttgart manifestiert.
„Herr Krüger hat mit seiner Diplomarbeit (…) ein in jeder Hinsicht gewichtiges Werk zu einem wichtigen jüngeren Trend in der Stadtentwicklung und Stadtentwicklungspolitik vorgelegt. (…). Nicht nur vom Umfang her, sondern auch von der theoretischen Durchdringung und der sorgfältigen empirischen Arbeit rangiert die vorliegende Arbeit weit über sonst üblichen Diplomarbeiten. Besonders beeindruckend ist der eigenständige, sichere und kenntnisreiche Weg sowohl durch theoretische als auch durch methodologische, methodische und empirische Gefilde.“ (Erstprüfer am Institut für Geographie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster).
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemaufriss und Forschungsfragen
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Zur Epistemologie und dem zugrundeliegenden Raumverständnis
- 3. Der Regulationsansatz
- 3.1 Der Fordismus
- 3.2 Die Krise des Fordismus
- 3.3 Der Postfordismus
- 3.4 Das Potential des Regulationsansatzes für die Raumforschung und konzeptionell-methodologische Schwächen
- 4. Raumstrukturelle Konsequenzen postfordistischer Regulation
- 5. Ökonomisierung des Städtischen: Die Unternehmerische Stadt
- 5.1 Neue Herausforderungen von Stadtentwicklung unter postfordistischen Bedingungen
- 5.2 Strategien unternehmerischer Stadtentwicklung
- 5.3 Typische Merkmale unternehmerischer Stadtentwicklung
- 5.3.1 Institutionelle Restrukturierung und Governance
- 5.3.1.1 Binnenmodernisierung durch Einführung von New Public Management
- 5.3.1.2 Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen
- 5.3.2 Externe Ausrichtung auf Wettbewerb
- 5.3.2.1 Orientierung an einkommensstarken Bevölkerungsschichten und Schaffung symbolischen Kapitals
- 5.3.2.2 Kulturalisierung von Städten
- 5.3.2.3 Imageproduktion durch Stadtmarketing
- 5.3.3 Immobilienmarktgesteuerte Stadtentwicklung durch Großprojekte
- 5.3.3.1 Zur Rolle des Immobiliensektors in der Stadtentwicklung
- 5.3.3.2 Zunehmende Fokussierung auf Großprojekte
- 5.4 Die Folgen unternehmerischer Stadtentwicklung
- 5.5 Zusammenfassung: Ökonomisierung des Städtischen
- 6. Der Bedeutungsgewinn des Regionalen
- 6.1 Regionale Zusammenschlüsse und Metropolregionen
- 6.2 'Rescaling' als Element von Regulation
- 6.3 Regionalisierung als Antwort auf Globalisierung?
- 7. Diskurstheoretischer Exkurs: Zur Kritik an Standortvergleichen
- 7.1 Der Standortwettbewerb als Diskurs
- 7.2 Die Rolle von Städterankings im Standortdiskurs
- 8. Standortwettbewerb zwischen Sachzwang, politischer Intention und diskursiver Praxis
- 9. Zur Methodik der empirischen Untersuchung
- 9.1 Kennzeichen Qualitativer Sozialforschung
- 9.2 Das Experteninterview
- 9.2.1 Typologie des Experteninterviews
- 9.2.2 Dimensionen des Expertenbegriffs
- 9.2.3 Auswahl der befragten Experten
- 9.2.4 Durchführung der Interviews
- 9.2.5 Auswertung der Interviews
- 9.3 Der Umgang mit nonverbalen Daten
- 10. Der Raum Stuttgart
- 10.1 Wirtschaftliche Entwicklung, Strukturwandel und Krise
- 10.1.1 Industrielle Basis und Automobilcluster
- 10.1.2 Strukturwandel in den 1990er Jahren
- 10.1.3 Die neoliberale Antwort auf die jüngste Wirtschaftskrise
- 10.2 Bevölkerungsentwicklung in Stadt und Region
- 10.2.1 Suburbanisierung
- 10.2.2 Strategien und Programme gegen die Suburbanisierung
- 10.3 Sozialräumliche Segregation und Armut in Stuttgart
- 11. Die Ökonomisierung des Städtischen in Stuttgart
- 11.1 Institutionelle Restrukturierung und Governance
- 11.1.1 Haushaltskonsolidierung zu Lasten von Sozialpolitik
- 11.1.2 Privatisierung kommunaler Dienstleister
- 11.2 Externe Ausrichtung auf Wettbewerb
- 11.2.1 Investitionen in weiche Standortfaktoren
- 11.2.2 Kulturförderung
- 11.2.3 Imageproduktion durch Stadtmarketing und die Formulierung von Leitbildern
- 11.3 Großprojekte – Unter besonderer Berücksichtigung von S 21
- 11.4 Starke und schwache Strategien unternehmerischer Politik
- 11.5 Zwischenfazit: Die Ökonomisierung des Städtischen in Stuttgart
- 12. Regionalisierungstendenzen in der Region Stuttgart
- 12.1 Die Intraregionale Konkurrenz
- 12.2 Der Verband Region Stuttgart
- 12.3 Regionalisierung als Standortpolitik
- 13. Die Region Stuttgart im internationalen Standortwettbewerb
- 13.1 Exportausrichtung
- 13.2 Zur Popularität von Standortvergleichen
- 13.3 Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen und diskursive Verankerung des Bildes vom Standortwettbewerb
- 14. Deutungsmuster städtischer und regionaler Akteure in Stuttgart
- 14.1 Zur Deutung der Ökonomisierung des Städtischen
- 14.1.1 Der Rückzug aus dem Sozialen im Unternehmen Stuttgart
- 14.1.2 In Zielgruppen denken: Investitionen in weiche Standortfaktoren
- 14.1.3 'Image becomes everything'
- 14.1.4 Allheilmittel Großprojekt
- 14.1.5 Zur Bedeutung des Synergieprojekts S 21
- 14.1.5.1 Erreichbarkeit und Zentralität als Standortfaktoren
- 14.1.5.2 Wohnen und Wirtschaft als Standortfaktoren
- 14.1.5.3 Image und Prestige als Standortfaktoren
- 14.1.5.4 S 21 als Patentrezept im Wettbewerb
- 14.2 Zur Deutung des Bedeutungsanstieg des Regionalen
- 14.2.1 Intraregionale Konkurrenz
- 14.2.2 Kooperation auf regionaler Ebene - Differenzen in der Stadtverwaltung
- 14.2.3 Regionalbewusstsein: Die regionale Ebene ist die 'Gewinnerebene'
- 14.3 Zur Deutung des (internationalen) Standortwettbewerbes
- 14.3.1 'Wettbewerb ist immer gut'
- 14.3.2 Exportabhängigkeit und Krise im Kontext des Wettbewerbs
- 14.3.3 Die Starken stärken
- 14.3.4 Die Einschätzung der Konkurrenzsituation zu anderen (Stadt)Regionen
- 14.3.5 Infrastruktur als Nachteil
- 14.3.6 Zur Bedeutung von Standortrankings im Handeln städtischer und regionaler Akteure
- 14.3.7 Wettbewerb als Handlungsmaxime
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht den Bedeutungsanstieg des Regionalen und die Ökonomisierung des Städtischen als Ausdruck postfordistischer Regulation im Raum Stuttgart. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des internationalen Standortwettbewerbs zu erläutern und dessen Deutung durch städtische und regionale Akteure in Stuttgart zu analysieren.
- Postfordistische Regulation und ihre Auswirkungen auf Raumstrukturen
- Ökonomisierung des Städtischen und Strategien unternehmerischer Stadtentwicklung
- Bedeutung des Regionalen und die Entstehung von Metropolregionen
- Internationaler Standortwettbewerb und seine diskursive Verankerung
- Deutungsmuster städtischer und regionaler Akteure in Bezug auf Standortwettbewerb
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung Das Kapitel führt in die Forschungsfrage ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es stellt die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund der Megatrends Globalisierung und Demografie heraus.
- Kapitel 2: Zur Epistemologie und dem zugrundeliegenden Raumverständnis Dieses Kapitel erläutert das epistemologische Fundament der Arbeit und beleuchtet die zugrunde liegende Raumvorstellung.
- Kapitel 3: Der Regulationsansatz Das Kapitel beleuchtet den Regulationsansatz, dessen historische Entwicklung und seine Bedeutung für die Analyse postfordistischer Entwicklungen. Es werden die Phasen des Fordismus, die Krise des Fordismus und der Postfordismus beleuchtet.
- Kapitel 4: Raumstrukturelle Konsequenzen postfordistischer Regulation Das Kapitel untersucht die raumstrukturellen Auswirkungen postfordistischer Regulation und beschreibt die damit einhergehenden Veränderungen im Raum.
- Kapitel 5: Ökonomisierung des Städtischen: Die Unternehmerische Stadt Dieses Kapitel befasst sich mit der Ökonomisierung des Städtischen und den Strategien unternehmerischer Stadtentwicklung. Es analysiert die Herausforderungen und typischen Merkmale der unternehmerischen Stadtentwicklung, wie etwa die institutionelle Restrukturierung und Governance, die externe Ausrichtung auf Wettbewerb sowie die immobilienmarktgesteuerte Stadtentwicklung durch Großprojekte.
- Kapitel 6: Der Bedeutungsgewinn des Regionalen Das Kapitel untersucht den Bedeutungsanstieg des Regionalen und die Entstehung von regionalen Zusammenschlüssen und Metropolregionen. Es setzt sich mit dem 'Rescaling' als Element von Regulation und der Regionalisierung als Antwort auf die Globalisierung auseinander.
- Kapitel 7: Diskurstheoretischer Exkurs: Zur Kritik an Standortvergleichen Dieses Kapitel beleuchtet den Standortwettbewerb als Diskurs und analysiert die Rolle von Städterankings im Standortdiskurs.
- Kapitel 8: Standortwettbewerb zwischen Sachzwang, politischer Intention und diskursiver Praxis Das Kapitel untersucht den Standortwettbewerb als Ergebnis von Sachzwängen, politischen Intentionen und diskursiven Praxen.
- Kapitel 9: Zur Methodik der empirischen Untersuchung Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung und beleuchtet die Kennzeichen qualitativer Sozialforschung, die Anwendung des Experteninterviews sowie den Umgang mit nonverbalen Daten.
- Kapitel 10: Der Raum Stuttgart Das Kapitel beleuchtet die wirtschaftliche Entwicklung, den Strukturwandel und die Krise im Raum Stuttgart. Es betrachtet die Bevölkerungsentwicklung in Stadt und Region, die Suburbanisierung und die sozialräumliche Segregation.
- Kapitel 11: Die Ökonomisierung des Städtischen in Stuttgart Dieses Kapitel analysiert die Ökonomisierung des Städtischen in Stuttgart, einschließlich der institutionellen Restrukturierung und Governance, der externen Ausrichtung auf Wettbewerb sowie der Rolle von Großprojekten, insbesondere S 21.
- Kapitel 12: Regionalisierungstendenzen in der Region Stuttgart Das Kapitel untersucht die Regionalisierungstendenzen in der Region Stuttgart, darunter die intraregionale Konkurrenz, den Verband Region Stuttgart und die Regionalisierung als Standortpolitik.
- Kapitel 13: Die Region Stuttgart im internationalen Standortwettbewerb Dieses Kapitel befasst sich mit der Region Stuttgart im internationalen Standortwettbewerb, einschließlich ihrer Exportausrichtung, der Popularität von Standortvergleichen und den wirtschaftspolitischen Handlungsempfehlungen.
- Kapitel 14: Deutungsmuster städtischer und regionaler Akteure in Stuttgart Das Kapitel analysiert die Deutungsmuster städtischer und regionaler Akteure in Bezug auf die Ökonomisierung des Städtischen, den Bedeutungsanstieg des Regionalen und den internationalen Standortwettbewerb.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen postfordistische Regulation, Ökonomisierung des Städtischen, Bedeutungsanstieg des Regionalen, internationaler Standortwettbewerb und die Rolle städtischer und regionaler Akteure. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind: Unternehmerische Stadtentwicklung, Metropolregionen, Rescaling, Diskursanalyse, Experteninterviews und der Raum Stuttgart.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der „Ökonomisierung des Städtischen“?
Es beschreibt den Trend, lokale Politik und Stadtentwicklung verstärkt nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Wettbewerbslogiken auszurichten.
Welche Rolle spielt der internationale Standortwettbewerb für Stuttgart?
Stuttgart tritt als „Unternehmerische Stadt“ in Konkurrenz zu anderen Metropolregionen um Investitionen, Humankapital und Prestige.
Was ist postfordistische Regulation?
Ein theoretischer Ansatz, der den Wandel von der Massenproduktion (Fordismus) hin zu flexiblen, neoliberal geprägten Wirtschafts- und Raumstrukturen erklärt.
Welche Bedeutung hat das Großprojekt Stuttgart 21 in diesem Kontext?
Es wird als Synergieprojekt betrachtet, das Image, Erreichbarkeit und Zentralität als zentrale Standortfaktoren im Wettbewerb stärken soll.
Warum gewinnen regionale Zusammenschlüsse an Bedeutung?
Regionen werden als die eigentliche „Gewinnerebene“ im globalen Wettbewerb gesehen, was zu verstärkter Kooperation zwischen Städten und ihrem Umland führt.
- Citar trabajo
- Sebastian Krüger (Autor), 2012, Der Bedeutungsanstieg des Regionalen und die Ökonomisierung des Städtischen als Ausdruck postfordistischer Regulation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306233