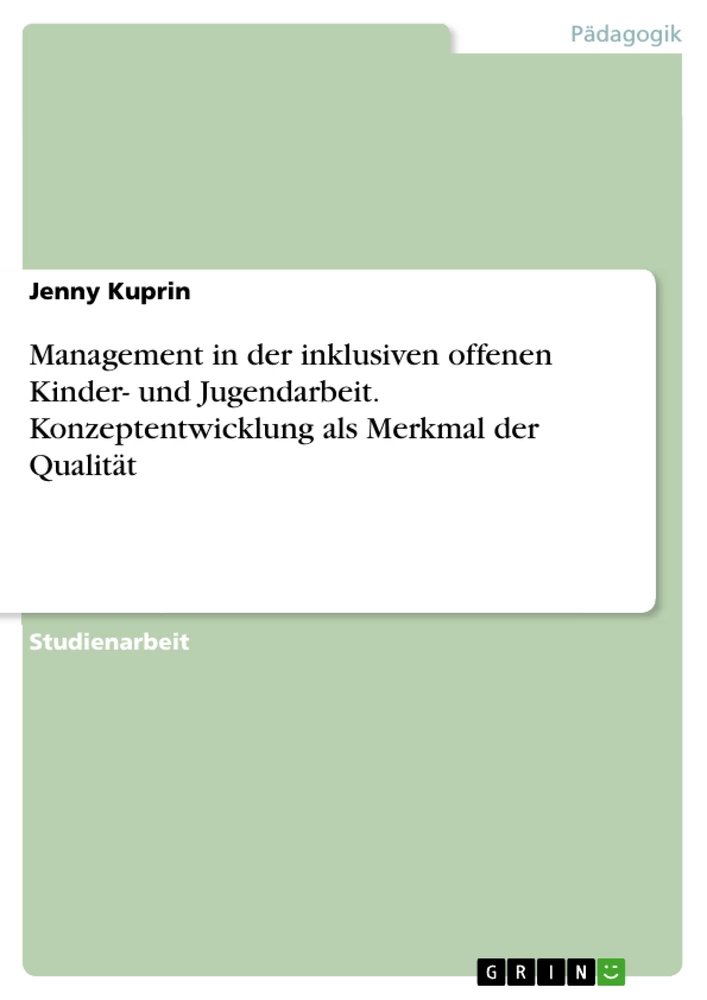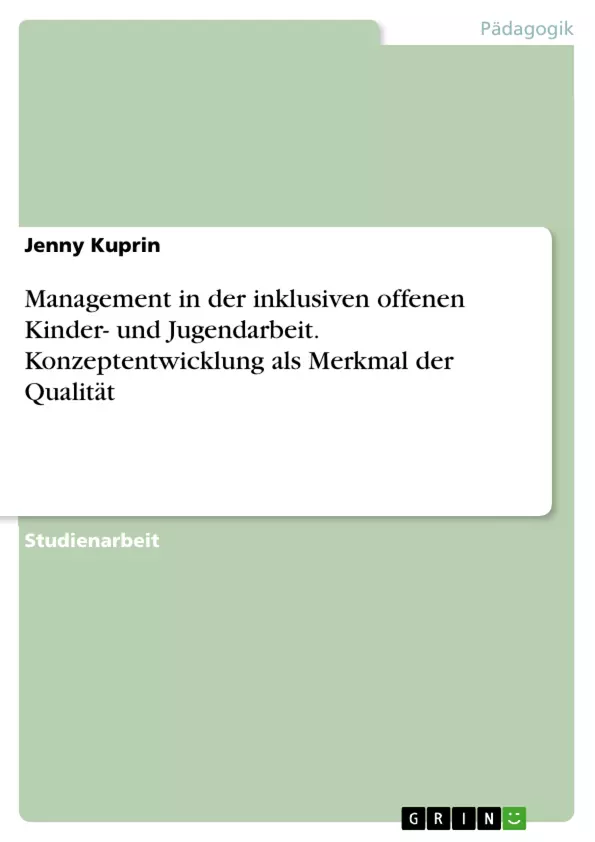Man hört viel über Inklusion im schulischen Bereich, wobei dieser Prozess natürlich auch im außerschulischen Bereich stattfinden soll. Aber wie setzt man das um? Was soll alles beachtet werden, um inklusive Arbeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu leisten? Was ist der Weg zur Inklusion in der Organisation?
Wie soll das Konzept in der inklusiven offenen Kinder- und Jugendarbeit von einer Leitungsperspektive heraus entwickelt bzw fortgeschrieben werden?.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt nicht auf einer standardisierten und konkreten Vorgehensweise bei der Konzeptentwicklung, sondern es soll vielmehr ein Blick aus der Leitungsperspektive und den damit verbundenen Fähigkeiten auf den Prozess der Konzeptentwicklung sein. Danach wird versucht, die Impulse für inklusive offene Kinder- und Jugendarbeit herauszubilden, die bei der Konzeptentwicklung zu beachten sind.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einführung
- Fragestellung
- Definitionen
- Management
- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Konzeptentwicklung
- Leitlinien
- Ziele und Ressourcen
- Evaluation
- Der Wegweiser zu inklusiver offener Kinder- und Jugendarbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten in der inklusiven offenen Kinder- und Jugendarbeit aus der Perspektive der Leitung. Ziel ist es, wichtige Impulse für inklusive Arbeit zu identifizieren und den Prozess der Konzeptentwicklung aus Leitungsperspektive zu beleuchten.
- Die Rolle der Leitung in der Konzeptentwicklung und -fortschreibung
- Wesentliche Faktoren für eine inklusive offene Kinder- und Jugendarbeit
- Die Bedeutung von Kommunikation, Teamfähigkeit und Mitbestimmung im Team
- Die Notwendigkeit einer ständigen Evaluation und Anpassung von Konzepten
- Die Herausforderungen bei der Umsetzung von Inklusion in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einführung: Die Arbeit stellt die Ausgangssituation dar, die zu der Fragestellung führt, wie Konzepte für inklusive offene Kinder- und Jugendarbeit entwickelt werden können.
- Fragestellung: Die Arbeit untersucht, wie das Konzept der inklusiven offenen Kinder- und Jugendarbeit aus Leitungsperspektive entwickelt und fortgeschrieben werden soll.
- Definitionen: Die Begriffe "Management" und "Offene Kinder- und Jugendarbeit" werden definiert und erläutert.
- Konzeptentwicklung: Das Kapitel behandelt die Bedeutung der Konzeptentwicklung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und beschreibt die wichtigen Elemente: Leitlinien, Ziele, Ressourcen und Evaluation.
- Der Wegweiser zu inklusiver offener Kinder- und Jugendarbeit: Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen bei der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Schlüsselwörter (Keywords)
Inklusion, offene Kinder- und Jugendarbeit, Konzeptentwicklung, Leitungsperspektive, Teamfähigkeit, Mitbestimmung, Evaluation, Zugangsbarrieren, Behinderung, Förderung, Partizipation, Lebensweltorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie setzt man Inklusion in der Jugendarbeit um?
Die Arbeit beschreibt den Weg zur Inklusion durch gezielte Konzeptentwicklung, den Abbau von Barrieren und eine inklusive Haltung der Leitung.
Welche Rolle hat die Leitung bei der Konzeptentwicklung?
Die Leitung muss den Prozess steuern, Ressourcen bereitstellen und Teamfähigkeit sowie Mitbestimmung (Partizipation) fördern.
Was sind die wichtigsten Elemente eines Konzepts?
Wesentliche Bestandteile sind klare Leitlinien, definierte Ziele, eine Analyse der Ressourcen und eine regelmäßige Evaluation.
Warum ist ständige Evaluation in der inklusiven Arbeit nötig?
Um sicherzustellen, dass das Konzept den Bedürfnissen der Jugendlichen entspricht und um auf neue Herausforderungen oder Barrieren flexibel reagieren zu können.
Was bedeutet Lebensweltorientierung in diesem Kontext?
Es bedeutet, dass die Angebote der Jugendarbeit direkt an der sozialen Realität und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen anknüpfen müssen.
- Arbeit zitieren
- Bachelor Jenny Kuprin (Autor:in), 2015, Management in der inklusiven offenen Kinder- und Jugendarbeit. Konzeptentwicklung als Merkmal der Qualität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306255