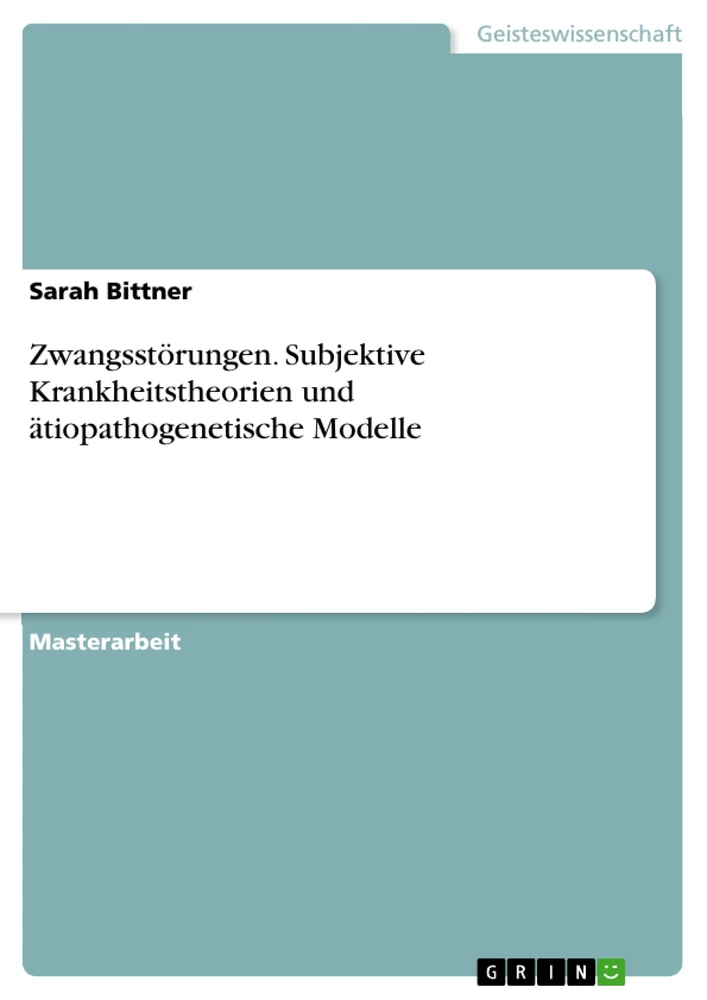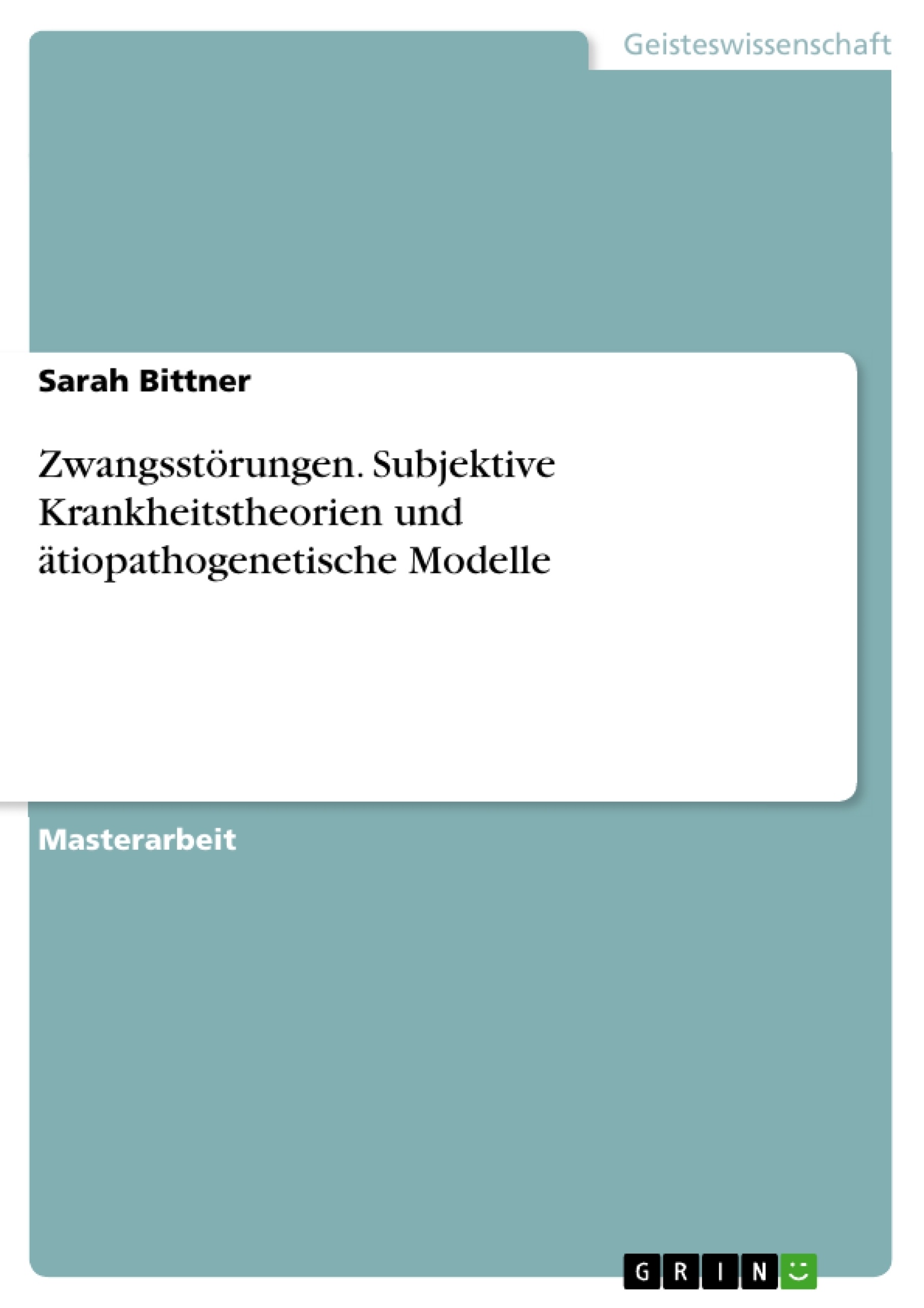Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit ätiopathogenetischen Modellen und subjektiven Krankheitstheorien der Zwangsstörung. In Bezug auf diese Thematik soll herausgefunden werden, welche Parallelen sowie Differenzen zwischen den wissenschaftlich fundierten Ursachenmodellen und den subjektiven Krankheitseinschätzungen vorliegen. Im Hinblick auf diese Zielstellung schließt sich in Folge eines theoretischen Überblickes, hinsichtlich des Krankheitsbildes der Zwangserkrankung sowie angesichts der Erläuterung von spezifischen Entstehungsmodellen, eine empirische Untersuchung an. Diese stützt sich auf ein qualitatives Vorgehen, indem mit Hilfe von leitfadengestützten ExpertInneninterviews Erkenntnisse für die Beantwortung der Forschungsfrage erlangt werden sollen. Im Anschluss an die Interviewauswertungen erfolgt eine Bezugnahme von den subjektiven Einschätzungen zu den wissenschaftlichen Theorien. Als Ergebnisse dieser Betrachtungen lassen sich überwiegend Parallelen jedoch ebenso vereinzelte Differenzen feststellen. Die sichtbaren Unterschiede oder auch Ergänzungen dienen als Verbesserungsvorschläge beziehungsweise Hinweise für zukünftige Forschungsaktivitäten sowie im Hinblick auf bestimmte Praxisfelder welche eine Verbindung zu Zwangsstörungen aufweisen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Merkmale einer Zwangsstörung
- 2.1 Begrifflichkeit
- 2.2 Epidemiologische Aspekte
- 3 Symptomatik der Zwangsstörung
- 3.1 Zwangshandlungen
- 3.2 Zwangsgedanken
- 3.3 Zusammenhänge zwischen Zwangshandlungen und Zwangsgedanken
- 4 Ätiopathogenetische Modelle der Zwangsstörung
- 4.1 Auswirkungen kritischer Lebensereignisse und veränderter Lebensumstände
- 4.2 Genetische Einflussfaktoren
- 4.3 Einflüsse des Erziehungsstils
- 4.4 Einflüsse aus der Biochemie und Neurobiologie
- 4.5 Einflüsse aus der Persönlichkeit
- 4.6 Lerntheoretische und kognitive Störungsmodelle
- 4.6.1 Zwei-Faktoren-Modell nach Mowrer
- 4.6.2 Kritik und Ergänzungen des Zwei-Faktoren-Modells
- 4.6.3 Kognitives Störungsmodell
- 4.7 Psychoanalytisches Entstehungsmodell der Zwangsstörung
- 5 Subjektive Krankheitstheorien
- 6 Empirische Untersuchung
- 6.1 Qualitatives Forschungsdesign
- 6.2 Datenerhebung: Zur Methode des leitfadengestützten ExpertInnen-interviews
- 6.3 Datenaufbereitung
- 6.4 Datenauswertung
- 6.4.1 Anwendung der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
- 6.4.2 Ausprägungen der erstellten Kategorien
- 6.5 Ergebnisse der Auswertung
- 6.5.1 Hinweise zu den befragten Expertinnen
- 6.5.2 Interview 1 (Frau Meier)
- 6.5.3 Interpretation des Interviews- Fallportrait Frau Meier
- 6.5.4 Interview 2 (Luisa)
- 6.5.5 Interpretation des Interviews- Fallportrait Luisa
- 6.5.6 Interview 3 (Frau Schmitt)
- 6.5.7 Interpretation des Interviews Fallportrait Frau Schmitt
- 6.5.8 Interview 4 (Frau Arnold)
- 6.5.9 Interpretation des Interviews- Fallportrait Frau Arnold
- 6.6 Bezugnahme zu den ätiopathogenetischen Modellen
- 6.7 Ausblick
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen wissenschaftlich fundierten Ätiopathogenese-Modellen von Zwangsstörungen und den subjektiven Krankheitstheorien von Betroffenen. Ziel ist es, Parallelen und Diskrepanzen aufzuzeigen und daraus Schlussfolgerungen für die Therapie und zukünftige Forschung abzuleiten.
- Subjektive Krankheitstheorien von Zwangsstörungen
- Wissenschaftliche Ätiopathogenese-Modelle von Zwangsstörungen
- Vergleich der subjektiven und wissenschaftlichen Perspektiven
- Implikationen für Therapie und Forschung
- Qualitative Untersuchung mittels ExpertInneninterviews
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Zwangsstörungen ein und differenziert zwischen alltäglichen Zwängen und krankheitswertigen Zwangsstörungen. Sie hebt die Bedeutung der Klärung der Ursachen sowohl für Betroffene als auch für Angehörige hervor und betont das Fehlen eines einheitlichen Erklärungsmodells. Die Arbeit fokussiert auf den Vergleich zwischen wissenschaftlichen und subjektiven Ursachenzuschreibungen und deren Implikationen für Therapie und Forschung.
2 Merkmale einer Zwangsstörung: Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale einer Zwangsstörung, inklusive Begriffsbestimmungen und epidemiologischer Aspekte. Es legt den Grundstein für das Verständnis der Störung und ihrer Verbreitung in der Bevölkerung. Die präzise Definition der Störung ist entscheidend für die weitere Analyse der ätiopathogenetischen Modelle und subjektiven Theorien.
3 Symptomatik der Zwangsstörung: Hier werden die Kernsymptome der Zwangsstörung, nämlich Zwangshandlungen und Zwangsgedanken, detailliert erläutert. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der jeweiligen Symptomatik und den Zusammenhängen zwischen beiden. Diese detaillierte Beschreibung der Symptomatik ist notwendig, um die späteren Analysen der Ursachen und der subjektiven Theorien zu kontextualisieren.
4 Ätiopathogenetische Modelle der Zwangsstörung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene wissenschaftliche Erklärungsmodelle für die Entstehung von Zwangsstörungen. Es beleuchtet biologische (genetische, biochemische, neurobiologische), psychologische (Lerntheorien, kognitive Modelle, psychoanalytische Modelle) und soziale (Einflussfaktoren des Erziehungsstils, kritischer Lebensereignisse) Faktoren. Die Darstellung der verschiedenen Modelle dient als Grundlage für den Vergleich mit den subjektiven Theorien der Betroffenen.
5 Subjektive Krankheitstheorien: Dieses Kapitel stellt die subjektiven Perspektiven von Menschen mit Zwangsstörungen auf die Ursachen ihrer Erkrankung in den Mittelpunkt. Es ist von großer Bedeutung für das Verständnis der individuellen Erfahrungen und der Bedeutung der eigenen Interpretation der Erkrankung.
6 Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte qualitative Studie mit leitfadengestützten ExpertInneninterviews. Es erläutert das Forschungsdesign, die Datenerhebung und -auswertung, die Ergebnisse der Interviews und deren Interpretation. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Übereinstimmung und Abweichung mit den in Kapitel 4 vorgestellten wissenschaftlichen Modellen analysiert. Der Fokus liegt hier auf der Methodik und den Ergebnissen der empirischen Untersuchung, um die subjektiven Krankheitstheorien zu belegen.
Schlüsselwörter
Zwangsstörung, Ätiopathogenese, Subjektive Krankheitstheorien, Qualitative Forschung, ExpertInneninterviews, Zwangshandlungen, Zwangsgedanken, Lerntheorie, Kognitive Modelle, Biologische Faktoren, Psychoanalytische Modelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Untersuchung der Übereinstimmung zwischen wissenschaftlich fundierten Ätiopathogenese-Modellen von Zwangsstörungen und den subjektiven Krankheitstheorien von Betroffenen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen wissenschaftlich fundierten Ätiopathogenese-Modellen von Zwangsstörungen und den subjektiven Krankheitstheorien von Betroffenen. Ziel ist es, Parallelen und Diskrepanzen aufzuzeigen und daraus Schlussfolgerungen für die Therapie und zukünftige Forschung abzuleiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Subjektive Krankheitstheorien von Zwangsstörungen, wissenschaftliche Ätiopathogenese-Modelle von Zwangsstörungen, Vergleich der subjektiven und wissenschaftlichen Perspektiven, Implikationen für Therapie und Forschung sowie eine qualitative Untersuchung mittels ExpertInneninterviews.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Merkmale einer Zwangsstörung, Symptomatik der Zwangsstörung, Ätiopathogenetische Modelle der Zwangsstörung, Subjektive Krankheitstheorien, Empirische Untersuchung und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Zwangsstörung, von der Definition und Symptomatik über verschiedene Erklärungsmodelle bis hin zur empirischen Untersuchung subjektiver Krankheitstheorien.
Wie wird die Symptomatik der Zwangsstörung beschrieben?
Kapitel 3 beschreibt detailliert die Kernsymptome der Zwangsstörung: Zwangshandlungen und Zwangsgedanken. Es beleuchtet die jeweilige Symptomatik und die Zusammenhänge zwischen beiden, um die Analyse der Ursachen und subjektiven Theorien zu kontextualisieren.
Welche ätiopathogenetischen Modelle werden betrachtet?
Kapitel 4 bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene wissenschaftliche Erklärungsmodelle für Zwangsstörungen. Es werden biologische (genetische, biochemische, neurobiologische), psychologische (Lerntheorien, kognitive Modelle, psychoanalytische Modelle) und soziale (Einflussfaktoren des Erziehungsstils, kritischer Lebensereignisse) Faktoren beleuchtet. Diese dienen als Grundlage für den Vergleich mit subjektiven Theorien.
Wie werden die subjektiven Krankheitstheorien untersucht?
Kapitel 5 konzentriert sich auf die subjektiven Perspektiven von Menschen mit Zwangsstörungen auf die Ursachen ihrer Erkrankung. Kapitel 6 beschreibt die durchgeführte qualitative Studie mit leitfadengestützten ExpertInneninterviews, die Methodik, die Datenerhebung und -auswertung, die Ergebnisse und deren Interpretation im Vergleich zu den wissenschaftlichen Modellen.
Welche Methode wurde in der empirischen Untersuchung angewendet?
In der empirischen Untersuchung (Kapitel 6) wurde ein qualitatives Forschungsdesign mit leitfadengestützten ExpertInneninterviews verwendet. Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit mehreren Expertinnen, deren Interpretation und den Bezug zu den ätiopathogenetischen Modellen. Es werden Fallportraits vorgestellt und die Übereinstimmung und Abweichung mit den wissenschaftlichen Modellen analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zwangsstörung, Ätiopathogenese, Subjektive Krankheitstheorien, Qualitative Forschung, ExpertInneninterviews, Zwangshandlungen, Zwangsgedanken, Lerntheorie, Kognitive Modelle, Biologische Faktoren, Psychoanalytische Modelle.
- Arbeit zitieren
- Sarah Bittner (Autor:in), 2015, Zwangsstörungen. Subjektive Krankheitstheorien und ätiopathogenetische Modelle, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306457