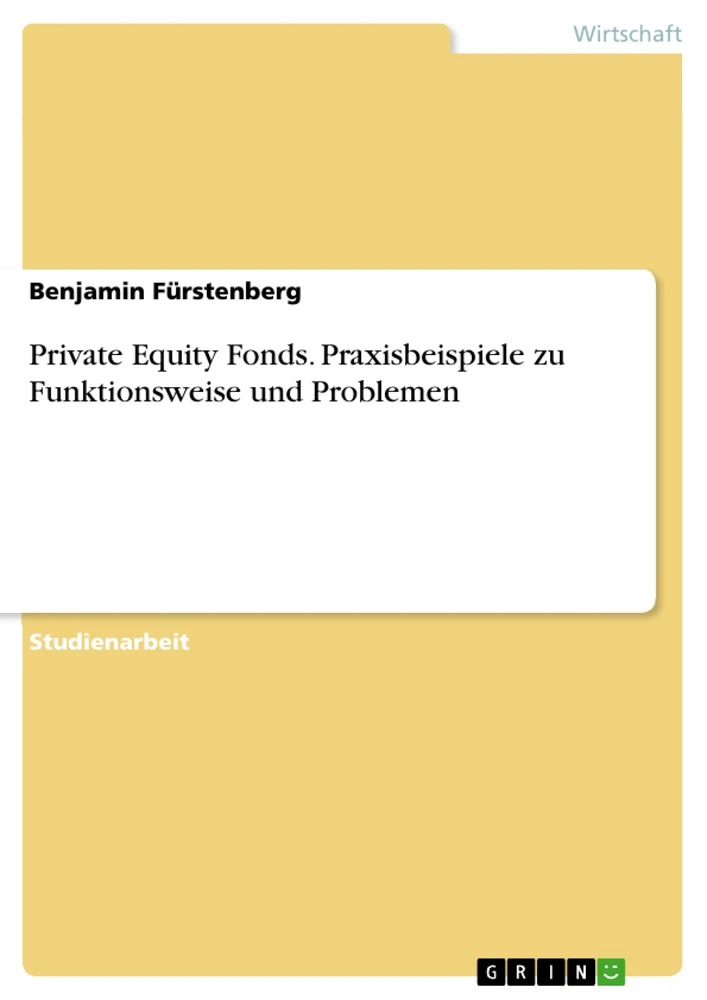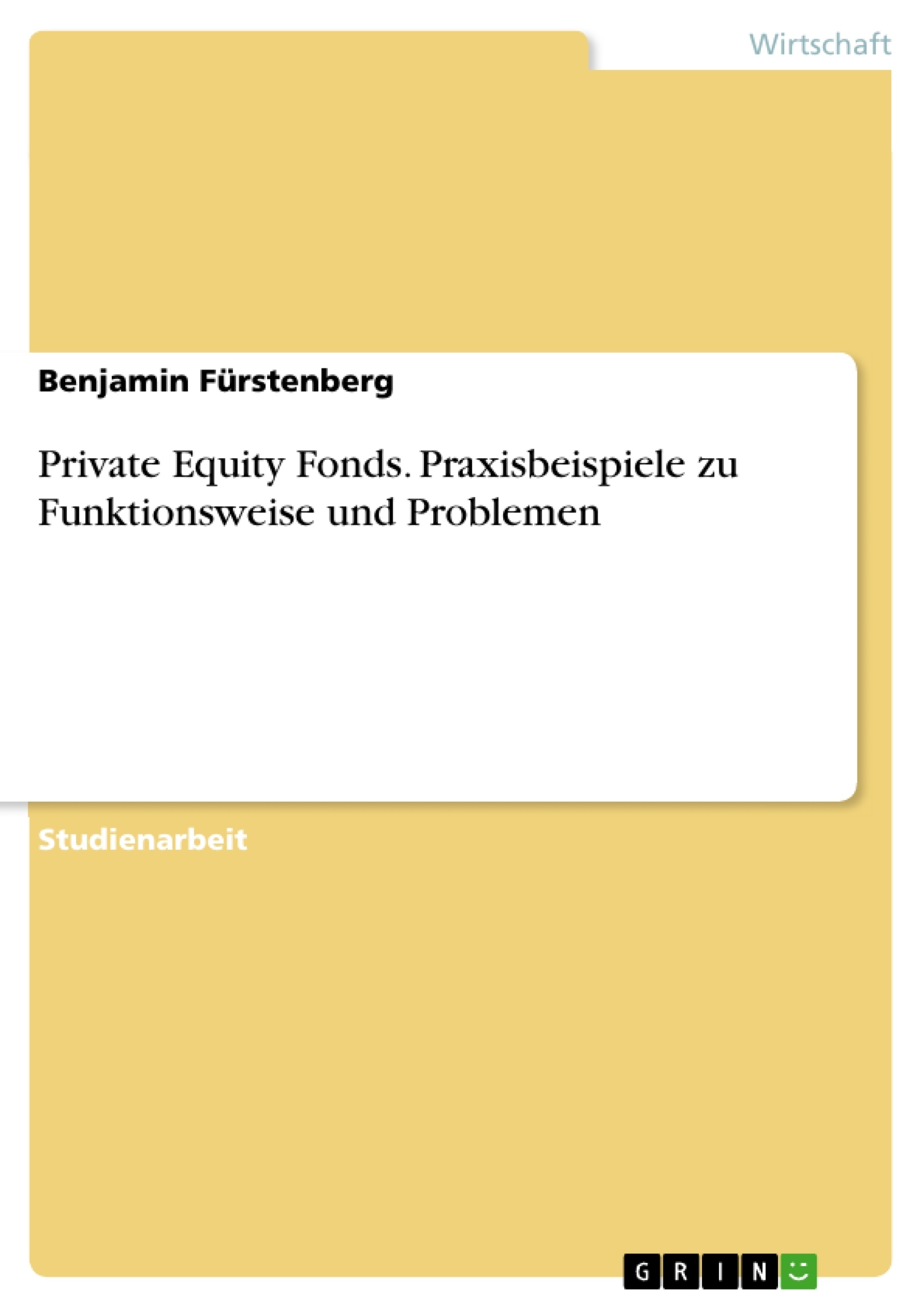Diese Seminararbeit soll die Abgrenzung zwischen Private Equity und Private Equity Fonds aufzeigen, und erläutern, wie Private Equity Fonds funktionieren und worin deren Probleme liegen. Dies soll anhand von theoretischem Wissen und aktuellen Beispielen belegt werden.
Fällt der Begriff „Private Equity“, denkt man unweigerlich an die Aussage des ehemaligen SPD-Chefs Franz Müntefering. Dieser bezeichnete, in einer Rede Mitte April 2005, Private Equity Gesellschaften als: “Heuschreckenschwärme“, welche über Unternehmen herfallen, sie abgrasen und dann weiterziehen.
Unter anderem richtete sich Münteferings Kritik gegen Kohlberg Kravis Roberts & Co. und Goldman Sachs. Diese hatten 1999 Siemens-Nixdorf übernommen und fünf Jahre später an die Börse gebracht. Siemens-Nixdorf erhielt aus dem Erlös in Höhe von 350 Millionen Euro aber nur 125 Millionen. Die restlichen 225 Millionen flossen Kohlberg Kravis Roberts & Co. und Goldman Sachs zu. Negativbeispiele, wie das von Siemens-Nixdorf, gibt es noch viele. Aber es gibt nicht nur „Heuschrecken“.
Positive Beispiele für Private Equity sind die Fielmann AG und die Kamps AG. Fielmann konnte durch eine Private Equity Beteiligung ins Ausland expandieren und die Kamps AG konnte 1996 ihr Unternehmen, das sie zuvor an eine amerikanische Lebensmittelkette verkauft hatte, zurückkaufen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung: Private Equity und Private Equity Fonds
- 2.1 Grundstruktur von Private Equity Fonds
- 2.1.1 Lebenszyklus eines Private Equity Fonds
- 2.2 Eigentümerstruktur/Gesellschaftliche Struktur in Private Equity Fonds
- 2.3 Wesentliche Vertragsverhältnisse in Private Equity Fonds
- 2.4 Verschiedene Formen von Private Equity Fonds
- 2.4.1 Dachfonds
- 2.4.2 Feederfonds
- 2.1 Grundstruktur von Private Equity Fonds
- 3. Risiken von Private Equity Fonds
- 3.1 Konjunkturrisiko
- 3.2 Auswahlrisiko
- 4. Vor- und Nachteile von Private Equity Fonds
- 4.1 Vorteile von Private Equity Fonds
- 4.2 Nachteile von Private Equity Fonds
- 5. Beispiele aus der Praxis anhand von Grohe und Heinz
- 5.1 Grohe
- 5.2 Heinz
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, Private Equity und Private Equity Fonds voneinander abzugrenzen und deren Funktionsweise sowie Problematiken darzustellen. Die Arbeit stützt sich auf theoretisches Wissen und aktuelle Praxisbeispiele.
- Abgrenzung von Private Equity und Private Equity Fonds
- Funktionsweise von Private Equity Fonds
- Risiken im Zusammenhang mit Private Equity Fonds
- Vor- und Nachteile von Private Equity Fonds
- Praxisbeispiele zur Veranschaulichung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Private Equity ein und widerlegt das gängige Bild von Private Equity Gesellschaften als "Heuschrecken", indem sie sowohl negative als auch positive Beispiele aus der Praxis nennt (Siemens-Nixdorf im Vergleich zu Fielmann und Kamps AG). Sie beschreibt den Höhepunkt und die anschließende Stagnation der Branche und kündigt die Zielsetzung der Arbeit an: die Funktionsweise und die Probleme von Private Equity Fonds zu erläutern.
2. Begriffsbestimmung: Private Equity und Private Equity Fonds: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Private Equity" als zeitlich begrenzte Beteiligung am Eigenkapital nicht-börsennotierter Unternehmen mit dem Ziel der Wertsteigerung. Es differenziert zwischen Private Equity, das oft in einzelne Unternehmen investiert, und Private Equity Fonds, die als Kapitalsammelstellen fungieren und das Geld in mehrere Beteiligungen investieren, um das Risiko zu streuen. Der Fokus der Fonds liegt auf der Renditemaximierung.
Schlüsselwörter
Private Equity, Private Equity Fonds, Funktionsweise, Risiken, Vorteile, Nachteile, Praxisbeispiele, Wertsteigerung, Rendite, Beteiligungsgesellschaften, Risikostreuung, Investmentbanken.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Private Equity und Private Equity Fonds
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über Private Equity und Private Equity Fonds. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Arbeit behandelt die Abgrenzung von Private Equity und Private Equity Fonds, deren Funktionsweise, die damit verbundenen Risiken und Vor- und Nachteile. Praxisbeispiele von Grohe und Heinz veranschaulichen die behandelten Konzepte.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Seminararbeit deckt folgende Themen ab: Begriffsbestimmung von Private Equity und Private Equity Fonds (inkl. Struktur, Vertragsverhältnisse und verschiedenen Fondsformen wie Dach- und Feederfonds), Risiken (Konjunktur- und Auswahlrisiko), Vor- und Nachteile von Private Equity Fonds, sowie Praxisbeispiele (Grohe und Heinz). Die Arbeit beleuchtet auch den Lebenszyklus eines Private Equity Fonds und die Eigentümerstruktur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, Private Equity und Private Equity Fonds voneinander abzugrenzen und deren Funktionsweise sowie Problematiken darzustellen. Sie kombiniert theoretisches Wissen mit aktuellen Praxisbeispielen, um ein umfassendes Verständnis zu vermitteln.
Welche Risiken werden im Zusammenhang mit Private Equity Fonds behandelt?
Die Arbeit beschreibt insbesondere das Konjunkturrisiko und das Auswahlrisiko im Zusammenhang mit Private Equity Fonds.
Welche Praxisbeispiele werden in der Seminararbeit verwendet?
Die Seminararbeit verwendet die Unternehmen Grohe und Heinz als Praxisbeispiele, um die behandelten Konzepte zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Private Equity, Private Equity Fonds, Funktionsweise, Risiken, Vorteile, Nachteile, Praxisbeispiele, Wertsteigerung, Rendite, Beteiligungsgesellschaften, Risikostreuung, Investmentbanken.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von der Begriffsbestimmung von Private Equity und Private Equity Fonds, einer Betrachtung der Risiken und Vor- und Nachteile, Praxisbeispielen und einem Fazit. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Wie werden Private Equity und Private Equity Fonds in der Arbeit unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet Private Equity als zeitlich begrenzte Beteiligung am Eigenkapital nicht-börsennotierter Unternehmen mit dem Ziel der Wertsteigerung von Private Equity Fonds, die als Kapitalsammelstellen fungieren und das Geld in mehrere Beteiligungen investieren, um das Risiko zu streuen. Der Fokus der Fonds liegt auf der Renditemaximierung.
- Citar trabajo
- Benjamin Fürstenberg (Autor), 2014, Private Equity Fonds. Praxisbeispiele zu Funktionsweise und Problemen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306513