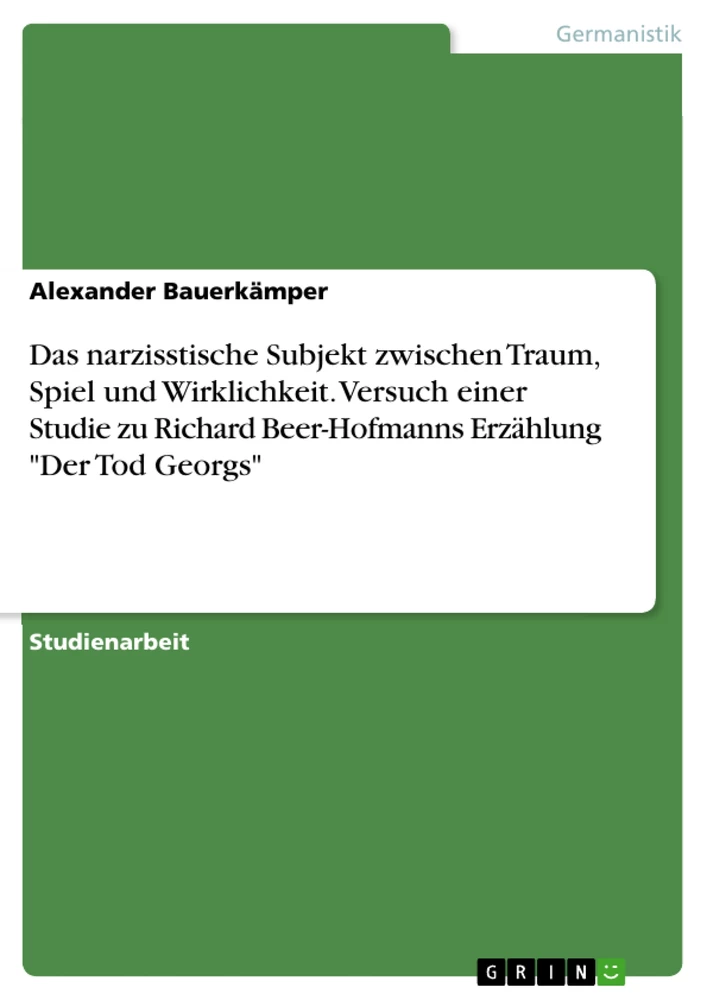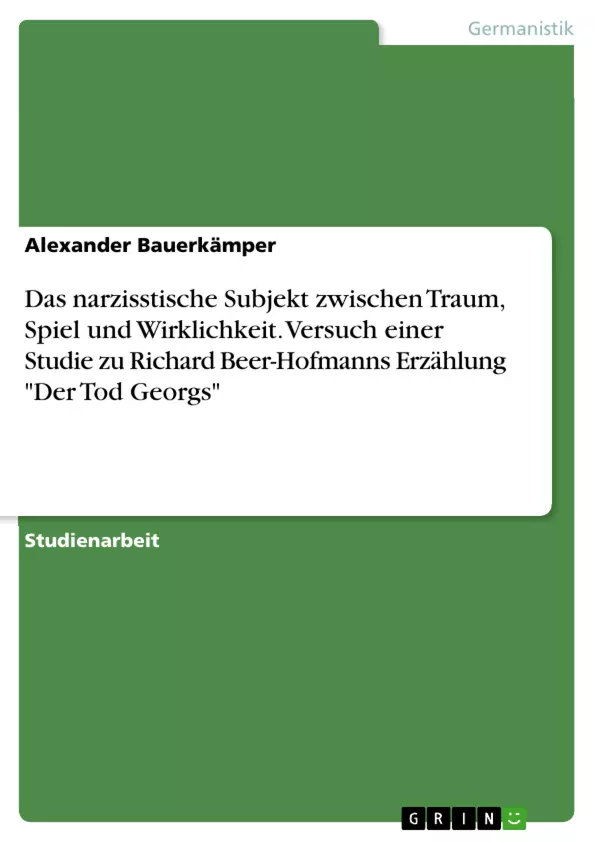Mit dieser Arbeit will ich zunächst herausfinden, welcher Art der Narzissmus des Protagonisten im "Tod Georgs" ist und wie dieser auf die äußere, ihn irritierende Welt reagiert. Anschließend werde ich auf die Form und Funktion des Traums in Bezug auf Pauls vermeintliche innere Wandlung eingehen. Abschließend soll versucht werden, die Frage nach der Entwicklungsfähigkeit dieses Narzissten auf Basis der zuvor gemachten Erkenntnisse zu beantworten.
Ende der 1890er-Jahre verfasste Richard Beer-Hofmann eine Erzählung, deren Ausgang bei vielen Lesern Zweifel an der Echtheit der dort beschriebenen Metamorphose hervorruft: Wir lernen Paul, den Protagonisten der 1900 erschienen Erzählung "Der Tod Georgs", als einen Ästheten kennen, der die Welt und die Menschen nur als Spiegelfläche seiner eigenen Empfindungen wahrnimmt und der aufgrund der Erschütterung seiner narzisstischen Identität mehr oder weniger bewusst „nach einer Lösung für seinen defizitären Realitätsbezug sucht“ (HEUSER 2010: 67). Schlussendlich scheint er diese in der Besinnung auf seinen jüdischen Ursprung zu finden.
Wie und ob Paul seinen Narzissmus am Ende der Erzählung überwindet oder noch überwinden wird, ist in der Forschung umstritten. Ich will in dieser Arbeit die Annahme in Zweifel ziehen, dass Paul eine „Wiedergeburt“ (SOKEL 1988: 8) erfährt und „daß Beer-Hofmanns Produktion auf ein Überwindung der Einsamkeit schließen läßt“ (ELSTUN 1986: 179; Hervorh. im Orig.). Ich möchte dabei nicht auf historisch-biographische Aspekte oder Aussagen des Autors zurückgreifen, um meinen Standpunkt zu vertreten. Denn bereits eine Analyse der innerhalb des Textes liegenden Strukturen inhaltlicher wie formaler Art können zeigen, ob eine tatsächliche Abkehr von der narzisstischen Lebensform Pauls stattfindet bzw. stattfinden kann . Es soll damit dazu beigetragen werden, den Text als solchen besser zu verstehen und zu würdigen, dass er sich von der Autorintention und seiner Historizität zu emanzipieren vermag .
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das narzisstische Subjekt und die äußere Wirklichkeit
- 3 Form und Funktion des Traums
- 3.1 Traum als „Spielplatz“ des narzisstischen Bewusstseins
- 3.2 Traum als Ort des offenbarten Unbewussten
- 3.3 Zur Funktion der Tempelszene
- 4 Zur Frage der Entwicklungsfähigkeit des Narzissten
- 4.1 Die Zugfahrt (Kapitel III)
- 4.2 Der Spaziergang im Park (Kapitel IV)
- 4.3 Der Schluss
- 5 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Narzissmus des Protagonisten Paul in Richard Beer-Hofmanns Erzählung „Der Tod Georgs“ und hinterfragt die gängige Interpretation seiner vermeintlichen Wandlung. Der Fokus liegt auf einer textimmanenten Analyse der inhaltlichen und formalen Strukturen, um die Frage nach der Entwicklungsfähigkeit des narzisstischen Subjekts zu beantworten, ohne auf biographische Aspekte zurückzugreifen.
- Analyse des narzisstischen Subjekts und seiner Interaktion mit der Außenwelt
- Untersuchung der Form und Funktion des Traums als Spiegel des narzisstischen Bewusstseins
- Beurteilung der Entwicklungsfähigkeit des Protagonisten
- Erörterung der Erzähltechnik und deren Bedeutung für die Darstellung des inneren Erlebens
- Hinterfragung der Interpretation von Pauls vermeintlicher „Wiedergeburt“
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Erzählung „Der Tod Georgs“ ein und stellt die Forschungsfrage nach der tatsächlichen Überwindung des Narzissmus durch den Protagonisten Paul in den Mittelpunkt. Sie kritisiert vereinfachende Interpretationen, die von einer „Wiedergeburt“ Pauls ausgehen und kündigt eine textimmanente Analyse an, die die formalen und inhaltlichen Strukturen des Textes untersucht, um die Frage nach der Entwicklungsfähigkeit des narzisstischen Subjekts zu beantworten. Die Arbeit betont die Bedeutung des Textes an sich, unabhängig von Autorintention und historischem Kontext.
2 Das narzisstische Subjekt und die äußere Wirklichkeit: Dieses Kapitel analysiert die narzisstische Perspektive Pauls und seine Interaktion mit der Außenwelt. Es wird argumentiert, dass Pauls Ästhetentum eng mit seinem Narzissmus verbunden ist. Das Kapitel beschreibt den anfänglichen „Ist-Zustand“ von Pauls narzisstischem Bewusstsein und die allmähliche Konfrontation mit irritierenden Erfahrungen, die ihn zur Auseinandersetzung mit seiner eigenen Positionierung in der Welt zwingen. Die Darstellung der Erzähltechnik, insbesondere der erlebten Rede und des inneren Monologs, wird als Mittel zur direkten Präsentation von Pauls innerem Erleben und seiner Ich-Fixierung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Narzissmus, Ästhetizismus, Richard Beer-Hofmann, Der Tod Georgs, Textimmanente Analyse, Traum, Erzähltechnik, Entwicklungsfähigkeit, Selbstliebe, Egozentrizität, Identität.
Häufig gestellte Fragen zu Richard Beer-Hofmanns "Der Tod Georgs"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Narzissmus des Protagonisten Paul in Richard Beer-Hofmanns Erzählung "Der Tod Georgs". Sie hinterfragt gängige Interpretationen seiner vermeintlichen Wandlung und konzentriert sich auf eine textimmanente Analyse der inhaltlichen und formalen Strukturen, um die Frage nach Pauls Entwicklungsfähigkeit zu beantworten, ohne biographische Aspekte zu berücksichtigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den narzisstischen Protagonisten und seine Interaktion mit der Außenwelt, analysiert Form und Funktion von Träumen als Spiegel seines Bewusstseins, beurteilt seine Entwicklungsfähigkeit, erörtert die Erzähltechnik und hinterfragt die Interpretation von Pauls vermeintlicher "Wiedergeburt". Besonderes Augenmerk liegt auf dem Verhältnis von Pauls Ästhetentum und seinem Narzissmus.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse ist strikt textimmanent. Das bedeutet, dass die Interpretation ausschließlich auf dem Text selbst basiert und weder Autorintention noch historischer Kontext herangezogen werden. Die Arbeit untersucht die inhaltlichen und formalen Strukturen des Textes, wie z.B. erlebte Rede und inneren Monolog, um Pauls inneres Erleben und seine Ich-Fixierung darzustellen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das narzisstische Subjekt und die äußere Wirklichkeit, ein Kapitel über Form und Funktion des Traums (inkl. Unterkapiteln zur Traumdeutung und der Tempelszene), ein Kapitel zur Entwicklungsfähigkeit des Narzissten (mit Analysen spezifischer Kapitelabschnitte der Erzählung), und eine Schlussbemerkung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Narzissmus, Ästhetizismus, Richard Beer-Hofmann, Der Tod Georgs, Textimmanente Analyse, Traum, Erzähltechnik, Entwicklungsfähigkeit, Selbstliebe, Egozentrizität, Identität.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist eine Entwicklung oder Überwindung des Narzissmus bei dem Protagonisten Paul in "Der Tod Georgs" tatsächlich nachweisbar? Die Arbeit kritisiert vereinfachende Interpretationen, die von einer "Wiedergeburt" Pauls sprechen.
Wie wird die "Wiedergeburt" Pauls bewertet?
Die Arbeit hinterfragt die gängige Interpretation von Pauls vermeintlicher "Wiedergeburt". Sie untersucht kritisch, ob die im Text dargestellten Entwicklungen tatsächlich eine Überwindung seines Narzissmus belegen oder andere Interpretationen zulassen.
Welche Rolle spielt der Traum in der Analyse?
Der Traum wird als wichtiger Spiegel des narzisstischen Bewusstseins analysiert. Die Arbeit untersucht die Funktion und Form der Träume im Text und ihre Bedeutung für das Verständnis von Pauls innerem Zustand und seiner Entwicklung (oder Nicht-Entwicklung).
- Arbeit zitieren
- Alexander Bauerkämper (Autor:in), 2012, Das narzisstische Subjekt zwischen Traum, Spiel und Wirklichkeit. Versuch einer Studie zu Richard Beer-Hofmanns Erzählung "Der Tod Georgs", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306694