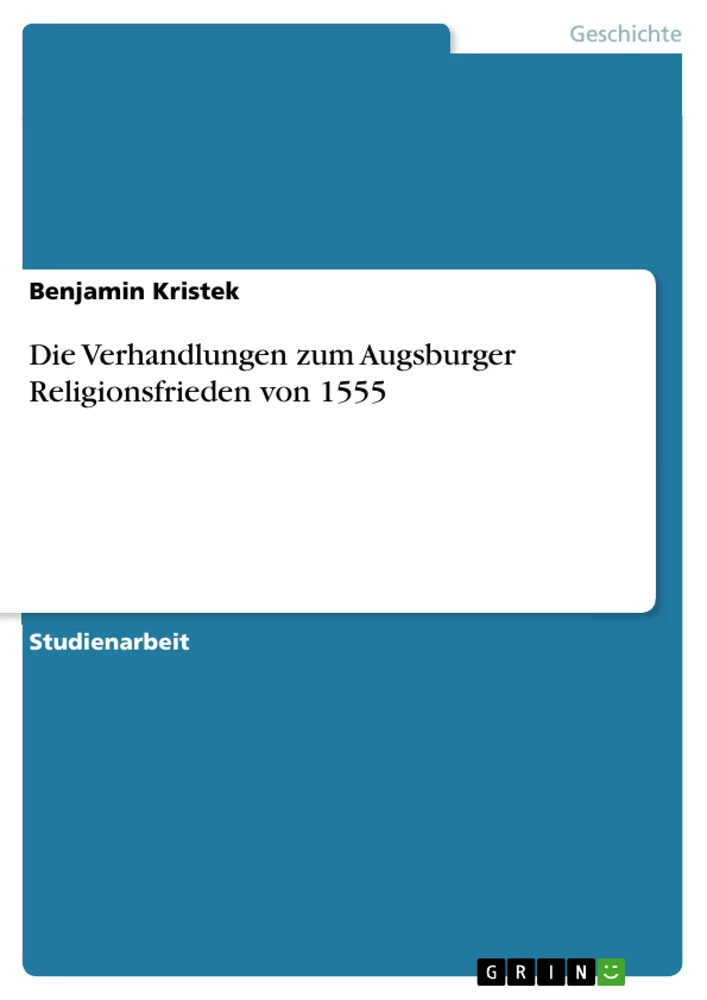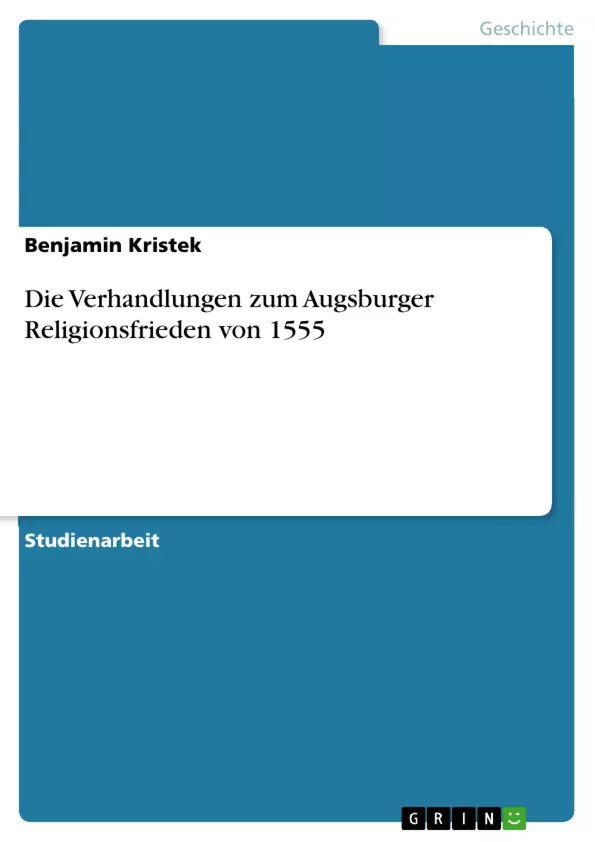Der Religionsfriede von 1555 gehört mit zu den richtungsweisenden und folgenreichsten Ereignissen des Übergangs vom Mittelalter zur frühen Neuzeit. Mit der reichsrechtlichen Anerkennung der durch die Reformation entstandenen beiden großen Konfessionen erfolgte zwar kein Ausgleich im Glaubensstreit, dafür aber eine rein weltlich-juristische Friedensordnung. Die traditionelle Bindung von Kaiser und Reich an die katholische Kirche zerfiel zusehends. Die ,,religiöse Neutralität des neuzeitlichen Staates"1 hat hier seinen Anfang genommen.
Der erste Teil dieser Arbeit hat die Aufgabe die Reichtagspolitik skizzenhaft zu umreißen, um zu zeigen, daß das Phänomen der Konfessionalisierung eine neue Dimension der Parteienbildung in die Verhandlungen des Reichstages gebracht hat. Desweiteren soll im zweiten Teil ersichtlich werden, daß die Kurfürsten die Hauptinitiative besaßen, und daß König Ferdinand gegen Ende der Verhandlungen gezielt zugunsten der katholischen Seite eingriff. Im letzten Teil schließlich zeigt sich, daß die intensiven Friedensverhandlungen als Ergebnis vorsichtigen Abwägens der Interessenlage beider Konfessionsparteien in den folgenschweren vagen Unbestimmtheiten der Artikel des Religionsfriedens enden mußten. Nicht näher behandelt werden die Reichsexekutionsordnung und die Reichskammergerichtsordnung, obwohl beide Punkte zwar auch in Augsburg verhandelt wurden, dort aber nur von nebensächlicher Bedeutung für den Religionsfrieden waren. Die Quellenlage ist gut, dank der kritischen Ausgabe des Textes mit den Entwürfen und der königlichen Deklaration von Karl Brandi, sowie den Beiträgen zur Reichsgeschichte 1553-1555 von August von Druffel.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reichtagspolitik im 16. Jahrhundert
- Die Reichtagskonstellation vor der Konfessionalisierung
- Die Reichtagskonstellation nach der Konfessionalisierung
- Der Verlauf des Augsburger Reichstages 1555
- Vorverhandlungen
- Der Entwurf des Kurfürstenrates
- Der Entwurf des Fürstenrates
- Die Zusammenarbeit beider Entwürfe
- Die Prorogationstaktik des Königs
- Der Religionsfriede im Abschied des Reichstages
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Verhandlungen zum Augsburger Religionsfrieden von 1555 und untersucht die Reichtagspolitik im Kontext der Konfessionalisierung. Sie analysiert die Veränderungen in der Reichtagskonstellation, die durch die Reformation entstanden sind, und die Rolle der Kurfürsten und des Königs in den Verhandlungen. Außerdem soll aufgezeigt werden, wie die Interessenlage beider Konfessionsparteien in den vagen Unbestimmtheiten der Artikel des Religionsfriedens zum Ausdruck kommt.
- Reichtagspolitik im 16. Jahrhundert
- Konfessionalisierung und Parteienbildung
- Die Rolle der Kurfürsten und des Königs
- Interessenlagen der Konfessionsparteien
- Die Bedeutung des Religionsfriedens für den Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Religionsfrieden von 1555 als richtungsweisendes Ereignis des Übergangs vom Mittelalter zur frühen Neuzeit vor. Sie skizziert die Bedeutung des Friedens für die Reichsunordnung und die „religiöse Neutralität des neuzeitlichen Staates“. Des Weiteren werden die Ziele der Arbeit und ihre Gliederung in drei Teile vorgestellt.
Reichtagspolitik im 16. Jahrhundert
Dieser Abschnitt erläutert die Struktur des Reichstages im 16. Jahrhundert, die sich in drei Beschlußkollegien (Kurfürstenkollegium, Reichsfürstenrat, Städtekollegium) gliederte. Die Aufgaben des Reichstages umfassten Reichsgesetzgebung, Reichsverfassung, Reichsfürstentümer, Kriege, Vertragsabschlüsse und Finanzpolitik. Es wird herausgestellt, dass der Kaiser die Einberufung des Reichstages bestimmte und den Vorsitz innehatte. Die Bedeutung der Kurfürsten und des Fürstenrates im politischen Prozess wird hervorgehoben.
Die Reichtagskonstellation vor der Konfessionalisierung
Dieser Abschnitt behandelt die Reichtagskonstellation vor der Reformation. Es werden die Führungsrolle der Kurfürsten, die Rolle des Fürstenrates und die Bedeutung des Städtekollegiums dargestellt. Der Kaiser hatte das Einberufungs- und Propositionsrecht und konnte den Verhandlungsgang aktiv beeinflussen. Überständische Gremien und Ausschüsse sowie private Verhandlungen spielten ebenfalls eine Rolle.
Die Reichtagskonstellation nach der Konfessionalisierung
Dieser Abschnitt behandelt die Veränderungen in der Reichtagskonstellation nach der Reformation. Die Konfessionalisierung führte zur Bildung von Interessengemeinschaften (Katholiken und Anhänger des Augsburger Bekenntnisses), die die politische Basis vorrangig vor dynastischer Rücksicht und ständischer Loyalität stellten. Es wird die Spaltung in zwei gegensätzliche Lager beschrieben, die sich insbesondere in den Resolutionen zeigt.
Der Verlauf des Augsburger Reichstages 1555
Dieser Abschnitt behandelt den Verlauf des Augsburger Reichstages 1555. Es werden die Vorverhandlungen, die Entwürfe des Kurfürstenrates und des Fürstenrates, die Zusammenarbeit beider Entwürfe und die Prorogationstaktik des Königs beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Reichtagspolitik, Konfessionalisierung, Religionsfrieden, Reformation, Kurfürsten, Fürstenrat, Städtekollegium, Kaiser, König, Interessenlagen, Konfessionsparteien, Augsburger Bekenntnis.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Bedeutung des Augsburger Religionsfriedens von 1555?
Er markiert die reichsrechtliche Anerkennung der katholischen und der lutherischen Konfession und schuf eine weltlich-juristische Friedensordnung für das Reich.
Wie veränderte die Konfessionalisierung den Reichstag?
Sie führte zur Bildung konfessioneller Parteien, die ihre Interessen oft über ständische Loyalitäten oder dynastische Rücksichten stellten.
Welche Rolle spielte König Ferdinand bei den Verhandlungen?
König Ferdinand griff gegen Ende der Verhandlungen gezielt ein, um die katholische Seite zu stützen und einen Kompromiss zu erzwingen, der den Frieden sicherte.
Was sind die "vagen Unbestimmtheiten" im Vertragstext?
Da kein theologischer Ausgleich möglich war, endeten viele Artikel in bewussten Unklarheiten, um den Konsens zwischen den zerstrittenen Parteien überhaupt zu ermöglichen.
Wer hatte die Hauptinitiative bei den Verhandlungen?
Die Kurfürsten besaßen die politische Hauptinitiative und erarbeiteten wesentliche Entwürfe, die die Grundlage für den späteren Friedensschluss bildeten.
- Quote paper
- Benjamin Kristek (Author), 1999, Die Verhandlungen zum Augsburger Religionsfrieden von 1555, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3067