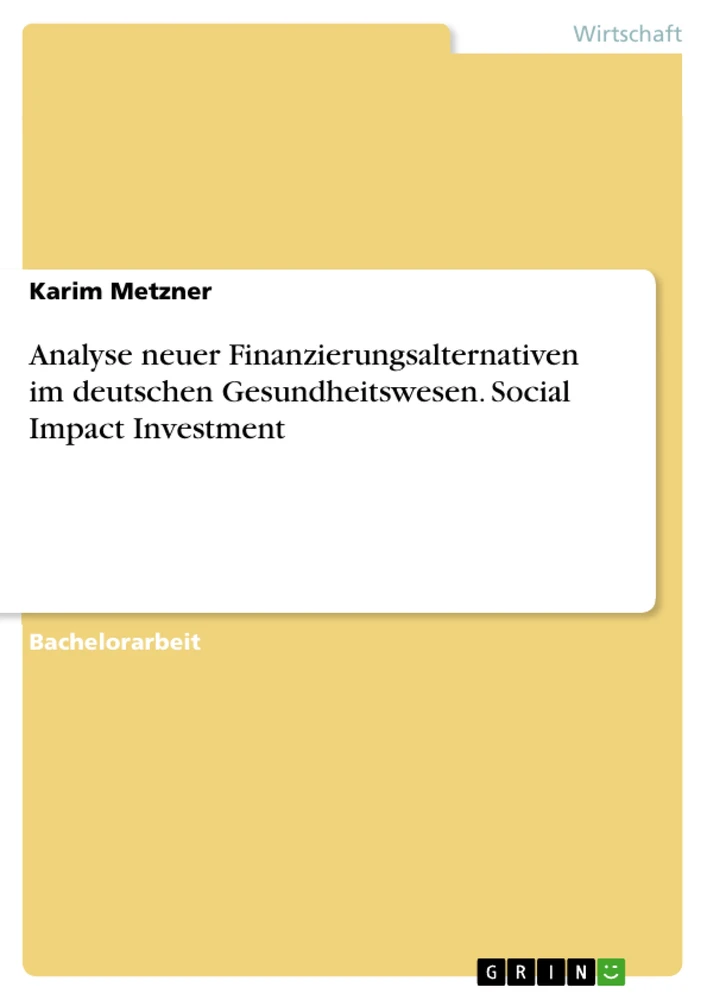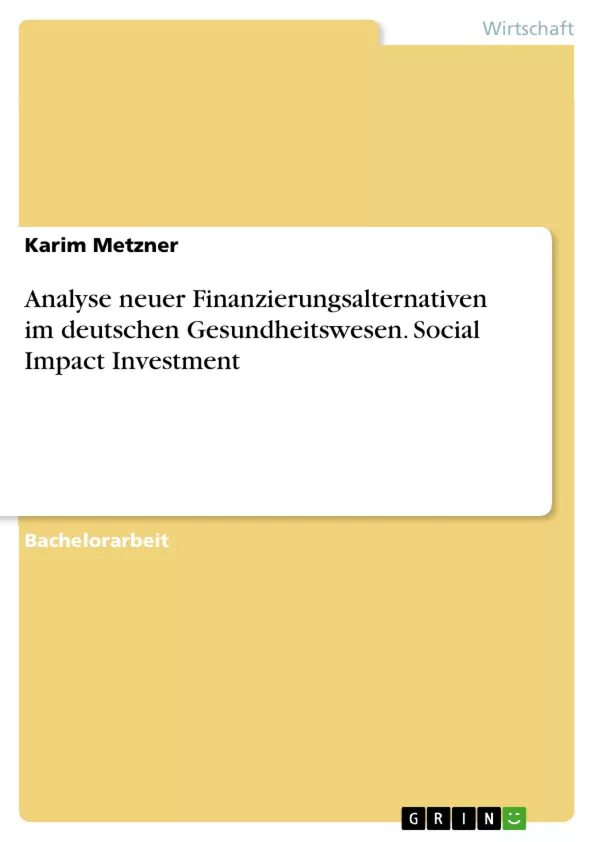Der deutsche Gesundheitsmarkt befindet sich in einem stetigen Wandel. Vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen und bevorstehender demografischer Veränderungen müssen sich Einrichtungen des Gesundheitswesens neu aufstellen. Es lässt sich ein zunehmender Kooperations- und Fusionstrend feststellen, der es den Unternehmen ermöglicht, neue Versorgungsformen zu schaffen, Synergien zu nutzen und Kosten einzusparen. Dass dieser Trend weiterhin zwingend notwendig ist, zeigt die Zahl der Einrichtungen, die unwirtschaftlich sind. Unter den 2017 Krankenhäusern in Deutschland schreibt mittlerweile mindestens die Hälfte einen Jahresverlust. So lassen die Kliniken das solidarische System immer mehr ins Wanken geraten. Nicht zuletzt wegen der mangelnden Vergabe dringend benötigter Investitionsmittel seitens der Länder sehen sich die Krankenhäuser in dieser prekären Lage. Geht es so weiter, könnte die entstehende Finanzierungslücke auch die Behandlungsqualität belasten.
Um der drohenden Negativspirale entgegenzuwirken, müssen politische Änderungen initiiert, aber dessen ungeachtet weitere Wirtschaftlichkeitsreserven erschlossen werden. Hierzu gehören auch neue Finanzierungsalternativen, um Investitionen in Gebäude oder Medizintechnik zu ermöglichen.
Hierbei sollte der Blick nicht nur auf teilweise bereits marktübliche Möglichkeiten wie eine klassische Kreditfinanzierung gerichtet, sondern vor allem auf neue Ideen ausgeweitet werden.
Die folgende wissenschaftliche Arbeit wird sich dem Thema neuer alternativer Finanzierungsmöglichkeiten widmen und hinterfragen, welche Vor- und Nachteile sich durch ihre Anwendung ergeben. Dabei wird auch untersucht, ob die Modelle mit den Grundsätzen des sozialen Aspektes unserer Marktwirtschaft vereinbar und gesellschaftlich vertretbar sind.
Einige der Modelle, die vorgestellt werden, kommen aus anderen Bereichen der Wirtschaft und müssen auf ihre Kompatibilität mit dem Gesundheitssystem überprüft werden.
Zudem werden die Ideen in den gesundheitsökonomischen Kontext gesetzt, um Aufschluss darüber zu gewinnen, ob die Methoden finanzierbar sein könnten und wie sich Modelle auf das bereits bestehende System auswirken könnten. Dabei sind die Modelle meist komplementär zueinander, sodass man sich nicht zwischen verschiedenen Alternativen entscheiden muss.
Inhaltsverzeichnis
- I. ZENTRALE FRAGE- UND PROBLEMSTELLUNG
- II. PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP
- 2.1. DEFINITION
- 2.2 ZIELE UND ENTWICKLUNG
- 2.3 MODELLE
- 2.4 VOR- UND NACHTEILE
- III. LEASING IM GESUNDHEITSWESEN
- 3.1 EINFÜHRUNG
- 3.2 OPERATE LEASING
- 3.3 FINANCIAL LEASING
- 3.4 SALE-AND-LEASE-BACK
- 3.5 VORTEILE UND NACHTEILE VON LEASING IM GESUNDHEITSWESEN
- IV. MISSION INVESTING
- 4.1 EINFÜHRUNG
- 4.2 ANLAGEKLASSEN DES MISSION INVESTING
- 4.2.1. LIQUIDITÄT, FESTGELD, SPARBRIEFE
- 4.2.2 FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE
- 4.2.3 AKTIEN
- 4.2.4 IMMOBILIEN
- 4.3 CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN VON MISSION INVESTING
- V. SOCIAL IMPACT INVESTMENT
- 5.1 EINFÜHRUNG
- 5.2 INHALTE DES SOCIAL IMPACT INVESTMENT
- 5.3 KONSTRUKTION EINES SOCIAL IMPACT INVESTMENTS
- 5.3.1 INVESTOREN
- 5.3.2 INTERMEDIÄRE
- 5.3.3 KAPITALEMPFÄNGER
- 5.4 SOCIAL IMPACT BONDS
- 5.5 VOR- UND NACHTEILE VON SOCIAL IMPACT INVESTMENT
- VI. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht neue Finanzierungsalternativen im deutschen Gesundheitswesen mit Fokus auf Social Impact Investment. Sie beleuchtet aktuelle Herausforderungen des Gesundheitsmarktes und zeigt auf, wie innovative Finanzierungsmodelle den Herausforderungen durch begrenzte Ressourcen und demografischen Wandel begegnen können.
- Analyse der Herausforderungen des deutschen Gesundheitsmarktes im Kontext von Ressourcenknappheit und demografischer Veränderungen
- Bewertung unterschiedlicher Finanzierungsmodelle wie Public-Private-Partnerships, Leasing und Mission Investing hinsichtlich ihrer Eignung für den Gesundheitssektor
- Einleitung in das Konzept des Social Impact Investment und dessen Potenzial zur Finanzierung sozialer und nachhaltiger Projekte im Gesundheitswesen
- Diskussion der Vor- und Nachteile der untersuchten Finanzierungsmodelle sowie deren Auswirkungen auf die Effizienz und Nachhaltigkeit des deutschen Gesundheitswesens
- Identifizierung der Herausforderungen und Chancen, die mit der Implementierung von Social Impact Investment in den Gesundheitssektor verbunden sind.
Zusammenfassung der Kapitel
- I. ZENTRALE FRAGE- UND PROBLEMSTELLUNG: Dieses Kapitel skizziert die aktuelle Situation des deutschen Gesundheitsmarktes und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus begrenzten Ressourcen und dem demografischen Wandel ergeben. Die Bedeutung von neuen Finanzierungsmodellen wird hervorgehoben, um die notwendige Investitionen im Gesundheitswesen zu ermöglichen und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.
- II. PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP: Dieses Kapitel definiert den Begriff Public-Private-Partnership (PPP) und erläutert seine Ziele sowie die Entwicklung in Deutschland. Verschiedene Modelle von PPPs werden vorgestellt, und die Vor- und Nachteile einer solchen Zusammenarbeit werden analysiert.
- III. LEASING IM GESUNDHEITSWESEN: Das Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Leasingformen, die im Gesundheitswesen eingesetzt werden können. Es werden sowohl Operate Leasing als auch Financial Leasing und Sale-and-Lease-Back erläutert, wobei die jeweiligen Vor- und Nachteile im Kontext des Gesundheitswesens betrachtet werden.
- IV. MISSION INVESTING: Dieses Kapitel stellt das Konzept des Mission Investing vor und erläutert verschiedene Anlageklassen, die unter diese Kategorie fallen. Es werden Chancen und Herausforderungen von Mission Investing im Gesundheitswesen beleuchtet.
- V. SOCIAL IMPACT INVESTMENT: Dieses Kapitel erläutert die Inhalte des Social Impact Investments und stellt die verschiedenen Akteure innerhalb dieser Anlageform vor, wie Investoren, Intermediäre und Kapitalempfänger. Es wird ein Einblick in das Funktionieren von Social Impact Bonds gegeben und die Vor- und Nachteile von Social Impact Investment im Gesundheitswesen werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit neuen Finanzierungsmodellen im deutschen Gesundheitswesen, die auf Social Impact Investment fokussieren. Zentrale Themen sind Public-Private-Partnerships, Leasing, Mission Investing und Social Impact Bonds. Die Analyse bezieht sich auf die Herausforderungen des Gesundheitsmarktes im Kontext von Ressourcenknappheit und demografischem Wandel. Die Arbeit beleuchtet die Eignung und Potenziale dieser Finanzierungsmodelle für den Gesundheitssektor sowie die gesellschaftlichen Auswirkungen und ethischen Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Social Impact Investment im Gesundheitswesen?
Es handelt sich um Finanzierungsmodelle, die neben einer finanziellen Rendite auch eine messbare soziale oder gesellschaftliche Wirkung erzielen wollen.
Warum brauchen deutsche Krankenhäuser neue Finanzierungswege?
Viele Kliniken schreiben Verluste, und die Länder vergeben nicht genügend Investitionsmittel für Gebäude und Medizintechnik, was zu einer Finanzierungslücke führt.
Wie funktionieren Social Impact Bonds?
Investoren finanzieren soziale Projekte vorab; der Staat zahlt das Kapital plus Rendite nur zurück, wenn zuvor definierte soziale Ziele erreicht wurden.
Was sind Public-Private-Partnerships (PPP) im Klinikbereich?
Eine Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Investoren zur Realisierung von Bauprojekten oder dem Betrieb technischer Infrastruktur.
Ist Mission Investing mit dem sozialen Aspekt vereinbar?
Ja, Mission Investing zielt darauf ab, das Stiftungs- oder Anlagekapital so zu investieren, dass es die soziale Mission der Einrichtung direkt unterstützt.
- Citar trabajo
- Karim Metzner (Autor), 2014, Analyse neuer Finanzierungsalternativen im deutschen Gesundheitswesen. Social Impact Investment, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306753