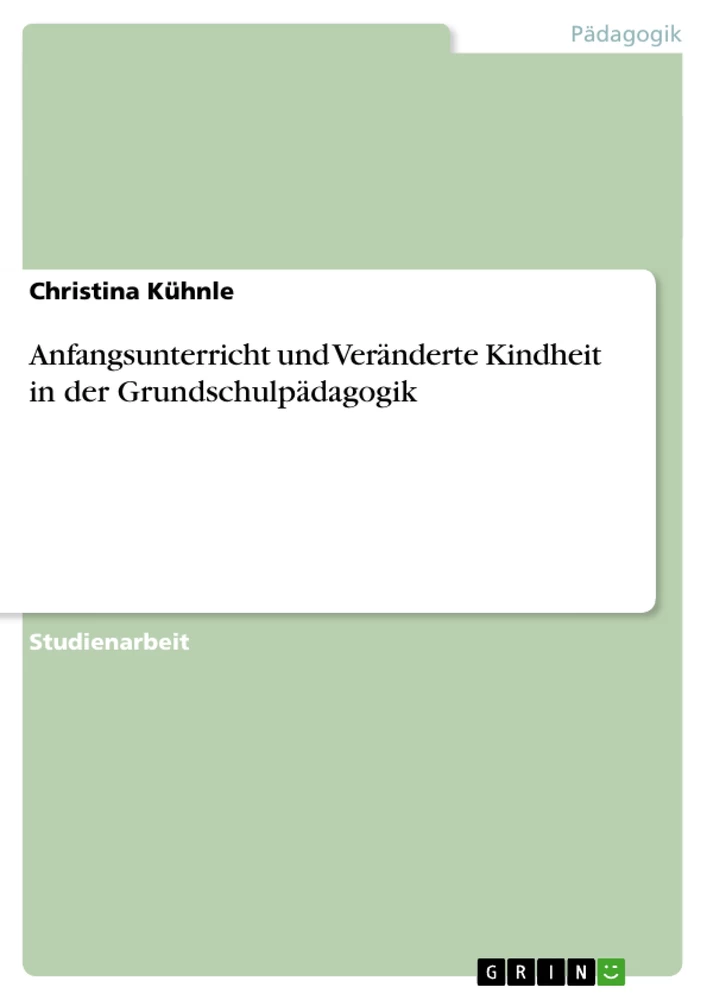„Was ist mit unseren Kindern los?“, solche oder ähnliche Fragen hört man sehr oft in letzter Zeit, von Eltern, Lehrkräften, Erziehern, Politiker und Polizisten. Sind unsere Kinder anders geworden? Ja! Man spricht auch von der „veränderten Kindheit“! Um es genau zu sagen, haben sich die Verhältnisse geändert unter denen die Kinder aufwachsen, was sie anders werden lässt. Und genau darum soll es in dieser Abhandlung gehen, die als Vorbereitung für die erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen stehen soll.
2. Die Grundschule und ihre Aufgabe
Die Grundschule hat die Aufgabe alle Kinder des Volkes (heute: aller Völker) sozial zu integrieren, eine eigenwertige grundlegende Allgemeinbildung zu vermitteln, die auf das Alter und das Umfeld des Kindes abgestimmt sein muss. 1919 wurde die vier-jährige Grundschulpflicht eingeführt, was auch in der Weimarer Verfassung zu finden ist. Im Allgemeinen besteht die Schulpflicht für alle Kinder, die bis zum 30.6. eines Kalenderjahres das 6.Lebensjahr vollendet haben. Dann müssen sie eingschult werden. Die Umwelt des Kindes ist in Zonen eingeteilt, worauf die Grundschule Rücksicht nehmen muss. So gibt es:
- das ökologisches Zentrum, was die Familie und das zu Hause darstellt
- den ökologischen Nahraum, womit die Nachbarschaft gemeint ist
- die ökologischen Ausschnitte, was Orte sind an denen der Umgang geregelt ist, wie zum Beispiel die Schule, der Sportverein etc.
- die ökologische Peripherie, womit gelegentliche Kontakte, Urlaub, Freizeit etc. gemeint sind
Somit ist die Grundschule der einzige Ort, an dem sich Kinder aus verschiedenen sozialen Herkunftsfamilien, aus verschiedenen sozialen Milieus, Kinder mit sehr unterschiedlichen Begabungen sowie Interessen und unterschiedlichen Geschlechts über einen längeren Zeitraum täglich begegnen.
Des Weiteren müssen noch einige Aspekte genannt werden, die die Schule erfüllen muss.
Zum einen der Aktivitätsaspekt, das heißt, es muss zu Selbständigkeit und Selbstverantwortung beim Lernen geführt werden.
Der Differenzierungsaspekt, es muss also individuelles Lernen auf unterschiedlichem Niveau, mit unterschiedlichen Zielen und Mitteln ermöglicht werden.
Und schließlich der Freiheitsaspekt, es muss also die Freiheit in Entscheidungen beim Lernen gegeben sein. Die beiden ersten Aspekte müssen im Anfangsunterricht verknüpft werden, der letztere Aspekt ist nicht so wichtig für den Anfangsunterricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundschule und ihre Aufgabe
- Kindheit und Kindsein
- Philippe Ariès
- Lloyd de Mause
- Veränderte Kindheit
- Veränderungen in familiärer Lebenswelt
- Spiel- und Freizeitverhalten
- Kinder und Medien
- Erziehungsnormen
- Multikulturelle Gesellschaft
- veränderte räumliche und zeitliche Bedingungen
- Vergesellschaftung der Kindheit
- Aufhebung der Kindheit
- Einschulung und Anfangsunterricht
- Integrative Grundschule
- vorschulische Einrichtungen
- Die Zeit vor Schuleintritt
- Bedeutung für die Gestaltung des Schulanfangs
- veränderte (integrierte) Schuleingangsphase
- Schulreife und Schulfähigkeit
- Aufgaben des Anfangsunterrichts
- Förderklassen
- Förderung durch Team-Teaching
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Abhandlung befasst sich mit der „veränderten Kindheit“ im Kontext des Anfangsunterrichts in der Grundschule. Sie soll die Herausforderungen für die Grundschule im Hinblick auf die sich wandelnden Bedingungen der Kindheit und das sich daraus ergebende veränderte Kindsein aufzeigen und diskutieren.
- Die veränderte Lebenswelt von Kindern und ihre Auswirkungen auf den Anfangsunterricht
- Die Rolle der Grundschule bei der Integration und Förderung von Kindern aus unterschiedlichen sozialen Milieus
- Die Bedeutung von Spiel und Freizeit für die Entwicklung von Kindern
- Die Herausforderungen des Medienwandels für die Bildung von Kindern
- Die Bedeutung von Schulreife und Schulfähigkeit für einen erfolgreichen Schulanfang
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik „veränderte Kindheit“ heraus und zeigt die Bedeutung dieser Thematik für die Praxis des Anfangsunterrichts in der Grundschule auf.
Kapitel 2: Die Grundschule und ihre Aufgabe
Dieses Kapitel beleuchtet die Aufgaben der Grundschule, insbesondere die Integration von Kindern aus unterschiedlichen sozialen Milieus und die Vermittlung einer eigenwertigen grundlegenden Allgemeinbildung.
Kapitel 3: Kindheit und Kindsein
Hier werden die verschiedenen Perspektiven auf die Kindheit und das Kindsein vorgestellt. Die Kapitel fokussiert auf die Theorien von Philippe Ariès und Lloyd de Mause, die die Kindheit als Entdeckung der Neuzeit bzw. als evolutionäres Entwicklungsprodukt betrachten.
Kapitel 4: Veränderte Kindheit
Dieses Kapitel beleuchtet die Veränderungen in der Lebenswelt von Kindern und ihre Auswirkungen auf das Kindsein. Dazu gehören Veränderungen in der Familie, im Spiel- und Freizeitverhalten, im Umgang mit Medien, in den Erziehungsnormen sowie in den räumlichen und zeitlichen Bedingungen.
Kapitel 5: Einschulung und Anfangsunterricht
Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf dem Zusammenhang zwischen veränderter Kindheit und den Aufgaben des Anfangsunterrichts. Es werden die Bedeutung der integrativen Grundschule, die Rolle vorschulischer Einrichtungen, die Zeit vor Schuleintritt und die Bedeutung von Schulreife und Schulfähigkeit für einen erfolgreichen Schulanfang behandelt.
Schlüsselwörter
Veränderte Kindheit, Grundschulpädagogik, Anfangsunterricht, Schulreife, Schulfähigkeit, Integration, Inklusion, Spiel, Freizeit, Medien, Erziehungsnormen, Multikulturelle Gesellschaft, Familie, Bildung, Entwicklung, Philippe Ariès, Lloyd de Mause
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "veränderter Kindheit"?
Der Begriff beschreibt den Wandel der Aufwachsbedingungen von Kindern, etwa durch neue Familienstrukturen, verändertes Medienverhalten und eine Verplanung der Freizeit.
Welche Aufgaben hat die moderne Grundschule?
Die Grundschule soll alle Kinder sozial integrieren und eine grundlegende Allgemeinbildung vermitteln, die auf die unterschiedlichen Begabungen und Milieus Rücksicht nimmt.
Was ist der Unterschied zwischen Schulreife und Schulfähigkeit?
Schulreife bezog sich früher oft auf körperliche Reife, während Schulfähigkeit heute als Zusammenspiel von kindlichen Voraussetzungen und der Fähigkeit der Schule, das Kind aufzunehmen, verstanden wird.
Wie beeinflussen Medien den Anfangsunterricht?
Der Medienwandel stellt Lehrer vor die Herausforderung, Kinder mit sehr unterschiedlichen medialen Vorerfahrungen und Konzentrationsspannen individuell zu fördern.
Warum ist die integrative Schuleingangsphase wichtig?
Sie ermöglicht einen gleitenden Übergang vom Kindergarten in die Schule und geht flexibel auf das unterschiedliche Lerntempo der Schulanfänger ein.
- Citar trabajo
- Christina Kühnle (Autor), 2004, Anfangsunterricht und Veränderte Kindheit in der Grundschulpädagogik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30678