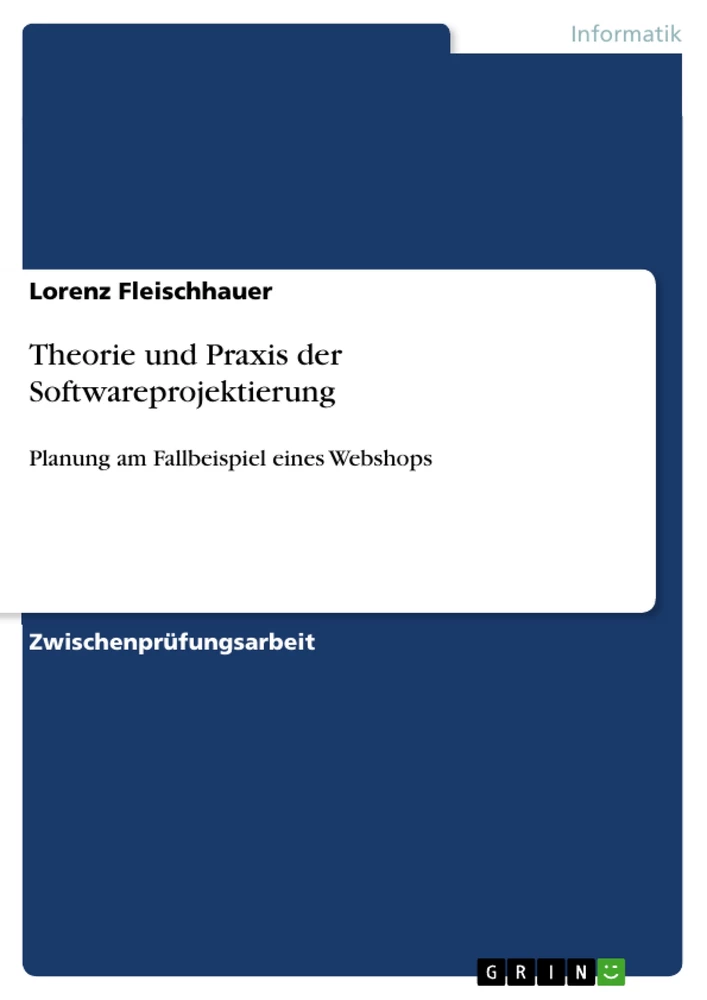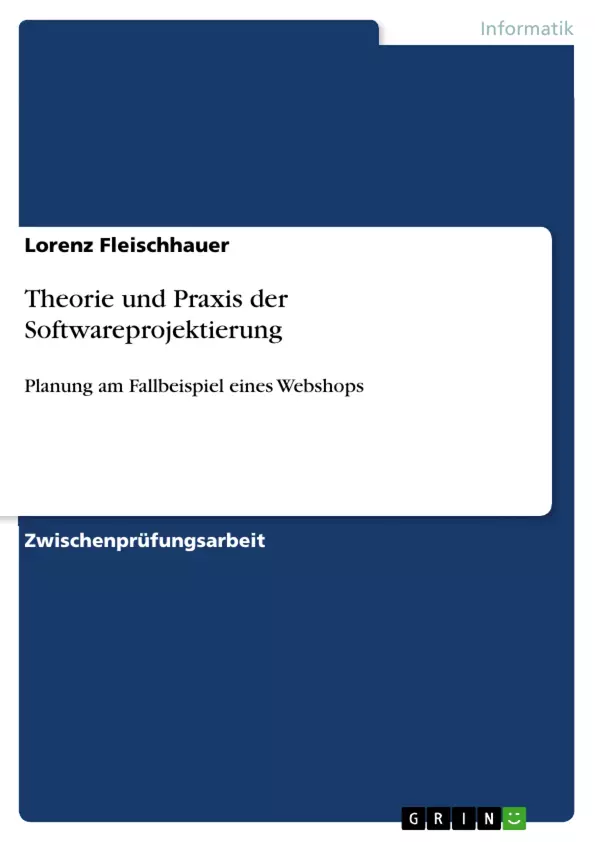Die vorliegende Arbeit plant die Durchführung eines Softwareprojekts am Fallbeispiel eines Webshops. Sie zeigt die verschiedenen Phasen der Projektplanung auf und stellt das Wasserfall-Modell und die Agile Methodik gegenüber. Neben einem Projektstrukturplan (PSP) erstellt der Autor ebenfalls einen exemplarischen Projektablaufplan (PrAP).
Inhaltsverzeichnis
- A Planung von Softwareprojekten
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Rahmenbedingungen
- 1.3 Die Projektphasen im Überblick
- 1.3.1 Projektstart
- 1.3.2 Projektplanung
- 1.3.3 Projektrealisierung
- 1.3.4 Projektabschluss
- 2 Fokus Projektplanung
- 2.1 Festlegung der Projektmethodik
- 2.1.1 Wasserfall-Modell
- 2.1.2 Agile Methodik
- 2.1.3 Entscheidung
- 2.2 Projektorganisation
- 2.3 Projektstrukturplan (PSP)
- 2.4 Projektablaufplan (PrAP)
- 3 Zusammenfassung
- B Verzeichnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung des Buches liegt in der Vermittlung von Wissen und Praxiswissen zur Planung von Softwareprojekten. Es wird ein Fallbeispiel eines Webshops genutzt, um die verschiedenen Phasen und Aspekte der Projektplanung zu veranschaulichen.
- Vorgehensmodelle für die Projektplanung (Wasserfall-Modell, Agile Methodik)
- Projektstrukturplan und Projektablaufplan
- Bedeutung des Change-Managements bei Softwareprojekten
- Kritische Erfolgsfaktoren für Softwareprojekte
- Herausforderungen bei der Zieldefinition und der Benutzerakzeptanz
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation und die Rahmenbedingungen für die Planung von Softwareprojekten beleuchtet. Der erste Teil des Buches befasst sich mit den verschiedenen Projektphasen, wobei der Fokus auf der Projektplanung liegt. Kapitel 2 analysiert verschiedene Vorgehensmodelle für die Projektplanung, wie das Wasserfall-Modell und agile Methoden, und diskutiert die Entscheidung für ein bestimmtes Modell im Kontext des Fallbeispiels. Der dritte Teil des Buches betrachtet die Projektstrukturplanung und Projektablaufplanung im Detail.
Schlüsselwörter
Softwareprojektplanung, Wasserfall-Modell, Agile Methodik, Projektstrukturplan, Projektablaufplan, Change-Management, Webshop, Fallbeispiel.
- Quote paper
- Lorenz Fleischhauer (Author), 2015, Theorie und Praxis der Softwareprojektierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306824