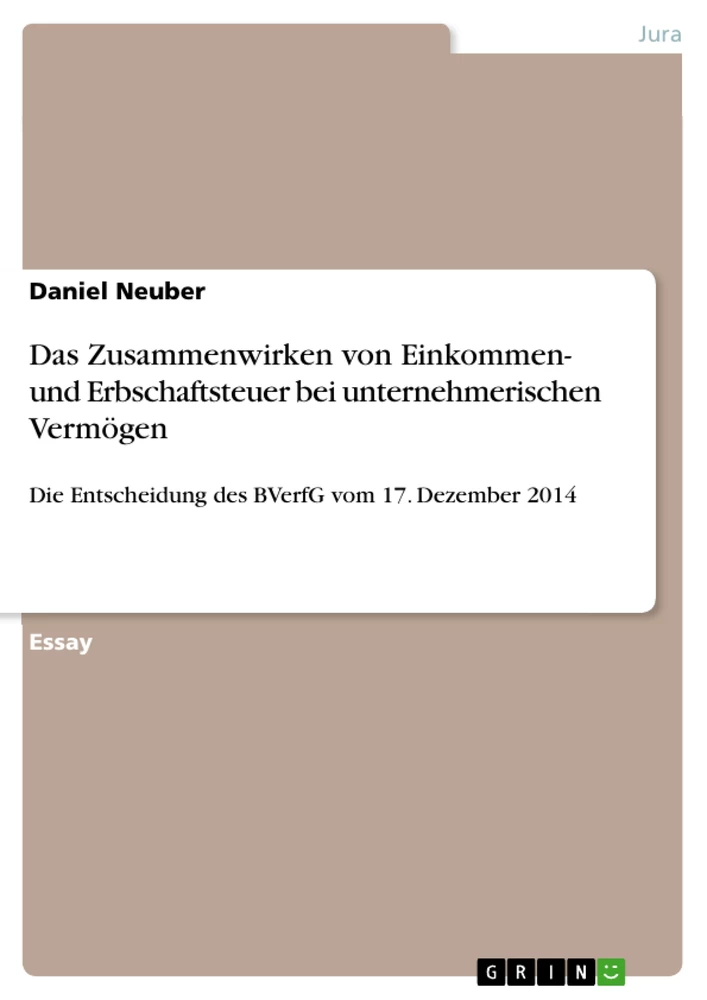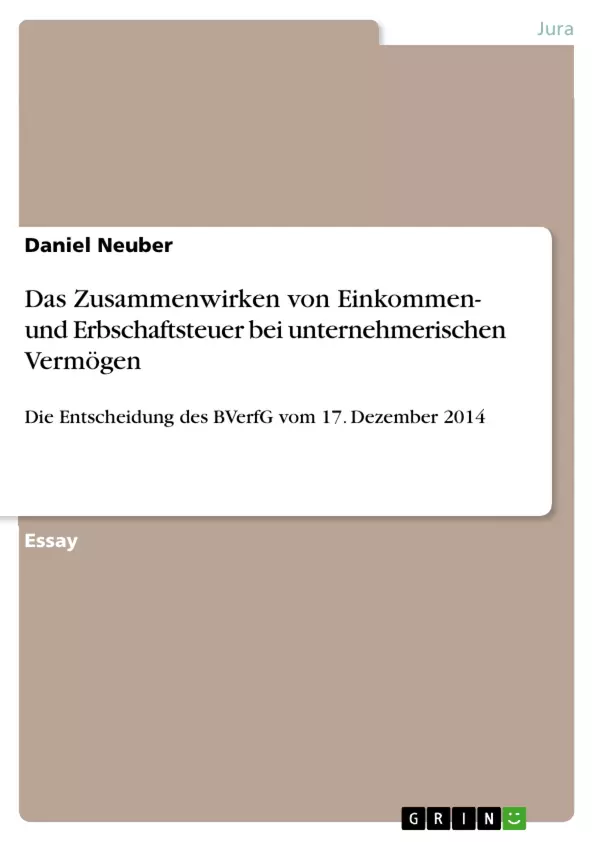Die Arbeit soll aufzeigen, dass Abstimmungsbedarf zwischen der Erbschaft- und Schenkungsteuer (im Folgenden vereinfacht Erbschaftsteuer) und der Einkommensteuer besteht, insbesondere im Hinblick auf unternehmerische Vorgänge. Dies soll zum einen anhand der aktuellen Rechtslage verdeutlicht werden, um dann vertieft die Problematik im Lichte des Urteils vom BVerfG vom 17. Dezember 2014 zu erörtern.
Damit dem Leser ein verständlicher Zugang zur Thematik der Arbeit ermöglicht wird, sollen die beiden relevanten Steuerarten im Steuersystem erläutert werden. Hier soll die überwiegende Deckungsgleichheit, sowie die marginale Differenz dieser aufgezeigt werden. In Anbetracht dieser Erkenntnis soll an die Brisanz der Thematik der Arbeit herangeführt werden, indem die Notwendigkeit der Abstimmung mit der Einkommensteuer anhand von steuersystematisch gewollten Doppelbelastungen und von systemwidrigen Doppelbelastungen bei unternehmerischen Vermögen verdeutlicht wird.
Mittels der Darstellung der unterschiedlichen Bewertungsregelungen von Betriebsvermögen im EStG und im ErbStG soll veranschaulicht werden, dass es bei der Bewertung zu einer Doppelbesteuerung kommt. Abschließen soll der Abschnitt mit einer Skizzierung der derzeitigen Regelungssystematik des ErbStG m.W.v. 01. Januar 2009, um dann, bevor auf das aktuelle Urteil vom 17. Dezember 2014 Bezug genommen wird, steuersystematische und verfassungsrechtliche Bedenken aufzuzeigen. Abschnitt C wird die aus mehreren Gründen bemerkenswerte Entscheidung vom 17. Dezember 2014 des Ersten Senats des BVerfG näher erläutern und einer kritischen Würdigung hinsichtlich der sich hieraus ergebenden Konsequenzen im Hinblick auf das Zusammenspiel zwischen Erbschaft- und Einkommensteuer unterwerfen. Des Weiteren wird auf die Folgen für die Praxis eingegangen und Bezug genommen wie das BVerfG die Beanstandungen und Vorgaben des Urteils verfassungsrechtlich rechtfertigt.
Nach dem Urteil stellt sich die Frage der zukünftigen Ausgestaltung des Erbschaftsteuerrechts. Vorstellbare erbschaftsteuerliche Modelle aus der Literatur und vom BMF sollen dem Leser in Abschnitt D in Form von Lösungsansätzen, die an die Stelle des bestehenden Erbschaftsteuerrechts treten könnten, vorgestellt und im Anschluss einer normativen Betrachtung des Verfassers unterworfen werden. Ein Fazit sowie ein Ausblick auf die zu erwartenden Entwicklungen sollen die Arbeit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Einkommen- und Erbschaftsteuer im Steuersystem
- I. Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Steuerarten
- 1. Erbschaftsteuer
- 2. Einkommensteuer
- 3. Zusammenfassung
- II. Das Zusammenwirken von Erbschaft- und Einkommensteuer im Normalfall
- III. Das Zusammenwirken von Erbschaft- und Einkommensteuer bei unternehmerischen Vorgängen
- 1. Unterschiede in der Bewertung von Betriebsvermögen im EStG und im ErbStG
- a. Betriebsvermögen i.S.d. EStG
- b. Betriebsvermögen i.S.d. ErbStG
- c. Stille Reserven
- d. Latente Einkommensteuer
- 2. Zwischenergebnis
- IV. Steuerbefreiungen für Betriebsvermögen
- 1. Begünstigtes Vermögen i.S.v. § 13b Abs. 1 ErbStG
- 2. Lohnsummen- und Freistellungsregelung gem. § 13a Abs. 1 ErbStG
- 3. Verwaltungsvermögen i.S.d. § 13b Abs. 2 ErbStG
- 4. Regelverschonung und Optionsmodell
- V. Steuersystematische und verfassungsrechtliche Stellungnahme
- C. Urteil des BVerfG vom 17. Dezember 2014
- I. Zum Sachverhalt
- II. Einführung in die Probleme
- 1. Vorgaben des BVerfG
- a. Lohnsummen- und Freistellungsregelung gem. § 13a Abs. 1 ErbStG
- b. Verwaltungsvermögen i.S.d. § 13b Abs. 2 ErbStG
- c. Bedürfnisprüfung
- 2. Rechtsfolgenausspruch
- III. Praktische Konsequenzen
- IV. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
- V. Auswirkungen auf das Zusammenspiel zwischen Erbschaft- und Einkommensteuer
- D. Reformansätze
- I. Bandbreite möglicher Ansätze
- 1. Abschaffung der Verschonungsregelungen
- 2. Regionalisierung der Erbschaftsteuer
- 3. Integration der Erbschaftsteuer in das EStG
- II. Kritische Würdigung der Ansätze
- E. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Zusammenwirken von Einkommen- und Erbschaftsteuer bei unternehmerischen Vermögen im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014. Sie untersucht die Unterschiede in der Bewertung von Betriebsvermögen im Einkommensteuergesetz (EStG) und im Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) sowie die Auswirkungen der Steuerbefreiungen für Betriebsvermögen auf das Zusammenspiel beider Steuerarten. Darüber hinaus werden die verfassungsrechtlichen Aspekte der Erbschaftsteuer und die Reformansätze im Bereich der Erbschaftsteuer beleuchtet.
- Unterschiede in der Bewertung von Betriebsvermögen im EStG und im ErbStG
- Steuerbefreiungen für Betriebsvermögen
- Verfassungsrechtliche Aspekte der Erbschaftsteuer
- Reformansätze im Bereich der Erbschaftsteuer
- Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf das Zusammenspiel von Einkommen- und Erbschaftsteuer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Gegenstand der Arbeit. Kapitel B beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Einkommen- und Erbschaftsteuer und analysiert deren Zusammenwirken im Normalfall sowie bei unternehmerischen Vorgängen. Kapitel C widmet sich dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014, analysiert den Sachverhalt, die Vorgaben des Gerichts und die praktischen Konsequenzen. Kapitel D diskutiert verschiedene Reformansätze im Bereich der Erbschaftsteuer und deren kritische Würdigung.
Schlüsselwörter
Einkommensteuer, Erbschaftsteuer, Betriebsvermögen, Bewertung, Steuerbefreiungen, Verfassungsrecht, Reformansätze, Unternehmensnachfolge, Bundesverfassungsgericht.
- Arbeit zitieren
- Daniel Neuber (Autor:in), 2015, Das Zusammenwirken von Einkommen- und Erbschaftsteuer bei unternehmerischen Vermögen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306992