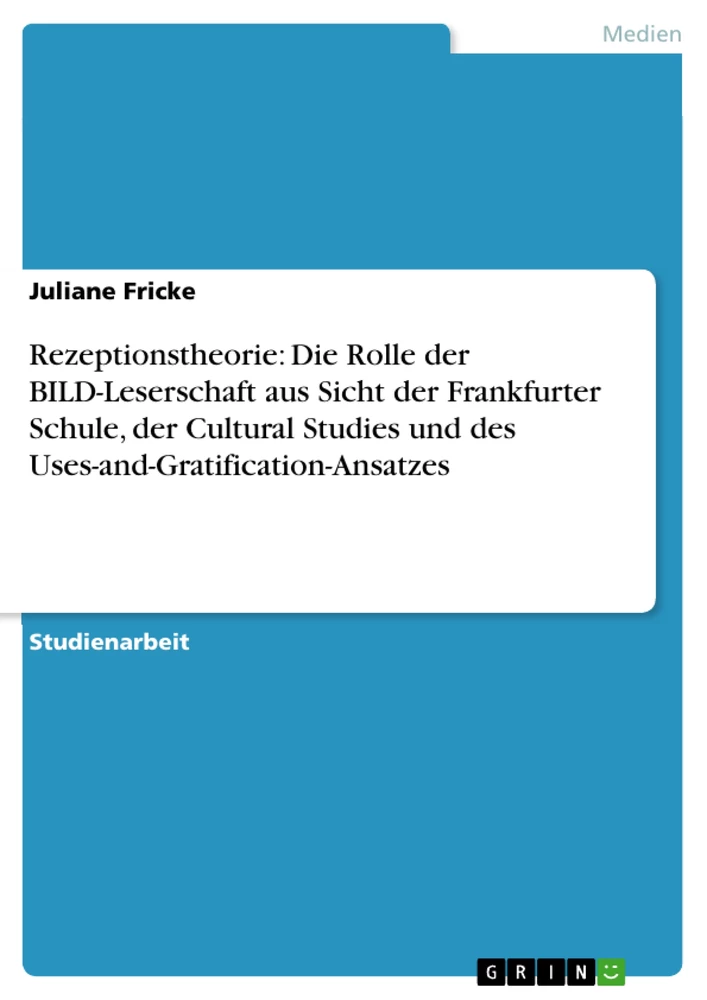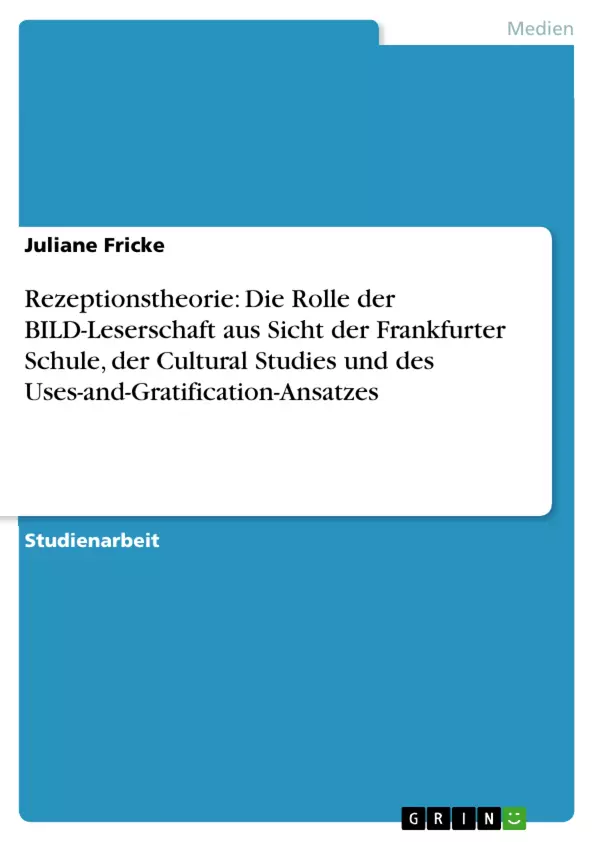Unter der Leitfrage „Wie setzen sich verschiedene rezeptionstheoretische Perspektiven mit der Rolle der Leserschaft der BILD-Zeitung auseinander?“ sollen in dieser Arbeit drei verschiedene Herangehensweisen der Rezeptionsforschung beleuchtet werden. Chronologisch kommt dabei die kritische Perspektive der Frankfurter Schule zuerst. Später wird dann auf den Uses-and-Gratifications-Ansatz und die Cultural Studies eingegangen. Da kein holistisches Bild dieser Erklärungsansätze verfolgt werden kann, werden vier wichtige Kriterien bei allen drei Ansätzen hervorgehoben. Als erstes Kriterium ist die Definition von „Gesellschaft“ zu nennen, die als Ansatz allen Studien zugrunde liegt. Zweites Kriterium ist der Gegenstandsbereich, den sich die jeweilige Disziplin als Thema ihrer Forschung ausgesucht hat. Als drittes wird die Methodik, mit der sie an diesen Gegenstandsbereich herangeht untersucht und als viertes und grundlegendes Kriterium dieser Arbeit die Sichtweise auf Rezeption, die ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage in Bezug auf die Leserschaft und die Leser-Text-Beziehung ist. Damit werden die unterschiedlichen Herangehensweisen an den Untersuchungsgegenstand „BILD“ und ihrer Leser vergleichbar. Exemplarisch wird jeweils eine Studie eines Forschers dargestellt, die dem Ansatz zugeordnet werden kann. Diese Studien beschäftigen sich jeweils mit ähnlichen Fragestellungen zur BILD-Zeitung. An ihnen zeigt sich die wichtige Rolle der Perspektive in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Populär- und Massenkultur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ansätze und ihr Zugang zum Medium BILD-Zeitung und dessen Leser
- Kritischer Ansatz – Die BILD-Zeitung als Gefahr für den Leser
- Der Forschungsansatz der kritischen Theorie in Kürze
- Enzensberger – Der Triumph der BILD-Zeitung oder die Katastrophe der Pressefreiheit
- Uses- and Gratifications Ansatz - Individueller Nutzen der BILD-Zeitung
- Der Forschungsansatz beim Uses- and Gratifications- Modell
- Habicht - „Die sprechen den Leuten aus der Seele“ Motive für die Nutzung der BILD-Zeitung
- Der Cultural Studies Ansatz
- Der Forschungsansatz der Cultural Studies
- Brichta - Die BILD-Zeitung aus Sicht ihrer Leserinnen und Leser
- Unterschiede der verschiedenen Ansätze, die beim Vergleich der Studien deutlich werden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rezeption der BILD-Zeitung und analysiert verschiedene rezeptionstheoretische Ansätze, die sich mit der Rolle der Leserschaft auseinandersetzen. Sie beleuchtet die kritische Perspektive der Frankfurter Schule, den Uses-and-Gratifications-Ansatz und die Cultural Studies und untersucht, wie diese Perspektiven die Leserschaft der BILD-Zeitung betrachten.
- Die kritische Theorie und ihre Sichtweise auf die BILD-Zeitung als Instrument der Kulturindustrie
- Der Uses-and-Gratifications-Ansatz und die individuellen Bedürfnisse der Leser
- Die Cultural Studies und die Bedeutung der BILD-Zeitung in der Alltagskultur
- Der Vergleich der verschiedenen Ansätze und ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die Leserschaft
- Die Rolle der BILD-Zeitung als Meinungsmacher und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die BILD-Zeitung als bedeutendes Leitmedium in Deutschland vor und erläutert die Forschungsfrage, die sich mit der Rolle der Leserschaft aus verschiedenen rezeptionstheoretischen Perspektiven auseinandersetzt. Die Arbeit beleuchtet drei verschiedene Ansätze: die kritische Perspektive der Frankfurter Schule, den Uses-and-Gratifications-Ansatz und die Cultural Studies. Sie untersucht die jeweiligen Forschungsansätze, die Sichtweise auf Rezeption und die Leser-Text-Beziehung. Zudem werden exemplarische Studien vorgestellt, die die unterschiedlichen Perspektiven auf die BILD-Zeitung und ihre Leserschaft verdeutlichen.
Der Abschnitt „Ansätze und ihr Zugang zum Medium Bild-Zeitung und seinen Lesern“ stellt die drei Ansätze im Detail vor und zeigt ihre unterschiedlichen Medien- und Publikumszentrierungen sowie ihre Rezipientenbilder auf. Die kritische Theorie, der Uses-and-Gratifications Approach und die Cultural Studies werden anhand von Grundlagentexten vorgestellt und ihre Meinungsverschiedenheiten werden erläutert.
Der Abschnitt „Kritischer Ansatz - Die BILD-Zeitung als Gefahr für den Leser“ konzentriert sich auf die kritische Theorie, die die BILD-Zeitung als ein Produkt der Kulturindustrie betrachtet. Es wird der Forschungsansatz der kritischen Theorie erläutert und die Sichtweise auf die Leserschaft als passive Konsumenten dargestellt. Die Studie von Enzensberger wird als Beispiel für die kritische Perspektive auf die BILD-Zeitung vorgestellt.
Der Abschnitt „Uses- and Gratifications Ansatz - Individueller Nutzen der BILD-Zeitung“ beleuchtet die individuellen Bedürfnisse der Leser und stellt den Forschungsansatz des Uses-and-Gratifications-Modells vor. Die Studie von Habicht, die sich mit den Motiven für die Nutzung der BILD-Zeitung auseinandersetzt, wird als Beispiel vorgestellt.
Der Abschnitt „Der Cultural Studies Ansatz“ untersucht die Bedeutung der BILD-Zeitung in der Alltagskultur. Es wird der Forschungsansatz der Cultural Studies erläutert und die Sichtweise auf die Leserschaft als aktive Interpreten von Medieninhalten dargestellt. Die Studie von Brichta, die die BILD-Zeitung aus Sicht ihrer Leserinnen und Leser analysiert, wird als Beispiel vorgestellt.
Der Abschnitt „Unterschiede der verschiedenen Ansätze, die beim Vergleich der Studien deutlich werden“ vergleicht die drei Ansätze hinsichtlich ihrer Perspektiven auf die Leserschaft und die Rolle der BILD-Zeitung. Es werden die Unterschiede in den Forschungsansätzen, den Rezeptionsprozessen und den Leser-Text-Beziehungen herausgestellt.
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Ausblick auf die Entwicklung der Rezeptionsforschung am Beispiel der BILD-Zeitung. Das negative Image der BILD-Zeitung wird innerhalb des Fazits thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Rezeption der BILD-Zeitung, der kritischen Theorie, dem Uses-and-Gratifications-Ansatz, den Cultural Studies, der Kulturindustrie, der Medienrezeption, der Leserschaft, dem Rezeptionsprozess und der Leser-Text-Beziehung. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Perspektiven auf die BILD-Zeitung und ihre Leserschaft und analysiert exemplarische Studien, die sich mit der Rolle der BILD-Zeitung in der Gesellschaft auseinandersetzen.
- Quote paper
- Juliane Fricke (Author), 2012, Rezeptionstheorie: Die Rolle der BILD-Leserschaft aus Sicht der Frankfurter Schule, der Cultural Studies und des Uses-and-Gratification-Ansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307028