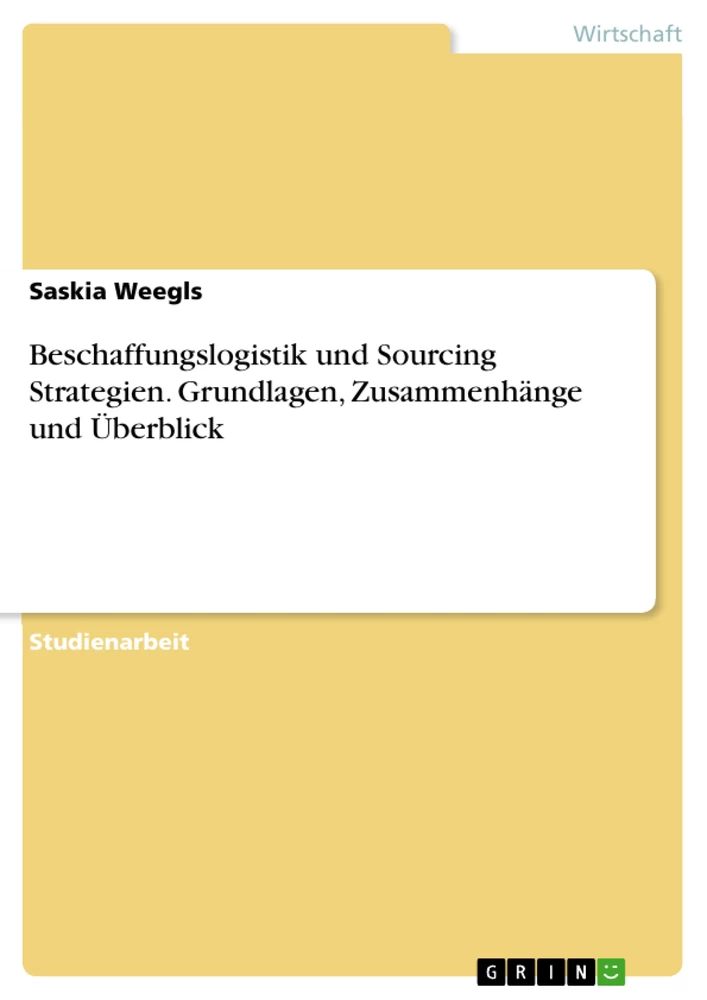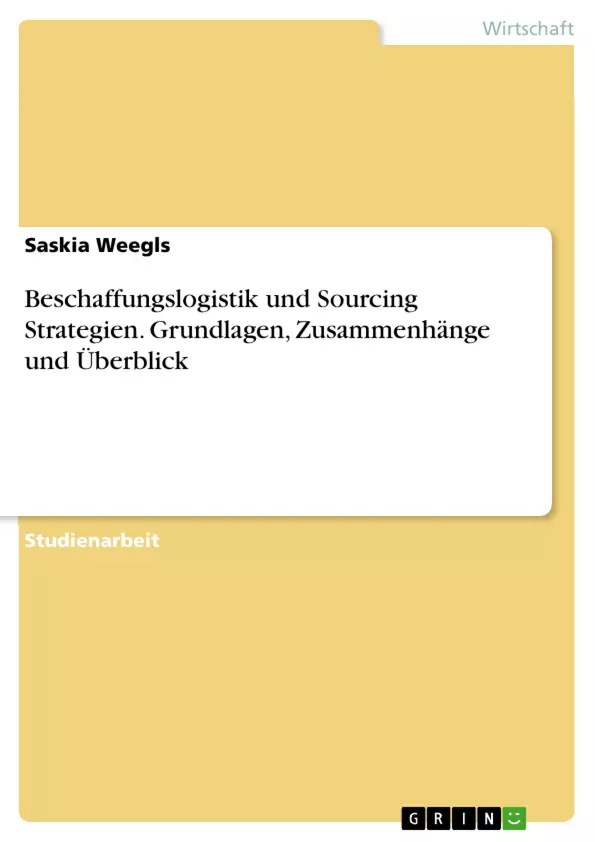Ziel dieser Arbeit soll es sein die Grundlagen der Beschaffungslogistik zu vermitteln und einen Überblick ausgewählter Sourcing-Strategien zu geben. Der Verfasser geht auf einzelne Beschaffungsstrategien ein und stellt einen Zusammenhang zwischen den Sourcing-Strategien her. Aufgrund des geringen Umfangs der Arbeit werden die einzelnen Fachbegriffe nicht bis in die Tiefe behandelt, die Ausführungen dienen als kurzgefasste Zusammenfassung des sehr komplexen Themengebietes „Beschaffungslogistik“.
Der klassische Einkäufer als Besteller und Rechnungsprüfer in seiner Rolle ist heutzutage kaum noch in Unternehmen anzutreffen. Die strategische Komponente gewinnt zunehmend an Bedeutung, so dass selbst in kleinen und mittelständischen Betrieben strategische Einkäufer und Einkaufsmanager anzutreffen sind. Der Vertrieb als „Geldverdiener“ des Unternehmens ist heute nicht mehr alleine für den Erfolg der Unternehmung verantwortlich. Einsparungen bei der Materialbeschaffung bieten eine schnelle und effektive Möglichkeit zur direkten Einflussnahme auf den Gewinn und somit auf den Erfolg der Unternehmung. Da je nach Unternehmen Beschaffungsvolumen und -objekte stark variieren ist die Beschaffung sehr vielfältig, was eine differenzierte Betrachtung diverser Beschaffungsstrategien erfordert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung der Arbeit
- Begriffliche Abgrenzung
- Beschaffungsmanagement
- Beschaffungsobjekte
- Make or Buy
- Sourcing-Konzepte
- Lieferantenstrategie
- Beschaffungsmarktstrategie
- Beschaffungsarealstrategie
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Grundlagen der Beschaffungslogistik zu vermitteln und einen Überblick ausgewählter Sourcing-Strategien zu geben. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Beschaffungsstrategien und stellt einen Zusammenhang zwischen den Sourcing-Strategien her. Der Fokus liegt auf der Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses der Beschaffungslogistik und der verschiedenen Sourcing-Konzepte.
- Beschaffungsmanagement und seine Bedeutung für Unternehmenserfolg
- Sourcing-Strategien und ihre Anwendung in der Praxis
- Die Abgrenzung des Begriffs "Beschaffung" von anderen verwandten Begriffen
- Die Rolle von Kernkompetenzen in der Beschaffungsstrategie
- Die Bedeutung von strategischer Beschaffung für Wettbewerbsvorteile
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Beschaffungslogistik ein und erläutert die zunehmende Bedeutung der strategischen Komponente in der Beschaffung. Das Kapitel "Zielsetzung der Arbeit" gibt einen Überblick über die Themenbereiche, die in der Arbeit behandelt werden. Das Kapitel "Begriffliche Abgrenzung" befasst sich mit der Definition des Begriffs "Beschaffung" und grenzt ihn von anderen verwandten Begriffen ab. Das Kapitel "Beschaffungsmanagement" behandelt die verschiedenen Aspekte des Beschaffungsmanagements, wie zum Beispiel die Beschaffungsobjekte und die "Make or Buy"-Entscheidung. Das Kapitel "Sourcing-Konzepte" stellt verschiedene Sourcing-Strategien vor, wie die Lieferantenstrategie, die Beschaffungsmarktstrategie und die Beschaffungsarealstrategie.
Schlüsselwörter
Beschaffungslogistik, Sourcing-Strategien, Beschaffungsmanagement, Lieferantenstrategie, Beschaffungsmarktstrategie, Beschaffungsarealstrategie, Kernkompetenzen, Wettbewerbsvorteile, Make or Buy, strategische Beschaffung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Sourcing-Strategien in der Beschaffung?
Zu den wichtigsten Konzepten gehören die Lieferantenstrategie, die Beschaffungsmarktstrategie und die Beschaffungsarealstrategie.
Was bedeutet die "Make or Buy"-Entscheidung?
Es ist die strategische Abwägung, ob ein Unternehmen Bauteile oder Dienstleistungen selbst herstellt oder von externen Lieferanten bezieht.
Wie hat sich die Rolle des Einkäufers gewandelt?
Vom klassischen Besteller und Rechnungsprüfer hin zum strategischen Einkaufsmanager, der direkt den Unternehmenserfolg beeinflusst.
Warum ist Beschaffungslogistik heute so wichtig für den Gewinn?
Einsparungen beim Materialeinkauf bieten eine direkte und effektive Möglichkeit, das Betriebsergebnis positiv zu beeinflussen.
Welche Rolle spielen Kernkompetenzen bei der Beschaffung?
Unternehmen konzentrieren sich auf ihre Kernbereiche und lagern andere Prozesse strategisch aus, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Was ist das Ziel der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit?
Sie soll ein grundlegendes Verständnis der Beschaffungslogistik vermitteln und einen Überblick über komplexe Sourcing-Konzepte geben.
- Quote paper
- Saskia Weegls (Author), 2015, Beschaffungslogistik und Sourcing Strategien. Grundlagen, Zusammenhänge und Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307160