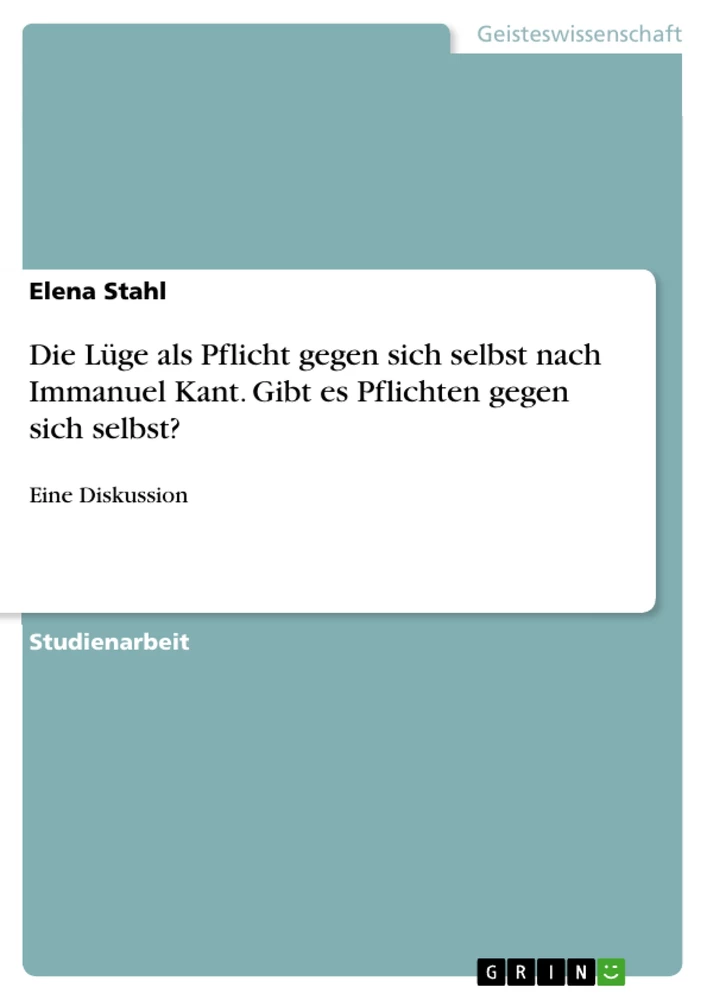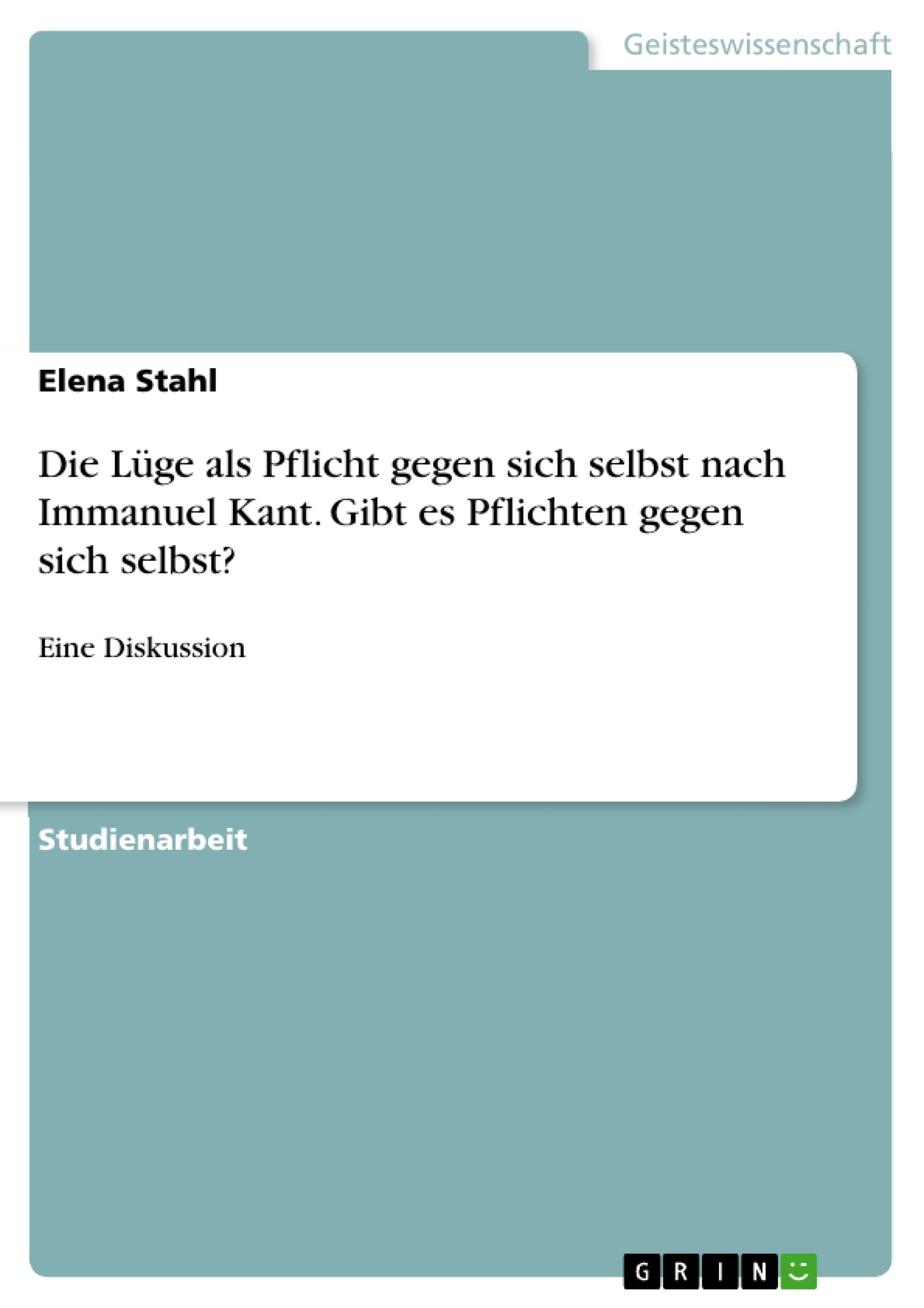Plicht – ein Begriff, mit dem der Mensch täglich konfroniert wird. Doch was ist eigentlich eine Pflicht? Ist der Begriff der Pflicht eindeutig definierbar? Wer verpflichtet sich wem gegenüber zu was? Mit diesen und weiteren Fragen hat sich schon Immanuel Kant in seinem Werk, der "Metaphysik der Sitten" beschäftigt. Das zentrale Thema dieser Arbeit ist es, darzulegen ob und vor allem wie Kant zu der Annahme kommt, dass die Lüge eine Pflicht gegen sich selbst ist.
Hierzu wird hauptsächlich Bezug auf §9 der Tugendlehre der "Metaphysik der Sitten" genommen. Desweiteren werden zwei Interpretationen, zum einen die von Tiedemann, einem Befürworter der Existenz von Pflichten gegen sich selbst, zum anderen die Interpretation von Lohmar, einem Kritiker der Pflicht gegen sich selbst, beigezogen, um zu diskutieren, ob es überhaupt Pflichten gegen sich selbst gibt. Zuletzt wird eine Stellungnahme zu der These, dass es Pflichten gegen sich selbst gibt, gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserläuterung
- Pflicht
- Der kategorische Imperativ
- Der gute Wille
- Die Lüge als Pflicht gegen sich selbst nach §9 aus der Tugendlehre der Metaphysik der Sitten genommen
- Grundlegendes
- Die Pflicht gegen sich selbst
- Das Problem der Widersprüchlichkeit der Pflicht gegen sich selbst
- Wieso ist die Lüge eine Verletzung der Pflicht gegen sich selbst?
- Interpretationsansätze
- Tiedemann - Ja, es gibt Pflichten gegen sich selbst
- Lohmar - Nein, es gibt keine Pflichten gegen sich selbst
- Stellungnahme und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, Kants Auffassung der Lüge als Pflicht gegen sich selbst zu untersuchen, insbesondere im Kontext von §9 der Tugendlehre in der Metaphysik der Sitten. Dazu werden zwei Interpretationen von Tiedemann und Lohmar herangezogen, die sich mit der Existenz von Pflichten gegen sich selbst auseinandersetzen.
- Kants Konzept der Pflicht und des kategorischen Imperativs
- Die Lüge als Verletzung der Pflicht gegen sich selbst
- Das Problem der Widersprüchlichkeit der Pflicht gegen sich selbst
- Die Interpretationen von Tiedemann und Lohmar
- Die Frage nach der Existenz von Pflichten gegen sich selbst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert wichtige Begriffe wie Pflicht, kategorischer Imperativ und guter Wille.
Kapitel 2 analysiert Kants Argumentation zur Lüge als Pflicht gegen sich selbst in §9 der Tugendlehre. Es werden die verschiedenen Aspekte der Pflicht gegen sich selbst beleuchtet, insbesondere das Problem der Widersprüchlichkeit.
Kapitel 3 beleuchtet zwei gegensätzliche Interpretationen von Tiedemann und Lohmar zur Frage nach der Existenz von Pflichten gegen sich selbst.
Schlüsselwörter
Pflicht, kategorischer Imperativ, guter Wille, Lüge, Pflicht gegen sich selbst, Widersprüchlichkeit, Interpretation, Tiedemann, Lohmar, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre.
- Citar trabajo
- Elena Stahl (Autor), 2014, Die Lüge als Pflicht gegen sich selbst nach Immanuel Kant. Gibt es Pflichten gegen sich selbst?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307208