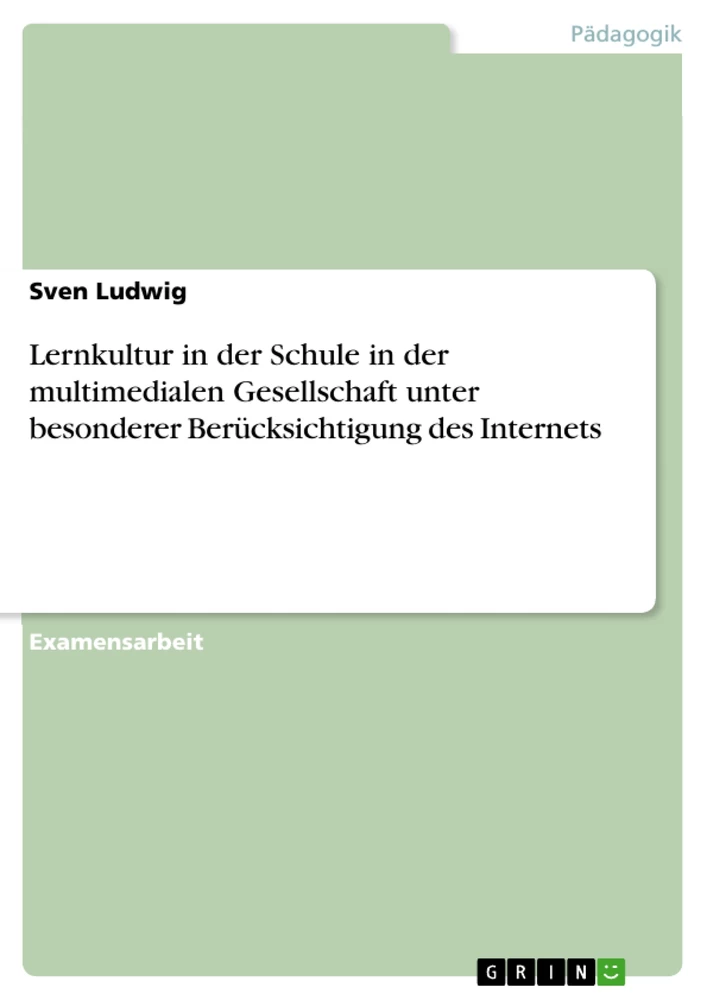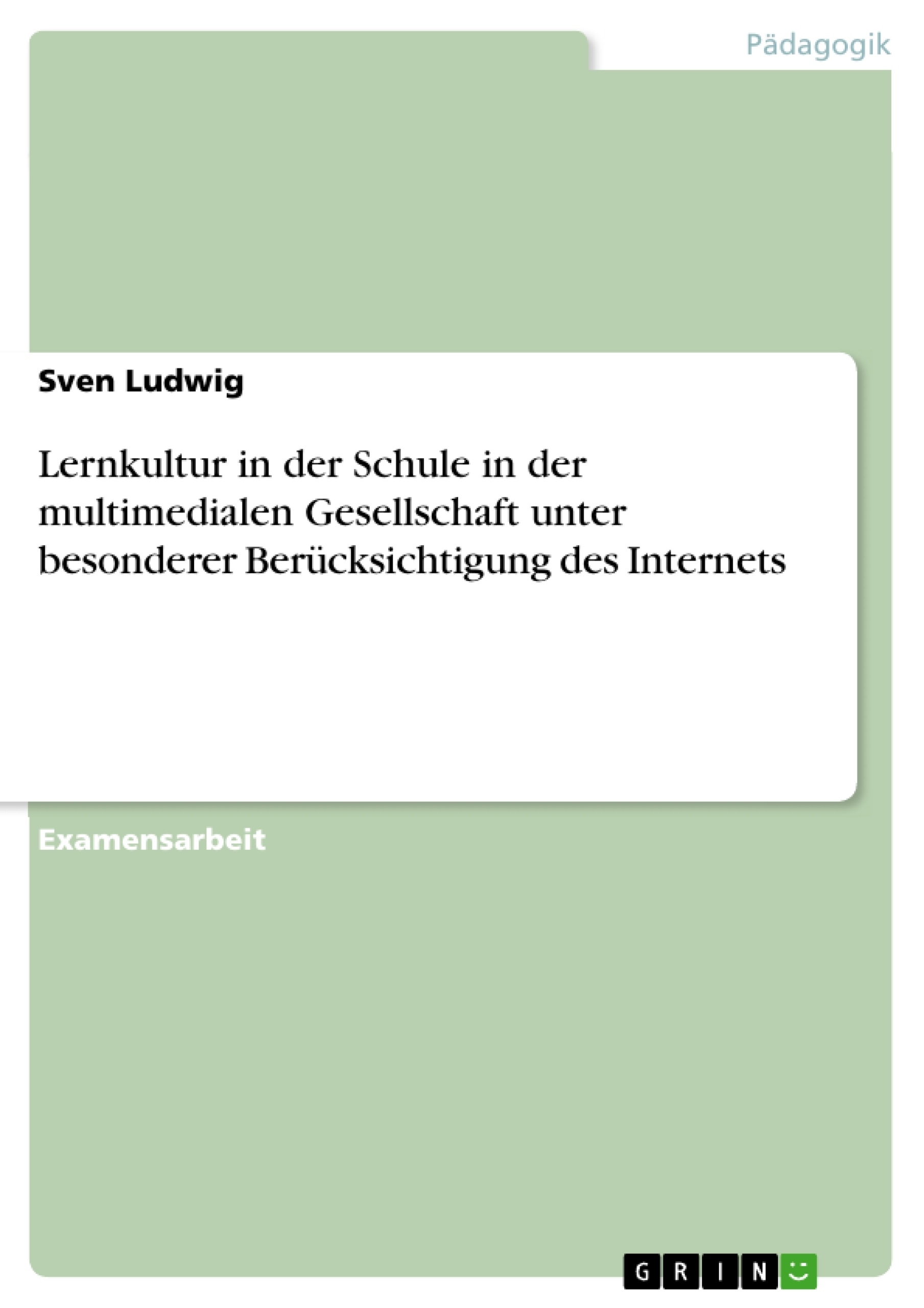Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe. Aus der Einleitung: Unübersehbar haben die sogenannten Neuen Medien Einzug in den Lebensalltag unserer Gesellschaft gehalten. Hat das Fernsehen noch viele Jahre Zeit gebraucht, eroberten die Computer unsere Lebenswirklichkeit in den letzten Jahren in geradezu atemberaubendem Tempo. Da Schule immer auch Antwort auf den vorgegebenen Lebensalltag von Kindern sein muss und zugleich zur Bewältigung dieses Alltags beitragen - erziehen - soll, ist heute die Auseinandersetzung mit den Fragen um den Umgang und Einsatz von PC und Internet an den Schulen unumgänglich. Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag zu dieser Auseinandersetzung leisten. Dabei geht es vor allem um die Beantwortung der Fragen: Welche Auswirkungen haben die neuen Medien auf die Lebenswelt resp. Lebenswirklichkeit der Kinder? Wie weit verändern die neuen Medien das Lernen bzw. die Lernkultur in der Grundschule? Welcher Einsatz neuer Medien ist im Zusammenhang mit dem Erziehungsauftrag von Schule sinnvoll, welcher nicht?...
Inhaltsverzeichnis
- VORBEMERKUNG
- 1. EINLEITUNG
- 2. AUFGABEN UND ZIELE VON GRUNDSCHULE HEUTE
- 2.1 Der Bildungsauftrag der '70-er versus dem Bildungsauftrag der '80-er Jahre
- 2.2 Erwartungen an Grundschule heute
- 2.3 Der Bildungs- und Erziehungsauftrag in den Richtlinien für die Grundschule
- 3. KINDER IN EINER MULTIMEDIALEN GESELLSCHAFT
- 3.1 Veränderungen in der Gesellschaft
- 3.2 Veränderungen in der Familie - Pluralisierung von Lebensformen
- 3.2.1 Kinder in Kleinfamilien
- 3.2.2 Kinder in alleinerziehenden Familien sowie Stieffamilien
- 3.3 Arbeitsgesellschaft versus Tätigkeitsgesellschaft
- 3.4 Bedeutung der Freizeit für die Gesellschaft
- 3.5 Größere Freiheit durch moderne Erziehungsstile ?
- 3.6 Veränderungen in der Raum- und Zeiterfahrung
- 3.7 Veränderungen durch die Medienwelt
- 3.8 Veränderte Kindheit
- 4. LERNKULTUR IM MULTIMEDIALEN ZEITALTER
- 4.1 Definition Lernkultur
- 4.2 Möglichkeiten für die Organisation von Unterricht und Lernen
- 4.2.1 Tradierte Form der Lernkultur
- 4.2.1.1 Traditionelle Lehr- und Lernformen
- 4.2.2 Lernkultur der Zukunft
- 4.2.2.1 Offene Lehr- und Lernformen
- 4.2.2.2 Die Rolle des Lehrers
- 4.2.2.3 Die Rolle der Schüler
- 4.2.3 Offener Unterricht
- 4.3 Die (neue) Rolle des Frontalunterrichts in einer neuen Lernkultur
- 4.4 Die Rolle der neuen Medien in einer neuen Lernkultur
- 5. SYSTEMISCH-KONSTRUKTIVISTISCHE VERSUS BEHAVIORISTISCHE PÄDAGOGIK
- 5.1 Behavioristische Lerntheorie
- 5.1.1 Klassisches Konditionieren
- 5.1.2 Operantes Konditionieren
- 5.2 Konstruktivistische Lerntheorie
- 5.2.1 Konstruktion
- 5.2.2 Rekonstruktion
- 5.2.3 Dekonstruktion
- 5.3 Form einer konstruktivistischen Didaktik
- 6. NEUE MEDIEN IM UNTERRICHT DER PRIMARSTUFE
- 6.1 Medienkompetenz und Medienpädagogik
- 6.2 Computer in der Grundschule
- 6.2.1 Einsatzmöglichkeiten des Computers im Unterricht der Grundschule
- 6.2.1.1 Schreiben und Publizieren mit dem Computer
- 6.2.1.2 Lernsoftware
- 6.2.1.3 Binnendifferenziertes Lernen durch den Einsatz des Computers
- 6.2.1.4 Motivation
- 6.2.2 Standort des Computers in der Schule
- 6.2.3 Chancen und Risiken des Computereinsatzes
- 6.2.4 Vorteile des Computereinsatzes für den Lehrer
- 6.3 Internet in der Grundschule
- 6.3.1 Geschichte des Internets
- 6.3.2 Das Internet und seine Werkzeuge
- 6.3.2.1 Informieren durch das Internet
- 6.3.2.2 Kommunizieren über das Internet
- 6.3.2.3 Präsentieren im Internet
- 6.3.3 Einsatzmöglichkeiten des Internets in der Lehr- Lernorganisation der Grundschule
- 6.3.3.1 Das Internet im Wochenplanunterricht
- 6.3.3.2 Das Internet im Werkstattunterricht
- 6.3.3.3 Das Internet im Projektunterricht
- 6.3.3.4 Einführung in das Internet und die Gestaltung einer Homepage mit einer vierten Klasse - Lernen über das Internet
- 6.3.3.5 Eine internetgestützte Unterrichtseinheit - Lernen mit dem Internet
- 7. DIE VIRTUELLE SCHULE - UTOPIE ODER GREIFBARE REALITÄT?
- 7.1 Was ist eine virtuelle Schule ?
- 7.2 Virtuelle Schulen und Klassenzimmer
- 7.2.1 Virtuelle Klassenzimmer
- 7.2.2 Die Spiegelschule
- 7.2.3 Die ,Virtuelle Schule I & III' - Lernen im Internet
- 7.2.4 Die Fernuniversität Hagen
- 7.3 Die zukünftige Rolle der Lehrer im Computer und Internetzeitalter- Wird der Beruf des Lehrers überflüssig ?
- Veränderungen in der Gesellschaft und deren Einfluss auf die Lernkultur
- Die Rolle neuer Medien, insbesondere des Internets, im Unterricht
- Die Bedeutung von Medienkompetenz und Medienpädagogik in der Grundschule
- Die Entwicklung von Lernformen und der Rolle des Lehrers in der digitalen Welt
- Die Herausforderungen und Chancen der virtuellen Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Lernkultur in der Schule in der multimedialen Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung des Internets. Sie analysiert, wie sich die veränderte Gesellschaft, insbesondere die Medienwelt, auf das Lernen in der Grundschule auswirkt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Lernkultur in der multimedialen Gesellschaft unterstreicht. Im zweiten Kapitel werden die Aufgaben und Ziele der Grundschule heute betrachtet, wobei der Bildungsauftrag der '70-er und '80-er Jahre sowie die aktuellen Erwartungen an die Grundschule im Fokus stehen.
Kapitel 3 analysiert die Veränderungen in der Gesellschaft, die sich auf Kinder und ihre Lebenswelt auswirken. Es werden Themen wie die Pluralisierung von Lebensformen, die Arbeitsgesellschaft, die Bedeutung der Freizeit und die veränderte Raum- und Zeiterfahrung behandelt.
Kapitel 4 widmet sich dem Thema Lernkultur im multimedialen Zeitalter. Es werden verschiedene Möglichkeiten für die Organisation von Unterricht und Lernen vorgestellt, wobei tradierte und innovative Lernformen sowie die Rolle von Lehrern und Schülern in einer neuen Lernkultur im Vordergrund stehen.
Kapitel 5 beleuchtet die systemisch-konstruktivistische und die behavioristische Pädagogik. Die Hausarbeit vergleicht die beiden Lerntheorien und analysiert ihre Relevanz für den Unterricht in der digitalen Welt.
Kapitel 6 befasst sich mit dem Einsatz neuer Medien im Unterricht der Primarstufe. Es werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten des Computers und des Internets im Unterricht der Grundschule vorgestellt, sowie Chancen und Risiken des Medieneinsatzes betrachtet.
Schlüsselwörter
Lernkultur, multimediale Gesellschaft, Internet, Grundschule, Bildungsauftrag, neue Medien, Medienkompetenz, Medienpädagogik, virtuelle Schule, Lerntheorie, behavioristische Pädagogik, konstruktivistische Pädagogik, Unterricht, digitale Welt, Chancen und Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändern neue Medien das Lernen in der Grundschule?
Neue Medien ermöglichen offenere Lehr- und Lernformen. Das Lernen wird individueller, motivierender und ermöglicht den Schülern, Informationen selbstständig zu recherchieren und aufzubereiten.
Was versteht man unter einer konstruktivistischen Lernkultur?
Im Konstruktivismus wird Lernen als aktiver Prozess gesehen, bei dem Schüler Wissen nicht passiv aufnehmen, sondern auf Basis ihrer Erfahrungen selbst konstruieren. Der Lehrer wird dabei zum Lernbegleiter.
Welche Rolle spielt das Internet im Unterricht?
Das Internet dient als riesiges Informationsarchiv, als Kommunikationsmittel (E-Mail, Projekte) und als Plattform zur Präsentation eigener Ergebnisse (z.B. Klassen-Homepage).
Was ist Medienkompetenz in der Primarstufe?
Medienkompetenz bedeutet, Medien kritisch zu hinterfragen, sie sicher zu bedienen, Informationen zu bewerten und die Auswirkungen des eigenen Medienkonsums zu verstehen.
Wird der Lehrer durch Computer überflüssig?
Nein, die Rolle des Lehrers wandelt sich vom Wissensvermittler zum Moderator und Berater. Er hilft den Schülern, sich in der Informationsflut zurechtzufinden und soziale Kompetenzen im Umgang mit Technik zu entwickeln.
Was sind Chancen und Risiken des Computereinsatzes bei Kindern?
Chancen liegen in der hohen Motivation und individuellen Förderung. Risiken sind die Reizüberflutung, möglicher Bewegungsmangel und der Zugang zu nicht kindgerechten Inhalten.
- Quote paper
- Sven Ludwig (Author), 2000, Lernkultur in der Schule in der multimedialen Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung des Internets, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3072