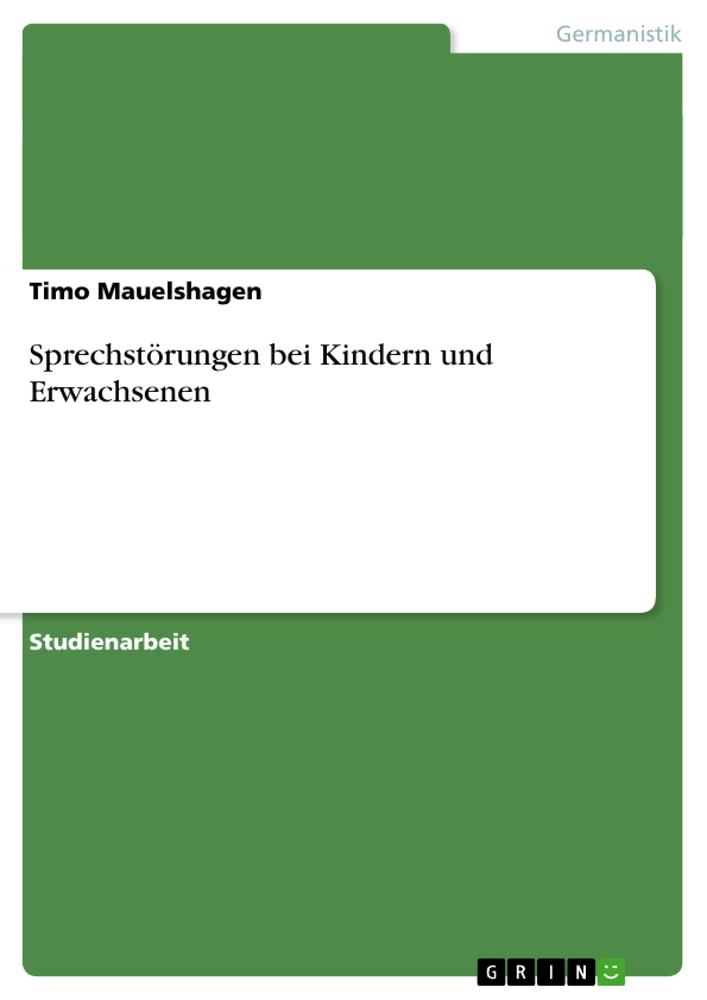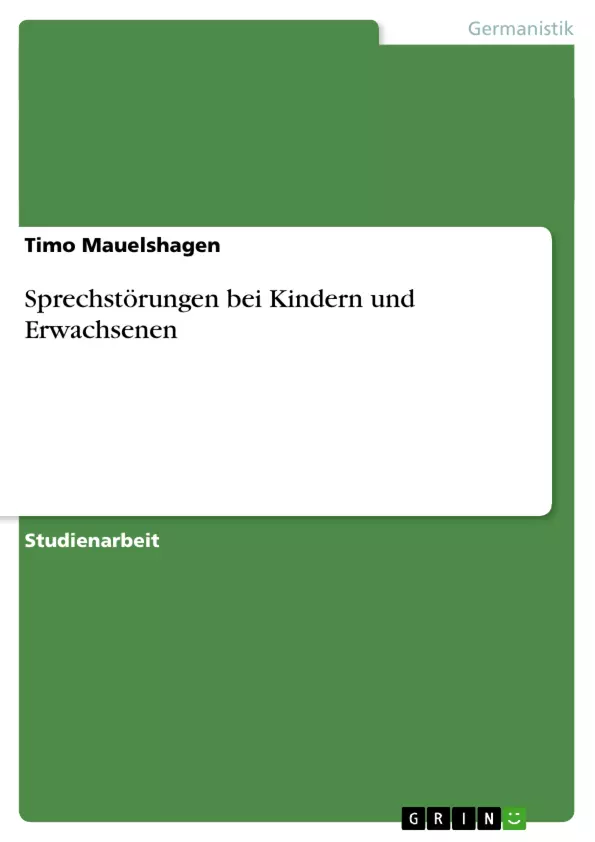Das menschliche Sprechen ist ein äußerst komplexer Vorgang, an dem etwa hundert
Muskeln beteiligt sind, die wiederum von etwa hundert motorischen Einheiten
gebildet werden.1 Ausgehend vom Gehirn werden diese verschiedenen Muskeln in
einer genauen Zeitabfolge aktiviert und koordiniert.
Bei einer normalen Entwicklung entstehen eine sehr differenzierte Abstimmung der
zahlreichen motorischen Abläufe und eine präzise Koordination verschiedener
Bewegungsakte. Die Sprechwerkzeuge – Kehlkopf, Zunge, Kiefer, Gaumensegel,
etc. – werden somit in einem hochgradig verzahnten Prozess gesteuert.
Entsteht jedoch innerhalb dieser hochempfindlichen Koordinationsvorgänge auch nur
eine minimale Störung, so kann es „zu teilweise massiven Behinderungen im
Sprechvorgang führen“2, die der Umgebung der betroffenen Person sofort auffallen.
Derartige Beeinträchtigungen oder Veränderungen des normalen Sprechablaufs
werden in der Fachwissenschaft unter dem Begriff “Sprechstörungen“ behandelt,
wobei Dysathrien neben Sprechapraxien zu den ´zentralbedingten` Störungen
gezählt werden. Daneben tauchen aber immer wieder weitere Formen und
Definitionen von Sprechstörungen auf. [...]
1 Vgl. Grohnfeldt, Manfred. Zentrale Sprach und Sprechstörungen. Bd. 6. Berlin 1993. S.389
2 Zitiert nach: Grohnfeldt, Manfred. Zentrale Sprach und Sprechstörungen. Bd. 6. Be rlin 1993. S.389
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprechstörungen
- 2.1 Was ist gemeint? Eine Definition
- 2.2 Erworbene Sprechstörungen vs. Sprechstörungen in der Entwicklung
- 3. Erwachsene und Kinder
- 3.1 Sprechstörungen bei Erwachsenen
- 3.1.1 Die Dysathrie
- 3.1.2 Die Sprechapraxie
- 3.2 Sprechstörungen bei Kindern
- 3.2.1 Risikofaktoren und Therapie
- 3.2.2 Kindliche Sprechstörungen
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung zielt darauf ab, das komplexe Feld der Sprechstörungen bei Kindern und Erwachsenen zu beleuchten. Sie untersucht verschiedene Definitionen und Terminologien, wobei die Unschärfen in der Fachliteratur berücksichtigt werden. Die Arbeit fokussiert auf die wichtigsten Sprechstörungstypen und skizziert mögliche Therapieansätze.
- Definition und Abgrenzung von Sprech- und Sprachstörungen
- Unterscheidung zwischen erworbenen Sprechstörungen und Sprechstörungen in der Entwicklung
- Sprechstörungen im Kindesalter: Risikofaktoren und Therapie
- Sprechstörungen im Erwachsenenalter: Dysarthrie und Sprechapraxie als Beispiele
- Vielfalt der Terminologie und Definitionen von Sprechstörungen in der Fachliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das komplexe Zusammenspiel von Muskeln und motorischen Einheiten beim Sprechen und wie selbst minimale Störungen zu erheblichen Sprechbeeinträchtigungen führen können. Der Begriff "Sprechstörung" wird eingeführt, und die Arbeit kündigt eine differenzierte Betrachtung von Sprechstörungen bei Kindern und Erwachsenen an, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fachterminologien. Die Einleitung legt den Fokus auf die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
2. Sprechstörungen: Dieses Kapitel definiert Sprechstörungen als Beeinträchtigungen der Lautbildungsmotorik, die verschiedene Aspekte des Sprechens betreffen können, von einzelnen Lauten bis zur Flüssigkeit des Redeflusses. Es wird klar zwischen Sprech- und Sprachstörungen unterschieden, wobei betont wird, dass eine Sprechstörung nicht zwangsläufig eine Sprachstörung impliziert. Der Abschnitt beleuchtet die Uneinheitlichkeit der Fachterminologie und den zweideutigen Gebrauch des Begriffs "Sprechen".
2.2 Erworbene Sprechstörungen vs. Sprechstörungen in der Entwicklung: Hier wird die Unterscheidung zwischen erworbenen Sprechstörungen (nach normaler Sprechentwicklung) und Sprechstörungen in der Entwicklung (bereits während der Entwicklung auftretend) erläutert. Es wird hervorgehoben, dass erworbene Sprechstörungen nicht auf Erwachsene beschränkt sind und auch bei Kindern auftreten können (z.B. nach Unfällen).
3. Erwachsene und Kinder: Dieses Kapitel gliedert die Betrachtung von Sprechstörungen nach Altersgruppen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Fachliteratur auch innerhalb der einzelnen Sprechstörungstypen weiter differenziert. Die folgenden Unterkapitel (3.1 und 3.2) werden als Überblick über die wichtigsten Sprechstörungen bei Erwachsenen (Dysarthrie und Sprechapraxie) und Kindern angekündigt, wobei auch Therapieansätze kurz erwähnt werden.
Schlüsselwörter
Sprechstörungen, Sprachstörungen, Dysarthrie, Sprechapraxie, kindliche Sprechstörungen, erworbene Sprechstörungen, Sprechentwicklung, Therapie, Logopädie, Lautbildungsmotorik, Definitionen, Terminologie.
Häufig gestellte Fragen zu "Sprechstörungen bei Kindern und Erwachsenen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Sprechstörungen bei Kindern und Erwachsenen. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition und Abgrenzung von Sprech- und Sprachstörungen, der Unterscheidung zwischen erworbenen und entwicklungsbedingten Sprechstörungen, sowie der Betrachtung wichtiger Sprechstörungstypen wie Dysarthrie und Sprechapraxie bei Erwachsenen und Kindern, einschließlich möglicher Therapieansätze. Die Arbeit berücksichtigt auch die Unschärfen und die Vielfalt der Terminologie in der Fachliteratur.
Welche Sprechstörungstypen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl erworbene als auch entwicklungsbedingte Sprechstörungen. Im Detail werden die Dysarthrie und die Sprechapraxie bei Erwachsenen und kindliche Sprechstörungen im Allgemeinen diskutiert. Es wird jedoch betont, dass die Fachliteratur innerhalb dieser Kategorien weitere Differenzierungen vornimmt.
Wie wird zwischen Sprech- und Sprachstörungen unterschieden?
Die Arbeit betont die klare Unterscheidung zwischen Sprech- und Sprachstörungen. Eine Sprechstörung betrifft die Lautbildungsmotorik und kann verschiedene Aspekte des Sprechens betreffen (z.B. einzelne Laute, Redefluss). Eine Sprechstörung impliziert nicht automatisch eine Sprachstörung.
Was ist der Unterschied zwischen erworbenen und entwicklungsbedingten Sprechstörungen?
Erworbene Sprechstörungen treten nach einer normalen Sprechentwicklung auf (z.B. nach Unfällen oder Erkrankungen), während Sprechstörungen in der Entwicklung bereits während der Sprachentwicklung auftreten. Die Arbeit hebt hervor, dass erworbene Sprechstörungen nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern vorkommen können.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das komplexe Feld der Sprechstörungen bei Kindern und Erwachsenen zu beleuchten, verschiedene Definitionen und Terminologien zu untersuchen und die wichtigsten Sprechstörungstypen mit möglichen Therapieansätzen zu skizzieren. Dabei wird die Unschärfe in der Fachliteratur berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sprechstörungen, Sprachstörungen, Dysarthrie, Sprechapraxie, kindliche Sprechstörungen, erworbene Sprechstörungen, Sprechentwicklung, Therapie, Logopädie, Lautbildungsmotorik, Definitionen, Terminologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über Sprechstörungen (inklusive der Unterscheidung zwischen erworbenen und entwicklungsbedingten Störungen), ein Kapitel über Sprechstörungen bei Erwachsenen und Kindern (mit Unterkapiteln zu Dysarthrie, Sprechapraxie und kindlichen Sprechstörungen) und einen Schluss.
Werden Therapieansätze behandelt?
Ja, die Arbeit erwähnt kurz mögliche Therapieansätze für Sprechstörungen bei Kindern und Erwachsenen, ohne jedoch detailliert auf spezifische Therapiemethoden einzugehen.
- Citation du texte
- Timo Mauelshagen (Auteur), 2004, Sprechstörungen bei Kindern und Erwachsenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30764