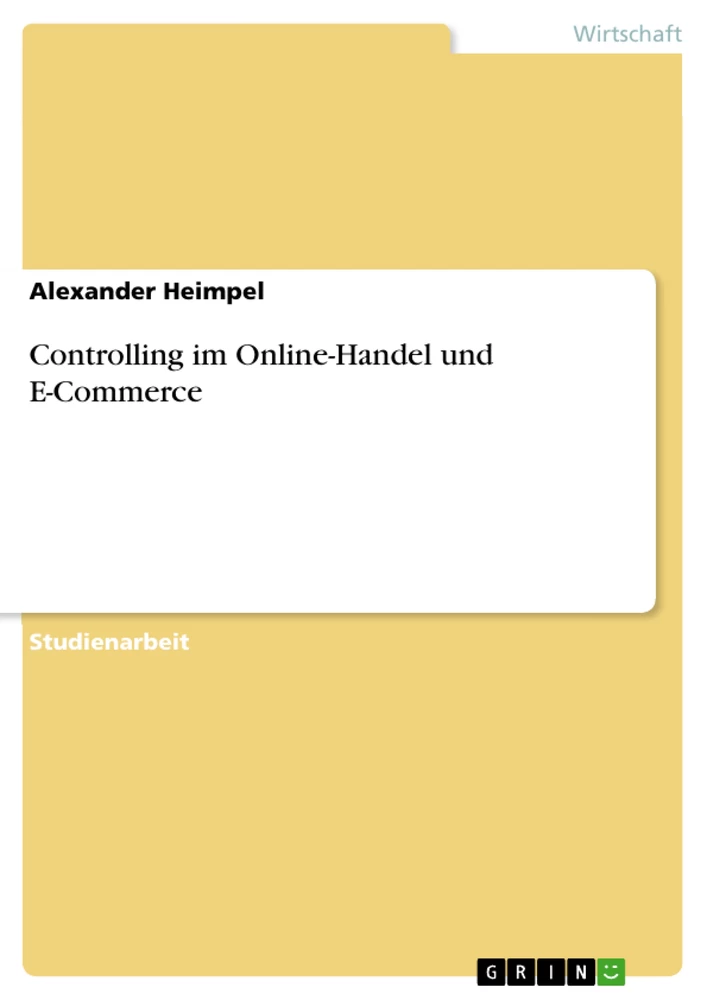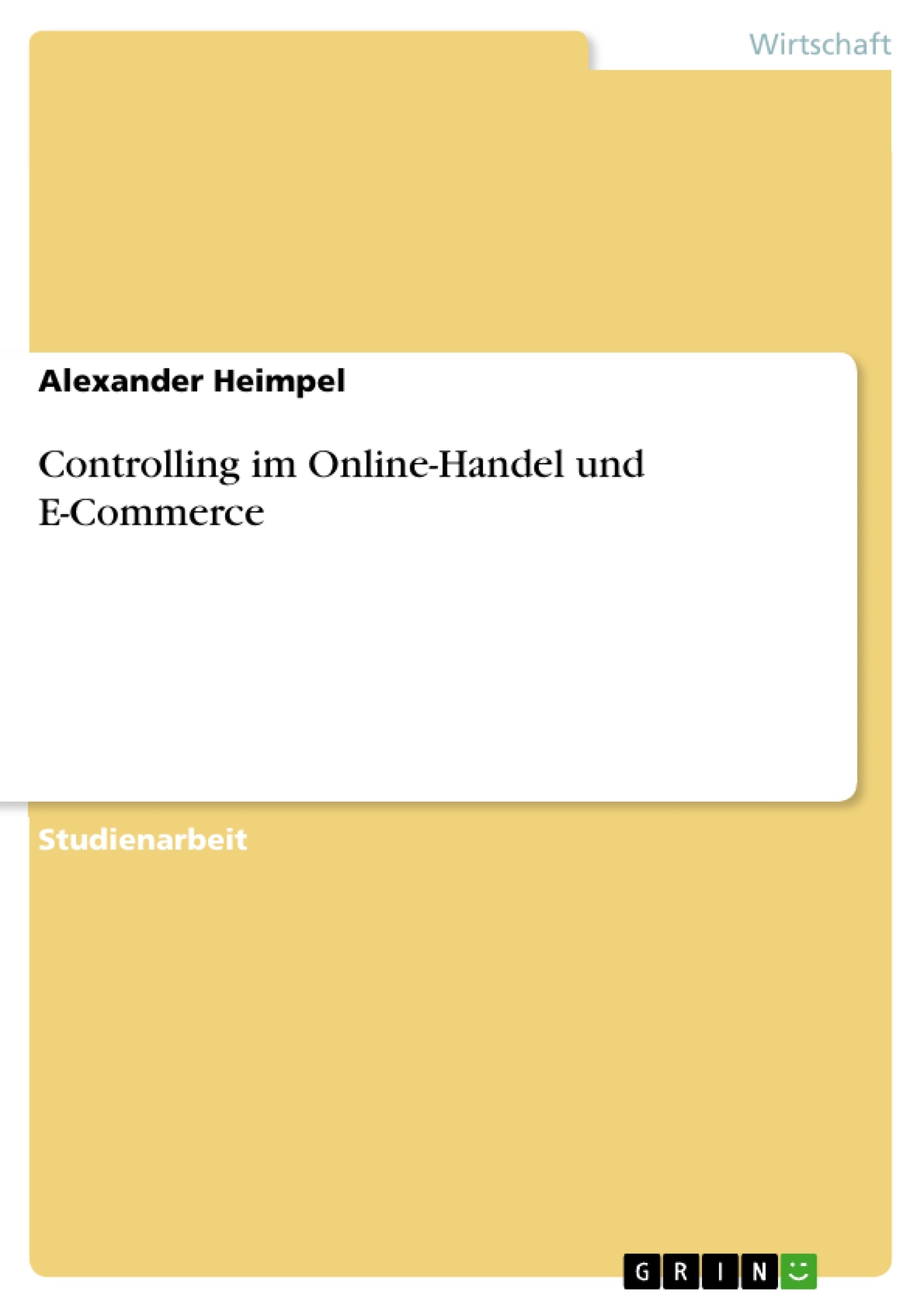Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über Controlling im Online Handel zu schaffen. Hierfür werden einzelne Schwerpunkte des Web-Controllings näher erläutert. Das Internet hat als Vertriebskanal in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zugenommen. Das Controlling, speziell Web-Controlling spielt hier eine entscheidende Rolle, denn es liefert alle relevanten Tools um den Erfolg von Maßnahmen systematisch auszuwerten.
Um dem Thema gerecht zu werden wird in Kapitel 1 eine kurze Einführung in das Thema gegeben, wobei das Ziel der Arbeit und die Vorgehensweise beschrieben werden. Kapitel 2 beinhaltet eine Definition des Begriffs Web-Controlling. Kapitel 3 beschreibt die Informationsquellen für das Web-Controlling. In Kapitel 4 folgt eine Vorstellung des Web-Controlling-Regelkreises. Auf die Kennzahlen im Web-Controlling wird in Kapitel 5 näher eingegangen, darüber hinaus wird das Reifegradmodell erklärt. Darauf folgend wird in Kapitel 6 der Kundenwert behandelt. Kapitel 7 gibt einen Überblick über das Online Marketing. Ein Hauptaugenmerk liegt hier auf dem SEA, am Beispiel von Google AdWords und auf der SEO. In Kapitel 8 erfolgt eine Erläuterung zum Thema Zahlungsverfahren im Online-Handel, gefolgt von Kapitel 9, dass sich mit den Verfahren zur Datensammlung beschäftigt und in dem insbesondere auf die Logfile-Analyse und auf das Zählpixel-Verfahren näher eingegangen wird. Den Abschluss der Arbeit bildet in Kapitel 10 ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Definition Web-Controlling
- 3 Informationsquellen für das Web-Controlling
- 4 Web-Controlling-Regelkreis
- 5 Kennzahlen im Web-Controlling
- 5.1 Reifegradmodell
- 5.1.1 Stufe D: Information
- 5.1.2 Stufe C: Kommunikation
- 5.1.3 Stufe B: Transaktion
- 5.1.4 Stufe A: Integration
- 5.2 Konversionsrate
- 5.2.1 Definition Konversionsrate
- 5.2.2 Konversionstrichter
- 5.1 Reifegradmodell
- 6 Kundenwert
- 6.1 Bedeutung Kundenwert
- 6.2 ABC-Analyse
- 7 Online Marketing
- 7.1 SEA am Beispiel von Google AdWords
- 7.2 SEO
- 8 Zahlungsverfahren
- 9 Verfahren zur Datensammlung
- 9.1 Logfile-Analyse
- 9.2 Zählpixel-Verfahren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über Controlling im Online-Handel zu bieten. Sie soll das Web-Controlling als ein Werkzeug zur systematischen Erfolgsmessung im E-Commerce präsentieren.
- Definition und Bedeutung des Web-Controllings
- Wichtige Informationsquellen für das Web-Controlling
- Der Web-Controlling-Regelkreis
- Kennzahlen und Reifegradmodell im Web-Controlling
- Der Kundenwert und seine Bedeutung im Online-Handel
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Thema Controlling im Online-Handel und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Definition Web-Controlling: In diesem Kapitel wird der Begriff Web-Controlling definiert und seine Bedeutung im Kontext von Online-Handel beleuchtet.
- Kapitel 3: Informationsquellen für das Web-Controlling: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Quellen, aus denen Informationen für das Web-Controlling gewonnen werden können.
- Kapitel 4: Web-Controlling-Regelkreis: Hier wird der Web-Controlling-Regelkreis als ein systematisches Instrument zur Steuerung und Verbesserung von Online-Geschäftsprozessen vorgestellt.
- Kapitel 5: Kennzahlen im Web-Controlling: Dieses Kapitel behandelt die wichtigsten Kennzahlen im Web-Controlling und erklärt das Reifegradmodell, das die Entwicklung des Web-Controllings in einem Unternehmen widerspiegelt.
- Kapitel 6: Kundenwert: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Kundenwerts im Online-Handel und stellt die ABC-Analyse als Instrument zur Kundenklassifizierung vor.
- Kapitel 7: Online Marketing: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen Instrumente des Online-Marketings, mit einem Schwerpunkt auf SEA (Search Engine Advertising) am Beispiel von Google AdWords und SEO (Search Engine Optimization).
- Kapitel 8: Zahlungsverfahren: Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Zahlungsverfahren, die im Online-Handel zur Verfügung stehen.
- Kapitel 9: Verfahren zur Datensammlung: Dieses Kapitel behandelt die wichtigsten Verfahren zur Datensammlung im Online-Handel, insbesondere die Logfile-Analyse und das Zählpixel-Verfahren.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen dieser Arbeit sind: Web-Controlling, Online-Handel, E-Commerce, Kennzahlen, Reifegradmodell, Konversionsrate, Kundenwert, Online Marketing, SEA, SEO, Zahlungsverfahren, Datensammlung, Logfile-Analyse, Zählpixel-Verfahren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Web-Controlling im Online-Handel?
Web-Controlling umfasst die Sammlung und Auswertung von Daten über das Nutzerverhalten auf Webseiten, um den Erfolg von Marketingmaßnahmen systematisch zu messen und zu steuern.
Was misst die Konversionsrate (Conversion Rate)?
Die Konversionsrate gibt an, wie viel Prozent der Besucher einer Webseite eine gewünschte Aktion (z. B. einen Kauf) tatsächlich ausführen.
Welche Rolle spielt der Kundenwert im E-Commerce?
Der Kundenwert hilft Unternehmen, Kunden mittels ABC-Analyse zu klassifizieren und Marketingressourcen effizient auf die profitabelsten Kundengruppen zu verteilen.
Was ist der Unterschied zwischen Logfile-Analyse und Zählpixel-Verfahren?
Die Logfile-Analyse wertet Server-Protokolle aus, während das Zählpixel-Verfahren (Tagging) Daten direkt im Browser des Nutzers erhebt, was oft präzisere Echtzeitdaten liefert.
Wie unterstützt Controlling das Online-Marketing (SEA/SEO)?
Controlling liefert Kennzahlen für Search Engine Advertising (z. B. Google AdWords) und SEO, um die Sichtbarkeit und Rentabilität von Kampagnen zu optimieren.
- Quote paper
- Alexander Heimpel (Author), 2015, Controlling im Online-Handel und E-Commerce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307684