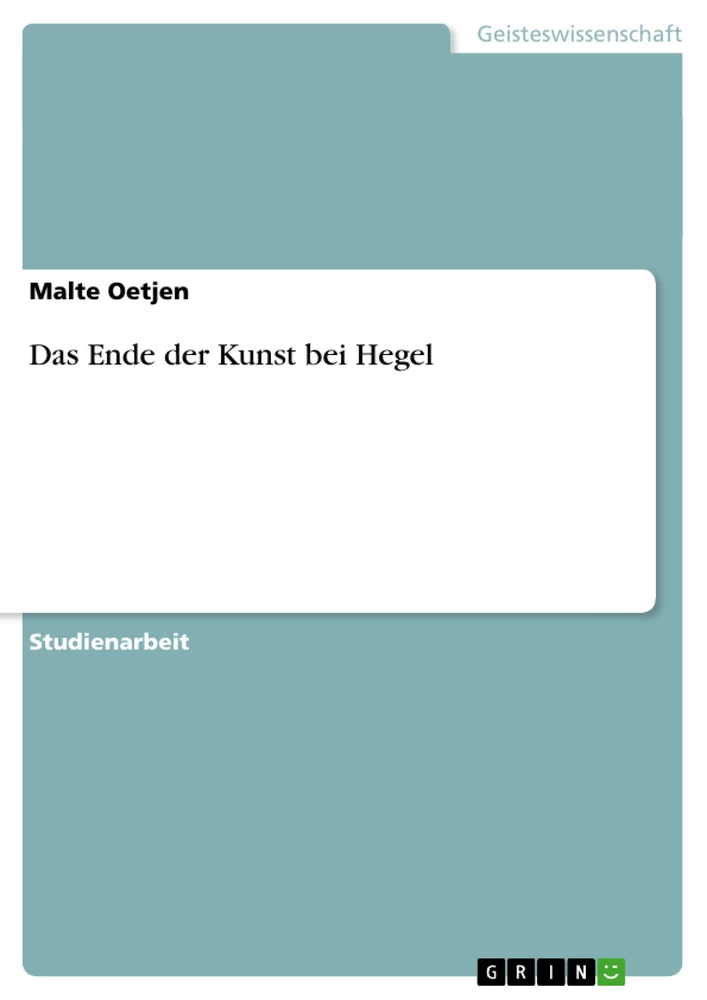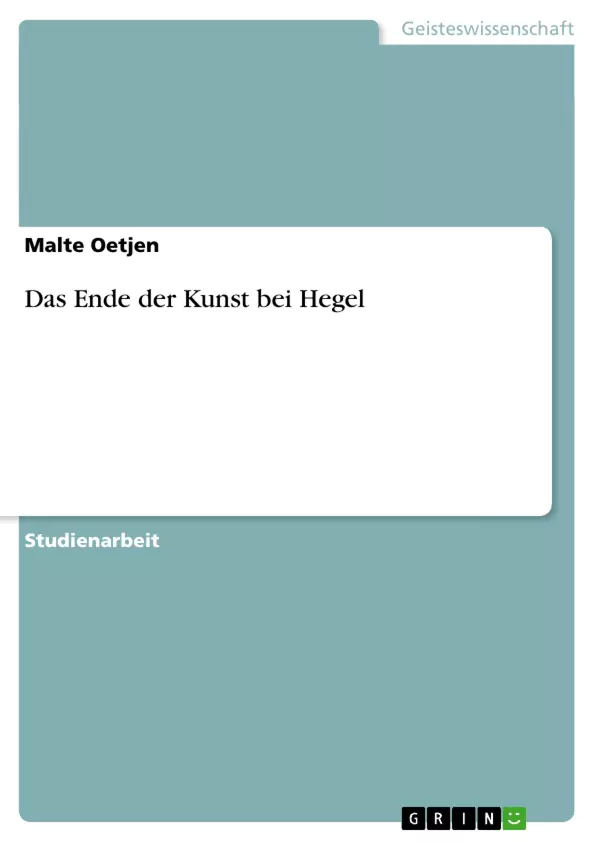Einleitung – Hegels »Ästhetik« im Aufriß
Hegels Vorlesungen über die Ästhetik, zumindest so, wie sie durch Hothos Mitschriften und Bearbeitungen überliefert wurden, liegt eingangs die Fragestellung zugrunde, „[...] was das Schöne überhaupt ist und wie es sich im Vorhandenen, in Kunstwerken [...]“ gezeigt hat. Als Antwort auf diese Frage begründet Hegel im Entfaltungsgang seiner systematischen Theorie, warum die Kunst neben der Religion und der Philosophie zu jenen Formen zu zählen sei, die es dem Geist des Menschen ermöglichten, zu einem Erkennen und Bewußtsein seiner selbst zu gelangen. Denn, um Hegels Auffassung vom Wesen der Kunst und ihre Deduktion aus dem Begriff des Geistes mit den Worten Hans-Georg Gadamers in nuce zusammenzufassen, in „[...] der Kunst begegnet sich der Mensch selbst, Geist dem Geiste“. In der Entäußerung des Geistes zum sinnlich Konkreten, zum Kunstwerk hin, wird sich der Geist nämlich nicht etwa selber untreu, so Hegel sinngemäß, sondern der Geist geht vollkommen in den entgegengesetzten Zustand seiner selbst, in das Kunstwerk, über und wird in und an ihm für sich selber gegenständlich. Er kann sich demnach in der von ihm geschaffenen Entgegensetzung seiner selbst betrachten und sich dergestalt auch in der Entäußerung zur Empfindung und Sinnlichkeit hin (wieder-)erkennen und begreifen, wodurch er schließlich eine neue und mithin höhere Stufe seines Bewußtseins erlangt. Insofern manifestiert sich für Hegel im Kunstwerk „[...] nichts bloß Sinnliches, sondern der Geist als im Sinnlichen erscheinend“. Und die Kunst hat deshalb keine geringere Aufgabe, als die Idee, das heißt, den abstrakten Begriff des Geistes in ungeschiedener Einheit mit seinen Besonderungen als verwirklicht und in die Realität hineingestellt, für die unmittelbare Anschauung in sinnlich konkreter und der Idee gemäßer Gestalt darzustellen.
Durch diese aus dem Begriff des Geistes hergeleitete Auffassung vom Wesen der Kunst und des Schönen ist es Hegel in seiner »Ästhetik« gelungen, den Wahrheitsanspruch der Kunst grundsätzlich zu legitimieren. Und im Gegensatz zu Kant, beispielsweise, der das Gefühl des Schönen als „interessenloses Wohlgefallen“ definiert und den Gegenstand eines solchen Interesses schön heißt, ohne daß etwas von ihm erkannt wird, ist die Kunst für Hegel ein Medium, in dem sich menschliche Selbsterkenntnis vollzieht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Hegels »Ästhetik«< im Aufriẞ.
- 2. Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes - Ziele dieser Arbeit.
- 3. Philosophiegeschichtliche Voraussetzungen.
- 3.1. Platon stellt die zentrale Frage: Was ist das Schöne an sich?.
- 3.2. Warum ist Platon bemüht, die Vielgestaltigkeit und Vielheit der Dinge in abstrakter Einheit zusammenzufassen?
- 3.3. Das Dilemma der Metaphysik: Die Ideen existieren losgelöst von dem, wovon sie Ideen sind.
- 3.4. Die,Lösung' der Frage, wie sich das Einzelne zur Idee verhält.
- 3.5. Die besondere Stellung der Idee des Schönen – sie schlägt eine Brücke zwischen der Ideenwelt und dem Erfahr- und sinnlich Wahrnehmbaren.
- 3.6. Widersprüchlichkeiten lassen erkennen, daß es zum Sein des Schönen gehört, sich als Schein zu zeigen.........
- 3.7. Platons Verständnis vom Wesen der Kunst – sie verharrt im bloßen Schein und kann deshalb nicht Organon der Wahrheit sein.
- 3.8. Die Unzulänglichkeiten der sinnlichen Wahrnehmung als Grund, weshalb es die Kunst vermag, mit Trugbildern zu täuschen....
- 3.9. Von der Dichtung geht eine psychologische Wirkung aus, die wider Vernunft und Sitte gerichtet ist
- 3.10. Platons Erbe für die spätere philosophische Ästhetik
- 4. Kunst im Systemzusammenhang bei Hegel – als Antwort auf die Frage, wie der menschliche Geist zu einem Erkennen seiner selbst gelangt..
- 4.1. Der Begriff des Geistes bei Hegel
- 4.1.1. Die Idee als Einheit von Begriff und Realität
- 4.1.2. Der Begriff wird zur Idee, wenn er die in abstrakter Einheit ihm innewohnenden Besonderungen in die Realität stellt.
- 4.1.3. Was menschlicher Geist seinem Begriffe nach ist, bildet der Mensch im Kunstwerk für sich und sein Bewußtsein aus...
- 4.1.4. Die Kunst – nach Religion und Philosophie als eine Möglichkeit, wie der Mensch in den Hervorbringungen seiner selbst zur Erkenntnis gelangt.......
- 4.2. Das Ideal und der verwirklichte Begriff der Schönheit – die der Idee angemessene Verwirklichung in Form und Gestalt.
- 4.2.1. Die Kunstformen als die besonderen Momente der Idee
- 4.2.2. Die symbolische Kunstform
- 4.2.3. Die klassische Kunstform...
- 4.2.4. Die romantische Kunstform – mit der christlichen Offenbarung geht das Ende der Kunst einher..
- 5. Literaturverzeichnis ....
- 6. Abbildungsverzeichnis
- 7. Anhang...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Hegels Positionen zur Kunst, insbesondere mit der Frage, wie er die Kunst im Kontext seiner philosophischen Ästhetik einordnet und ihre Bedeutung für die menschliche Selbsterkenntnis definiert. Dabei wird Hegels Werk „Ästhetik“ als Grundlage für die Analyse herangezogen.
- Hegels Definition des Schönen und seine Abgrenzung vom Kantschen „interessenlosen Wohlgefallen“
- Die Rolle der Kunst in Hegels System der Philosophie und ihre Einordnung im Verhältnis zu Religion und Philosophie
- Die Bedeutung des Kunstwerks für die menschliche Selbsterkenntnis und die Herausarbeitung des Geistes im Sinnlichen
- Hegels Theorie der drei Kunstformen: Symbolische, klassische und romantische Kunst
- Hegels These vom Ende der Kunst und die Bedeutung der christlichen Offenbarung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt Hegels "Ästhetik" vor und beschreibt die zentrale Fragestellung der Arbeit: Was ist das Schöne überhaupt und wie zeigt es sich in Kunstwerken? Es wird dargelegt, dass Hegel die Kunst als eine Möglichkeit für den Geist des Menschen sieht, sich selbst zu erkennen und sein Bewusstsein zu erweitern.
- Kapitel 2: Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes: In diesem Kapitel werden die Ziele der Arbeit erläutert und der spezifische Fokus auf Hegels zentrale Positionen zur Kunst innerhalb der "Ästhetik" definiert.
- Kapitel 3: Philosophiegeschichtliche Voraussetzungen: Das Kapitel behandelt die philosophischen Vorläufer Hegels, insbesondere Platons Verständnis von Schönheit und Kunst. Es analysiert Platons Kritik an der Kunst als bloßen Schein und die damit verbundene Abwertung der sinnlichen Wahrnehmung.
- Kapitel 4: Kunst im Systemzusammenhang bei Hegel: Das Kapitel analysiert Hegels Philosophie des Geistes und die Bedeutung der Kunst für die menschliche Selbsterkenntnis. Es erläutert Hegels Auffassung von Kunst als Verwirklichung der Idee im Sinnlichen und zeigt die Bedeutung der Kunstformen für das Verständnis der Entwicklung des menschlichen Geistes auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf zentrale Begriffe der Hegelschen Ästhetik, wie die Idee, der Geist, die Kunstformen, das Schöne, Selbsterkenntnis, Sinnlichkeit, Verwirklichung und das Ende der Kunst. Sie befasst sich mit Hegels Kritik an Platon, seiner Kritik am „interessenlosen Wohlgefallen“ Kants und dem Zusammenhang zwischen Kunst und Erkennen. Weitere wichtige Themen sind die philosophischen Voraussetzungen der Hegelschen Ästhetik und die Bedeutung des Kunstwerks für die menschliche Selbstfindung.
- Citation du texte
- Malte Oetjen (Auteur), 2003, Das Ende der Kunst bei Hegel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30768