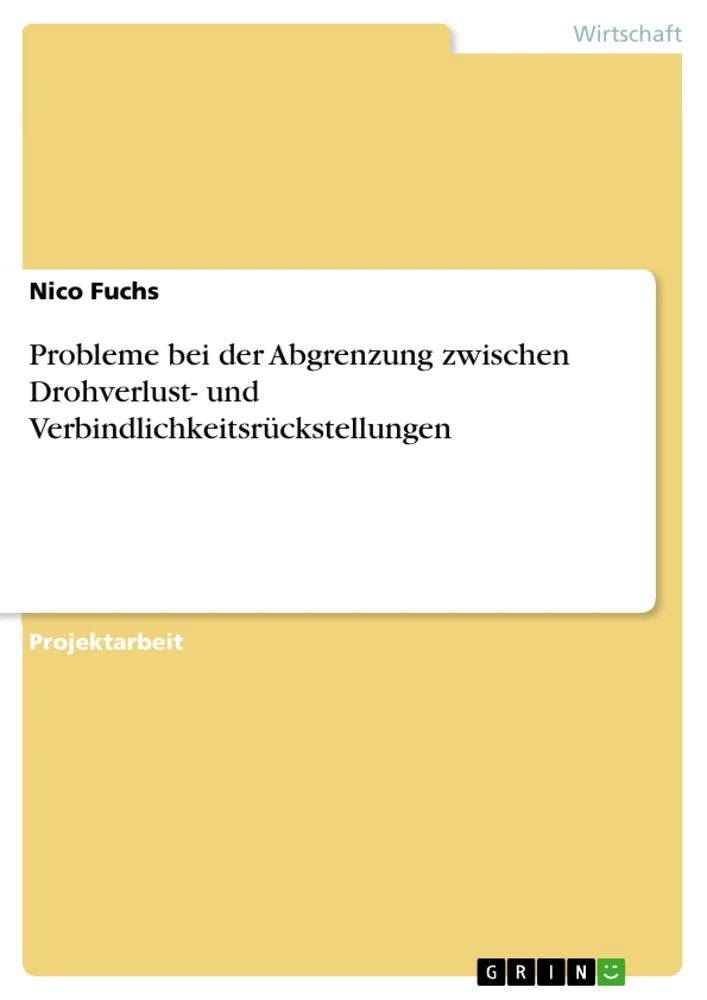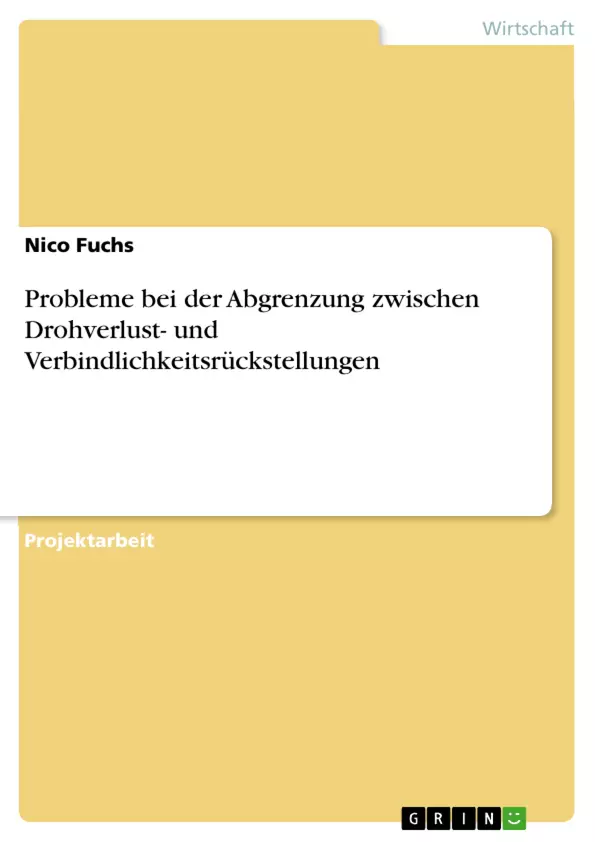Diese Projektarbeit beschäftigt sich mit den Problemen bei der Abgrenzung zwischen Rückstellungen für drohende Verluste und Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Diese theoretische Frage wird anhand eines anschaulichen Beispiels, der Rückkaufsverpflichtung im Kfz-Handel, verdeutlichen. Da es hier nur darum geht, ob eine Rückstellung angesetzt werden darf oder nicht, liegt die Problematik im Bilanzansatz. Um die Vewertung der Ruckstellung geht es nur, sofern sie auch
angesetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Allgemeines
- 2.1 Begriff
- 2.2 Bedeutung
- 2.3 Abgrenzungen zu anderen Passivposten
- 2.3.1 Gegenüber den Verbindlichkeiten
- 2.3.2 Gegenüber den passiven Rechnungsabgrenzungsposten
- 2.3.3 Gegenüber den Wertberichtigungen
- 2.3.4 Abgrenzung zu den Rücklagen
- 3. Abgrenzung von Drohverlust- und Verbindlichkeitsrückstellungen
- 3.1 Drohverlustrückstellungen
- 3.1.1 Schwebendes Geschäft
- 3.1.2 Drohender Verlust
- 3.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- 3.2.1 Außenverpflichtung
- 3.2.2 Ungewissheit
- 3.2.3 Wirtschaftliche Verursachung
- 3.2.4 Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme
- 3.3 Unterschiede zwischen Drohverlust- und Verbindlichkeitsrückstellungen
- 3.1 Drohverlustrückstellungen
- 4. Die Abgrenzungsproblematik anhand der Rückkaufverpflichtung im Kfz-Handel
- 4.1 Die Rückkaufverpflichtung im Kfz-Handel
- 4.2 Die Auffassung der Rechtsprechung
- 4.2.1 Der Ansatz vor dem 11.10.2007
- 4.2.2 Der Ansatz nach dem 11.10.2007
- 4.3 Die Auffassung in der Literatur
- 4.3.1 Der Ansatz von Prinz
- 4.3.2 Der Ansatz von Hoffmann
- 5. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Abgrenzungsproblematik zwischen Rückstellungen für drohende Verluste und Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Handels- und Steuerrechts. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung dieser Unterscheidung auf die Rückkaufsverpflichtung im Kfz-Handel. Ziel ist es, die unterschiedlichen Auffassungen der Rechtsprechung und Literatur hinsichtlich des bilanzrechtlichen Ansatzes dieser Verpflichtung aufzuzeigen und die Problematik im Kontext des Steuerrechts zu beleuchten.
- Abgrenzung von Drohverlust- und Verbindlichkeitsrückstellungen
- Anforderungen an Rückstellungsbildung im Handels- und Steuerrecht
- Rückkaufverpflichtungen im Kfz-Handel und ihre bilanzrechtliche Behandlung
- Stellungnahme der Rechtsprechung und Literatur zu den Ansätzen
- Steuerliche Auswirkungen und die Problematik der Abgrenzung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Rückstellungen ein und erläutert deren Bedeutung für die Bilanzpolitik. Es werden die Unterschiede zwischen Rückstellungen für drohende Verluste und Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sowie die Relevanz dieser Abgrenzung im Kontext des Steuerrechts hervorgehoben. Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Rückstellungen und diskutiert ihre Abgrenzung zu anderen Passivposten. Im dritten Kapitel werden die Kriterien für die Bildung von Drohverlustrückstellungen und Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten detailliert betrachtet. Das vierte Kapitel untersucht die Problematik der Abgrenzung anhand der Rückkaufverpflichtung im Kfz-Handel. Es werden die Auffassungen der Rechtsprechung und Literatur zu diesem Sachverhalt analysiert. Das fünfte Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Drohverlustrückstellungen, Verbindlichkeitsrückstellungen, Rückkaufsverpflichtung, Kfz-Handel, Bilanzpolitik, Handelsrecht, Steuerrecht, Rechtsprechung, Literatur, Abgrenzungsproblematik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Drohverlust- und Verbindlichkeitsrückstellungen?
Drohverlustrückstellungen werden für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet, während Verbindlichkeitsrückstellungen für ungewisse Verpflichtungen gegenüber Dritten entstehen, deren Höhe oder Zeitpunkt noch nicht feststehen.
Warum ist die Abgrenzung im Steuerrecht so wichtig?
Im deutschen Steuerrecht herrscht ein Passivierungsverbot für Drohverlustrückstellungen (§ 5 Abs. 4a EStG), während Verbindlichkeitsrückstellungen passiviert werden dürfen. Eine falsche Einordnung hat somit direkte Auswirkungen auf die Steuerlast.
Was versteht man unter einer Rückkaufsverpflichtung im Kfz-Handel?
Hierbei verpflichtet sich ein Händler beim Verkauf eines Fahrzeugs, dieses zu einem späteren Zeitpunkt zu einem fest definierten Preis wieder zurückzunehmen. Dies führt zu bilanziellen Abgrenzungsfragen.
Welche Kriterien gelten für Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten?
Es muss eine Außenverpflichtung vorliegen, die rechtlich oder faktisch besteht, die wirtschaftlich in der Vergangenheit verursacht wurde und deren Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.
Wie beurteilt die Rechtsprechung Rückkaufsverpflichtungen seit 2007?
Die Rechtsprechung hat sich gewandelt; die Arbeit untersucht detailliert den Ansatz vor und nach dem Stichtag 11.10.2007 hinsichtlich der Qualifizierung als schwebendes Geschäft oder bereits entstandene Verbindlichkeit.
- Quote paper
- Nico Fuchs (Author), 2013, Probleme bei der Abgrenzung zwischen Drohverlust- und Verbindlichkeitsrückstellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307745