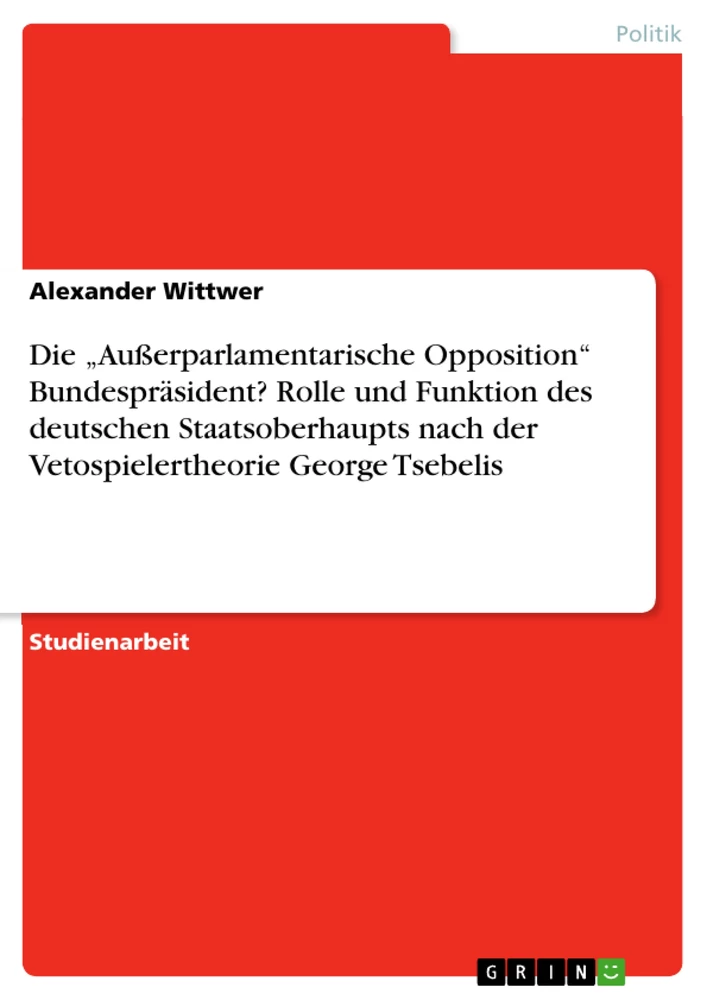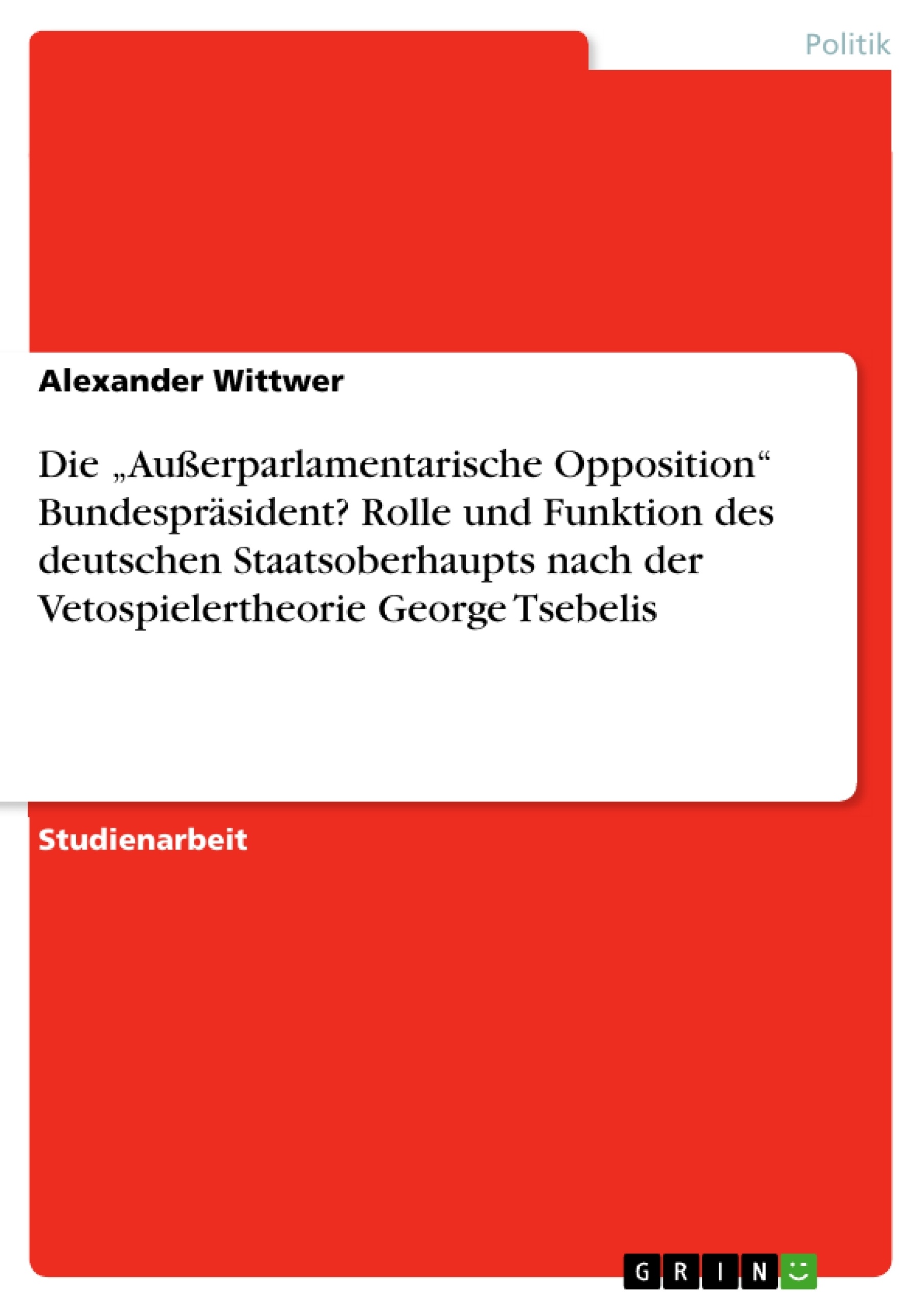Als der amtierende Bundespräsident Joachim Gauck im Februar 2013 das gesellschaftspolitisch umstrittene Gesetz zum Betreuungsgeld unterschreiben sollte, zögerte er mit der Ausfertigung ebenso wie beim Gesetz zur Diätenerhöhung zu Beginn der 18. Wahlperiode oder jüngst bei den Gesetzen zur Einführung einer PKW-Maut in Deutschland oder dem Tarifeinheitsgesetz. Begründet wurde dieses Zögern stets mit verfassungsrechtlichen Bedenken. Von dem Recht des Staatsoberhauptes Gesetze zu stoppen, die seiner Meinung nach verfassungswidrig sind, wurde in der Geschichte der Bundesrepublik bisher acht Mal Gebrauch gemacht und bei etwa zwanzig Gesetzen wurden zumindest Zweifel geäußert.
Eine Theorie, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Akteure überhaupt über eine solche Vetomacht verfügen und wie diese von den jeweiligen Vetospielern eingesetzt werden kann, entwickelte 1995 der US-amerikanische Politikwissenschaftler George Tsebelis. Er löst sich damit von den starren Kriterien der vergleichenden Politikwissenschaft, die bis dahin stets die gleichen Vergleichsmerkmale definierte und von diesen nicht abrückte: die Unterscheidung zwischen Präsidentialismus und Parlamentarismus, Bikameralismus und Unikameralismus und zwischen Zwei-Parteien- und Mehr-Parteien-System.
Tsebelis verwirft diese Kategorisierungsmuster aufgrund der Annahme, dass die Logik der Entscheidungsprozesse zwischen diesen Paaren durchaus verwandt sein kann und vergleicht Staaten anhand der Leitungsfähigkeit eines Systems in Bezug auf einen policy-change . Entscheidend bei der Theorie ist dabei, inwieweit bestimmte Akteure (vermeintliche Vetospieler) die Stabilität von politisch getroffenen Entscheidungen beeinflussen.
In der vorliegenden Arbeit soll die These diskutiert werden, dass im politischen System Deutschlands, auch der Bundespräsident aufgrund des ihm zur Verfügung stehenden Ausfertigungsverweigerungsrechts von Gesetzen, nach der Theorie von George Tsebelis, als ein institutioneller Vetospieler auftreten kann. In diesem Zusammenhang gilt es im Verlaufe der Arbeit zu diskutieren, inwieweit dem Bundespräsidenten neben einem formellen Prüfungsrecht auch ein materielles Prüfungsrecht zukommt, das es ihm erlaubt, ein Gesetz auch unter inhaltlichen (=materiellen) Aspekten, auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu prüfen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- ,,Außerparlamentarische Opposition“ Bundespräsident?
- Die Vetospielertheorie nach George Tsebelis
- Institutionelle und parteipolitische Vetospieler
- Individuelle und kollektive Vetospieler
- Konsensuale und kompetitive Vetospieler
- Interne und externe Vetospieler
- Das Amt des Bundespräsidenten
- Westminster-Logik: Der Bundespräsident als „Grüß-August“
- Staatsrechtliche Logik - Der Bundespräsident als Staatsnotar
- Die Gewaltenteilungslogik – Der Bundespräsident als Gegenspieler
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Rolle des Bundespräsidenten im deutschen politischen System unter dem Aspekt der Vetospielertheorie. Sie untersucht, ob und inwieweit der Bundespräsident, aufgrund seines Rechts, die Ausfertigung von Gesetzen zu verweigern, als Vetospieler betrachtet werden kann. Dabei werden verschiedene Rollen und Funktionszuschreibungen des Bundespräsidentenamtes beleuchtet, die im Kontext der Vetospielertheorie interpretiert werden.
- Analyse der Vetospielertheorie nach George Tsebelis
- Untersuchung des Bundespräsidenten als institutioneller Vetospieler
- Diskussion des formellen und materiellen Prüfungsrechts des Bundespräsidenten
- Vergleich verschiedener Logiken des Bundespräsidentenamtes
- Bedeutung des Bundespräsidenten als "neutrale Gewalt" im Kontext von Großen Koalitionen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel widmet sich der Frage, ob der Bundespräsident als "außerparlamentarische Opposition" betrachtet werden kann, indem es seine Rolle bei der Ausfertigung von Gesetzen analysiert. Das zweite Kapitel stellt die Vetospielertheorie nach George Tsebelis vor und differenziert verschiedene Arten von Vetospielern. Es dient als analytisches Instrument, um die Rolle des Bundespräsidenten im deutschen politischen System zu beurteilen. Das dritte Kapitel untersucht verschiedene Rollen und Funktionszuschreibungen des Bundespräsidentenamtes, darunter die Westminster-Logik, die staatsrechtliche Logik und die Gewaltenteilungslogik.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind die Vetospielertheorie, der Bundespräsident, das Ausfertigungsrecht, das formelle und materielle Prüfungsrecht, die Westminster-Logik, die staatsrechtliche Logik, die Gewaltenteilungslogik und die Rolle des Bundespräsidenten als "neutrale Gewalt" in Bezug auf Große Koalitionen. Darüber hinaus spielen wichtige Konzepte wie Policy-Stabilität, policy congruence, interne Kohäsion und Rational Choice-Theorie eine Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Bundespräsident ein Vetospieler im politischen System?
Nach der Theorie von George Tsebelis kann der Bundespräsident als institutioneller Vetospieler betrachtet werden, da er durch sein Ausfertigungsverweigerungsrecht einen „Policy-Change“ blockieren kann.
Was besagt die Vetospielertheorie von George Tsebelis?
Die Theorie besagt, dass die Stabilität von politischen Entscheidungen davon abhängt, wie viele Akteure (Vetospieler) einer Änderung zustimmen müssen. Je mehr Vetospieler, desto schwieriger ist eine politische Veränderung.
Was ist der Unterschied zwischen formellem und materiellem Prüfungsrecht?
Das formelle Prüfungsrecht bezieht sich auf das ordnungsgemäße Zustandekommen eines Gesetzes. Das materielle Prüfungsrecht erlaubt es dem Präsidenten, ein Gesetz auch inhaltlich auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu prüfen.
In welchen Fällen haben Bundespräsidenten Gesetze gestoppt?
In der Geschichte der Bundesrepublik wurde bisher acht Mal von der Ausfertigungsverweigerung Gebrauch gemacht, oft aufgrund von verfassungsrechtlichen Bedenken, wie z. B. beim Gesetz zur Flugsicherung.
Wie ändert sich die Rolle des Präsidenten bei einer Großen Koalition?
Bei einer Großen Koalition, in der die parlamentarische Opposition schwach ist, rückt der Bundespräsident oft stärker in die Rolle einer „neutralen Gewalt“ oder „Ersatzopposition“, die die Einhaltung der Verfassung schützt.
- Quote paper
- B.A. Alexander Wittwer (Author), 2015, Die „Außerparlamentarische Opposition“ Bundespräsident? Rolle und Funktion des deutschen Staatsoberhaupts nach der Vetospielertheorie George Tsebelis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307780