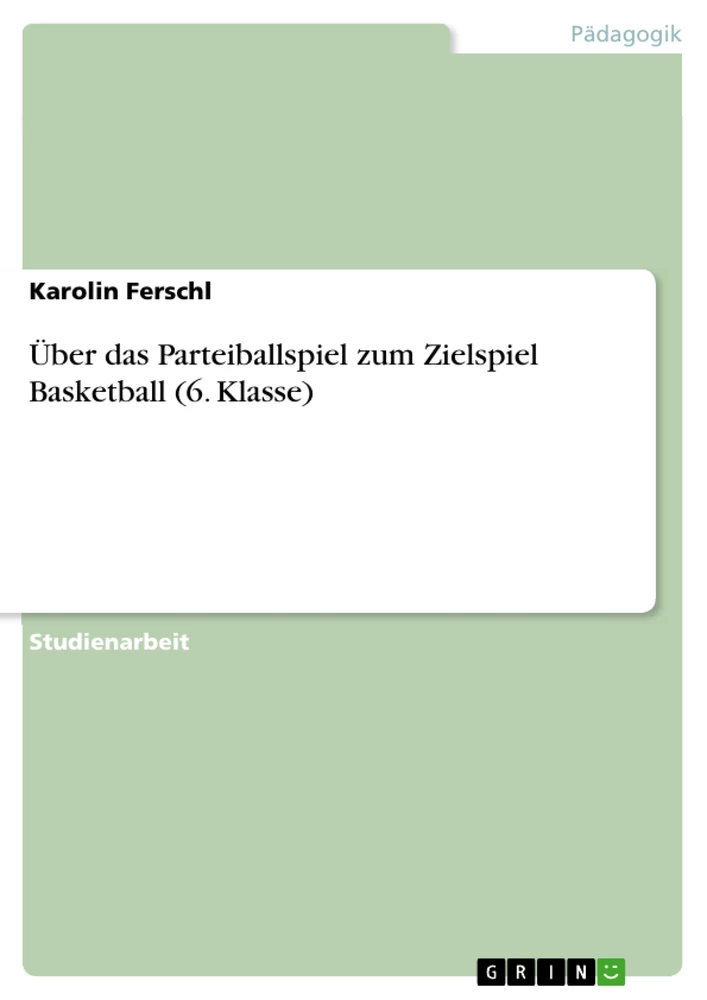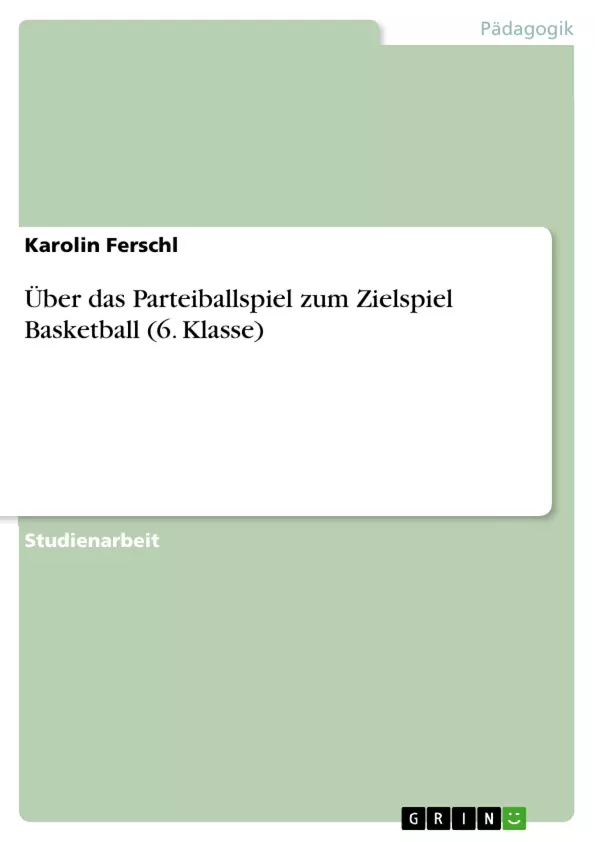Basketball gehört zu den beliebtesten Sportarten der Welt und daher fasziniert es auch viele Kinder und Jugendliche. Nicht selten kann man beobachten, dass Kinder auf Freiplätzen bis zur Abenddämmerung Körbe werfen und dribbeln. Der Reiz des Spiels liegt darin, dass es auf einem relativen kleinen Spielfeld zu ständig wechselnden Spielsituationen kommt, in denen die Spieler permanent in das Spielgeschehen eingreifen und so auch Spaß und Erfolgserlebnisse haben.
Die Popularität des Basketballs wird durch zahlreiche Fernsehübertragungen von Bundesliga- und NBA-Spielen unterstützt. Auch die Erfolge der deutschen Mannschaften sowie deutscher Athleten wie Dirk Nowitzki steigern die Beliebtheit des Basketballspiels. Neben den Basketballstars sorgen noch zusätzlich die lässige Sportkleidung und Hip-Hop Musik für ein besonderes Flair, von dem sich Jugendliche angezogen fühlen. Demnach bleibt es nicht aus, dass Schüler und Schülerinnen in den Schulen den Wunsch äußern, Basketball zu spielen.
Aber für ein 5 gegen 5 reichen die technischen und taktischen Fertigkeiten häufig noch nicht aus; der beste Dribbler jeder Mannschaft bestimmt das Spiel, Pässe und Anspiele sind oft ungenau und einige Spieler bekommen so gut wie nie den Ball. Daher ist durchaus sinnvoll, mit Hilfe von Kleinen Sportspielen die technischen und taktischen Fertigkeiten zu verbessern. Freude, Spaß, Spannung und das Miteinander werden bei den Kleinen Sportspielen akzentuiert, wobei die Spielregeln und der Spielgedanke so vereinfacht werden, dass alle sofort mitspielen können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung der didaktisch-methodischen Entscheidung
- 2.1 Sachanalyse
- 2.1.1 Grundlegende Technik
- 2.1.2 Parteiball
- 2.2 Bedingungsanalyse
- 2.2.1 Innere Bedingungen: Schüler
- 2.2.2 Lehrplanbezug
- 2.3 Didaktische Analyse
- 2.3.1 Methoden und Prinzipien
- 2.3.2 Unterrichtsform und Sozialformen
- 2.3.3 Medien und Unterrichtsmittel
- 3. Konzeption des Stundenverlaufs / Unterrichtsentwurf
- 3.1 Sequenzplanung
- 3.2 Konkretisierungen der Ziele
- 3.3 Tabellarischer Stundenverlauf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, Schülern das Zielspiel Basketball durch das Parteiballspiel näherzubringen. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung grundlegender technischer Fertigkeiten des Basketballs wie Ballführung, Ballabgabe, Ballannahme, Beinarbeit und Wurf.
- Vermittlung von grundlegenden Basketballtechniken durch ein Kleinspiel
- Steigerung der technischen Fertigkeiten durch das Parteiballspiel
- Didaktische Analyse und methodische Entscheidungen für den Unterricht
- Konzeption eines Unterrichtsentwurfs mit Sequenzplanung und Stundenverlauf
- Förderung des Spielverständnisses und der Freude am Basketballsport
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung des Basketballs als beliebte Sportart für Kinder und Jugendliche heraus und erklärt die Notwendigkeit, die technischen und taktischen Fertigkeiten durch Kleinspiele zu verbessern.
- Sachanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Techniken des Basketballspiels, wie z.B. Ballführung, Ballabgabe, Ballannahme, Beinarbeit und Wurf. Es erläutert die einzelnen Techniken detailliert und zeigt deren Bedeutung für das Spielgeschehen auf.
- Bedingungsanalyse: Der Abschnitt fokussiert sich auf die inneren Bedingungen der Schüler, die für den Unterricht relevant sind, sowie auf den Lehrplanbezug.
- Didaktische Analyse: Dieses Kapitel befasst sich mit den methodischen Prinzipien und der Auswahl der Unterrichtsform und -mittel.
- Konzeption des Stundenverlaufs: In diesem Kapitel werden die Sequenzplanung, die konkreten Ziele und der tabellarische Stundenverlauf des Unterrichts beschrieben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Der Text beschäftigt sich mit dem Thema des Unterrichtsentwurfs im Basketball, insbesondere mit der didaktisch-methodischen Entscheidung für den Einsatz von Parteiballspielen zur Vermittlung grundlegender technischer Fertigkeiten. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Basketball, Parteiball, didaktische Analyse, methodische Prinzipien, Unterrichtsentwurf, Sequenzplanung, Stundenverlauf, technische Fertigkeiten, Ballführung, Ballabgabe, Ballannahme, Beinarbeit, Wurf.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Parteiball zur Vorbereitung auf Basketball genutzt?
Parteiball vereinfacht die Regeln und den Spielgedanken, sodass Schüler ohne komplexe technische Hürden sofort mitspielen können und gleichzeitig grundlegende Fertigkeiten wie Passen und Fangen trainieren.
Welche technischen Fertigkeiten werden im Basketball-Unterricht vermittelt?
Zu den Grundlagen gehören Ballführung (Dribbeln), Ballabgabe (Passen), Ballannahme (Fangen), Beinarbeit und die richtige Wurftechnik.
Warum ist 5-gegen-5 für Anfänger oft nicht ideal?
Oft dominieren die besten Spieler das Geschehen, Pässe sind ungenau und viele Schüler kommen kaum an den Ball. Kleine Sportspiele fördern hingegen die Beteiligung aller.
Welche Rolle spielen Vorbilder wie Dirk Nowitzki?
Erfolge deutscher Stars und die Präsenz der NBA in den Medien steigern die Motivation und das Interesse der Schüler am Basketballsport massiv.
Was ist das Ziel einer didaktischen Analyse im Sportunterricht?
Sie dient dazu, Methoden, Sozialformen und Unterrichtsmittel so auszuwählen, dass die Lernziele (z. B. technischer Fortschritt und Spielspaß) optimal erreicht werden.
Was versteht man unter einer Sequenzplanung?
Die Sequenzplanung strukturiert den Unterricht über mehrere Stunden hinweg, um die Schüler schrittweise von einfachen Übungen zum komplexen Zielspiel zu führen.
- Quote paper
- Karolin Ferschl (Author), 2012, Über das Parteiballspiel zum Zielspiel Basketball (6. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307782