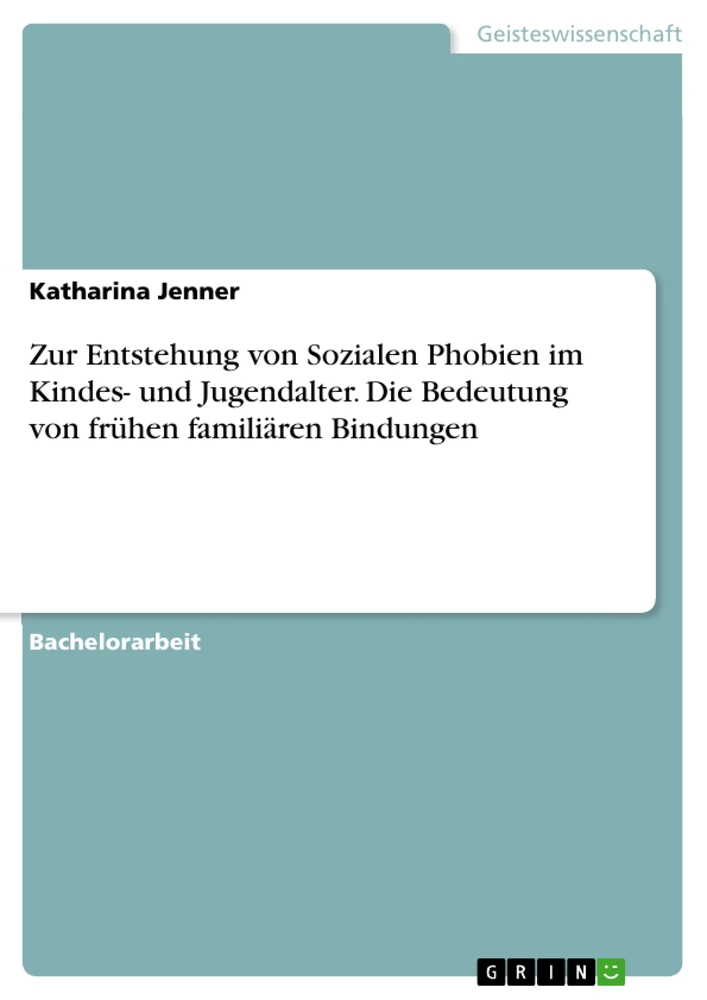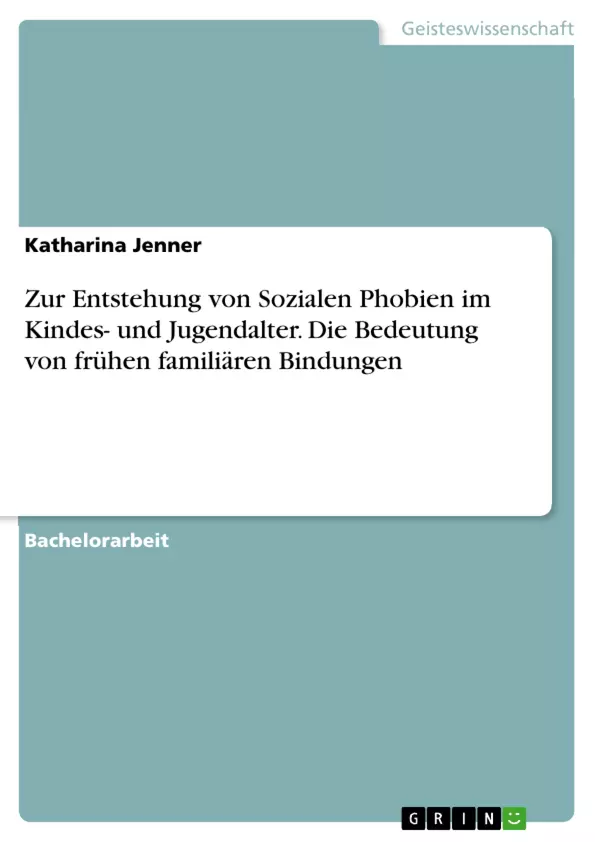Die Familie stellt das erste und zunächst engste Umfeld eines Kindes dar. Hier entwickelt es die ersten Beziehungen zu anderen Menschen, insbesondere den Eltern, und erlernt die ersten sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen. In der Familie werden die ersten Weichen für die soziale Entwicklung des Kindes gestellt. Es kann angenommen werden, dass die einzelnen Familienmitglieder einen Einfluss darauf haben, wie sich das Kind in sozialen Kontexten verhält, ob es erfolgreiche Kontakte knüpfen und aufrechterhalten kann oder ob es soziale Situationen eher als eine Bedrohung und als etwas Beängstigendes, Verunsicherndes wahrnimmt. Letzteres kann in schwerwiegenden Fällen in eine Soziale Angststörung bzw. eine Soziale Phobie münden.
Um dem Leser einen näheren Überblick über das Störungsbild der Sozialen Phobie zu verschaffen, soll es zunächst um allgemeine Merkmale der Sozialen Phobie gehen, bevor auf Besonderheiten bei Kindern und Jugendlichen eingegangen wird. Hinsichtlich des Kindheits- bzw. Jungendbegriffs unterliegen die für die Störungsentwicklung relevanten Altersangaben sowohl in der Literatur als auch in empirischen Untersuchungen sehr großen Schwankungen.
Potenzielle Ursachen für die Störungsentstehung werden allerdings meist in der früheren Kindheit gesucht, insbesondere bei der Betrachtung prägender Beziehungen innerhalb der Familie. Daher wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Ätiologie der Störung anhand von verschiedenen Risikofaktoren thematisiert und mithilfe des Entstehungsmodells von Rapee und Spence (2004) veranschaulicht.
Aus der Vielzahl von Einflussfaktoren, die zur Entstehung der Sozialen Phobie beitragen, werden im anschließenden Kapitel die familiären Beziehungen als zentraler Aspekt aufgegriffen und in ihrer Bedeutung für die Störungsentwicklung vertiefend dargestellt. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem elterlichen Erziehungsaspekt, der zusätzlich anhand empirischer Befunde untermauert werden soll. Nach einer kritischen Betrachtung der Studien folgt das abschließende Fazit, in dem die gewonnen Erkenntnisse dieser Ausarbeitung nochmals zusammengefasst und ausgewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Störungsbild der sozialen Phobie
- 2.1 Erscheinungsform und Symptomatik
- 2.2 Epidemiologie und Verlauf
- 2.3 Komorbiditäten
- 2.4 Soziale Phobie bei Kindern und Jugendlichen
- 2.4.1 Erstmanifestation und kritische Entwicklungsphasen
- 2.4.2 Diagnostische Kriterien
- 3. Ätiologie und Risikofaktoren
- 3.1 Das Entstehungsmodell von Rapee und Spence
- 3.2 Erklärungsansätze verschiedener Psychologieschulen
- 4. Frühe familiäre Beziehungen
- 4.1 Bindungen und Bindungsverhalten
- 4.2 Einfluss der elterlichen Erziehung auf die Störungsentwicklung
- 4.3 Unterschiedliche Einflüsse durch Mutter und Vater
- 4.4 Einfluss durch Geschwister auf die Störungsentwicklung
- 5. Empirische Befunde zur Bedeutung der elterlichen Erziehung
- 5.1 Frühere Forschungsergebnisse
- 5.2 Aktuelle Studien ab dem Jahr 2009
- 5.3 Kritische Auswertung und Diskussion der Studienlage
- 6. Zusammenfassende Schlussbetrachtung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung früher familiärer Beziehungen für die Entstehung sozialer Phobien im Kindes- und Jugendalter. Ziel ist es, den Einfluss elterlicher Erziehung und Bindungsmuster auf die Entwicklung dieser Störung zu beleuchten und empirische Befunde kritisch zu diskutieren.
- Das Störungsbild der sozialen Phobie und deren Erscheinungsformen bei Kindern und Jugendlichen
- Ätiologische Modelle und Risikofaktoren der sozialen Phobie
- Der Einfluss verschiedener Erziehungs- und Bindungsstile auf die Störungsentwicklung
- Auswertung und kritische Diskussion relevanter empirischer Studien
- Zusammenfassende Betrachtung der Bedeutung familiärer Beziehungen für die Entstehung sozialer Phobien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz früher familiärer Beziehungen für die Entwicklung sozialer Phobien heraus. Sie betont die lange Zeit vernachlässigte Bedeutung der Störung und die zunehmende Erforschung in den letzten Jahrzehnten. Die Arbeit fokussiert sich auf den Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung, wobei der Erziehungsaspekt im Vordergrund steht und durch empirische Befunde untermauert werden soll. Der begrenzte Rahmen der Arbeit rechtfertigt die Konzentration auf die Eltern-Kind-Beziehung und eine nur kurze Erwähnung des Einflusses von Geschwistern.
2. Das Störungsbild der sozialen Phobie: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Störungsbild der sozialen Phobie, inklusive Erscheinungsformen, Symptomatik, Epidemiologie, Verlauf und Komorbiditäten. Es beleuchtet insbesondere die Besonderheiten der sozialen Phobie im Kindes- und Jugendalter, unter Berücksichtigung unterschiedlicher diagnostischer Kriterien (DSM-IV und ICD-10) und der Herausforderungen bei der Diagnosestellung in dieser Altersgruppe. Die Altersspanne für die relevante Störungsentwicklung wird diskutiert, wobei die große Bandbreite in der Literatur hervorgehoben wird.
3. Ätiologie und Risikofaktoren: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen und Risikofaktoren für die Entwicklung einer sozialen Phobie. Es stellt verschiedene Erklärungsansätze verschiedener psychologischen Schulen vor und erläutert das Entstehungsmodell von Rapee und Spence (2004), das als Rahmenmodell für die weitere Analyse dient. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Auseinandersetzung mit den familiären Beziehungen als zentralen Aspekt der Ätiologie.
4. Frühe familiäre Beziehungen: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung früher familiärer Beziehungen für die Entstehung sozialer Phobien. Es betrachtet Bindungsmuster, elterliche Erziehungs- und Verhaltensweisen, sowie den Einfluss von Mutter, Vater und Geschwistern. Es werden theoretische Überlegungen und empirische Befunde präsentiert, wobei der Schwerpunkt auf den elterlichen Erziehungsaspekt gelegt wird. Die Rolle der Geschwisterbeziehung wird nur kurz angesprochen, aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit.
5. Empirische Befunde zur Bedeutung der elterlichen Erziehung: In diesem Kapitel werden empirische Studien zur Bedeutung der elterlichen Erziehung für die Entwicklung sozialer Phobien kritisch analysiert. Es werden sowohl frühere als auch aktuelle Forschungsergebnisse (ab 2009) betrachtet und die Studienlage umfassend diskutiert. Dieser Abschnitt stellt eine wichtige Grundlage für die Schlussfolgerungen der Arbeit dar.
Schlüsselwörter
Soziale Phobie, Angststörung, Kindesalter, Jugendalter, familiäre Beziehungen, elterliche Erziehung, Bindung, Risikofaktoren, Ätiologie, empirische Befunde, DSM-IV, ICD-10.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Soziale Phobie im Kindes- und Jugendalter und der Einfluss früher familiärer Beziehungen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss früher familiärer Beziehungen, insbesondere der elterlichen Erziehung und Bindungsmuster, auf die Entstehung sozialer Phobien im Kindes- und Jugendalter. Sie analysiert empirische Befunde und diskutiert diese kritisch.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Störungsbild der sozialen Phobie (Erscheinungsformen, Symptomatik, Epidemiologie, Verlauf, Komorbiditäten), verschiedene ätiologische Modelle und Risikofaktoren, den Einfluss verschiedener Erziehungs- und Bindungsstile, eine kritische Auswertung relevanter empirischer Studien (vor allem ab 2009) und die Bedeutung familiärer Beziehungen für die Entstehung der Störung. Der Fokus liegt auf der Eltern-Kind-Beziehung, wobei der Einfluss von Geschwistern nur kurz erwähnt wird.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Das Störungsbild der sozialen Phobie, Ätiologie und Risikofaktoren, Frühe familiäre Beziehungen, Empirische Befunde zur Bedeutung der elterlichen Erziehung und eine zusammenfassende Schlussbetrachtung.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Literaturrecherche und eine kritische Analyse empirischer Studien zur Bedeutung der elterlichen Erziehung für die Entwicklung sozialer Phobien. Das Entstehungsmodell von Rapee und Spence dient als Rahmenmodell.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zum Thema. Sie analysiert den Einfluss elterlicher Erziehungs- und Bindungsstile auf die Entwicklung sozialer Phobien bei Kindern und Jugendlichen, basierend auf der Auswertung relevanter empirischer Studien. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Phobie, Angststörung, Kindesalter, Jugendalter, familiäre Beziehungen, elterliche Erziehung, Bindung, Risikofaktoren, Ätiologie, empirische Befunde, DSM-IV, ICD-10.
Welche Altersgruppe steht im Mittelpunkt der Untersuchung?
Der Fokus liegt auf Kindern und Jugendlichen, wobei die Arbeit die Altersspanne für die relevante Störungsentwicklung diskutiert und die Herausforderungen bei der Diagnosestellung in dieser Altersgruppe beleuchtet.
Wie werden frühe familiäre Beziehungen in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert Bindungsmuster, elterliche Erziehungs- und Verhaltensweisen sowie den Einfluss von Mutter, Vater und (kurz) Geschwistern auf die Entwicklung sozialer Phobien. Der Schwerpunkt liegt auf den elterlichen Erziehungsaspekten.
Welche Rolle spielen empirische Studien in der Arbeit?
Empirische Studien, sowohl ältere als auch aktuelle (ab 2009), bilden eine wichtige Grundlage für die Analyse und Schlussfolgerungen der Arbeit. Die Studienlage wird umfassend diskutiert und kritisch bewertet.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse zusammenfasst.
- Quote paper
- Katharina Jenner (Author), 2013, Zur Entstehung von Sozialen Phobien im Kindes- und Jugendalter. Die Bedeutung von frühen familiären Bindungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307785