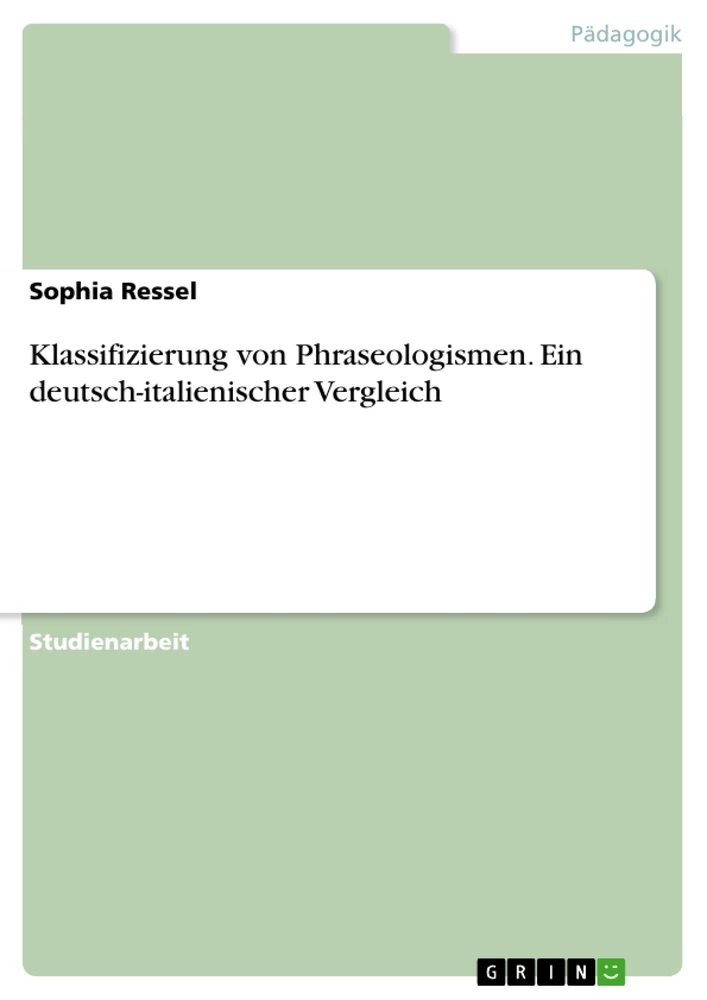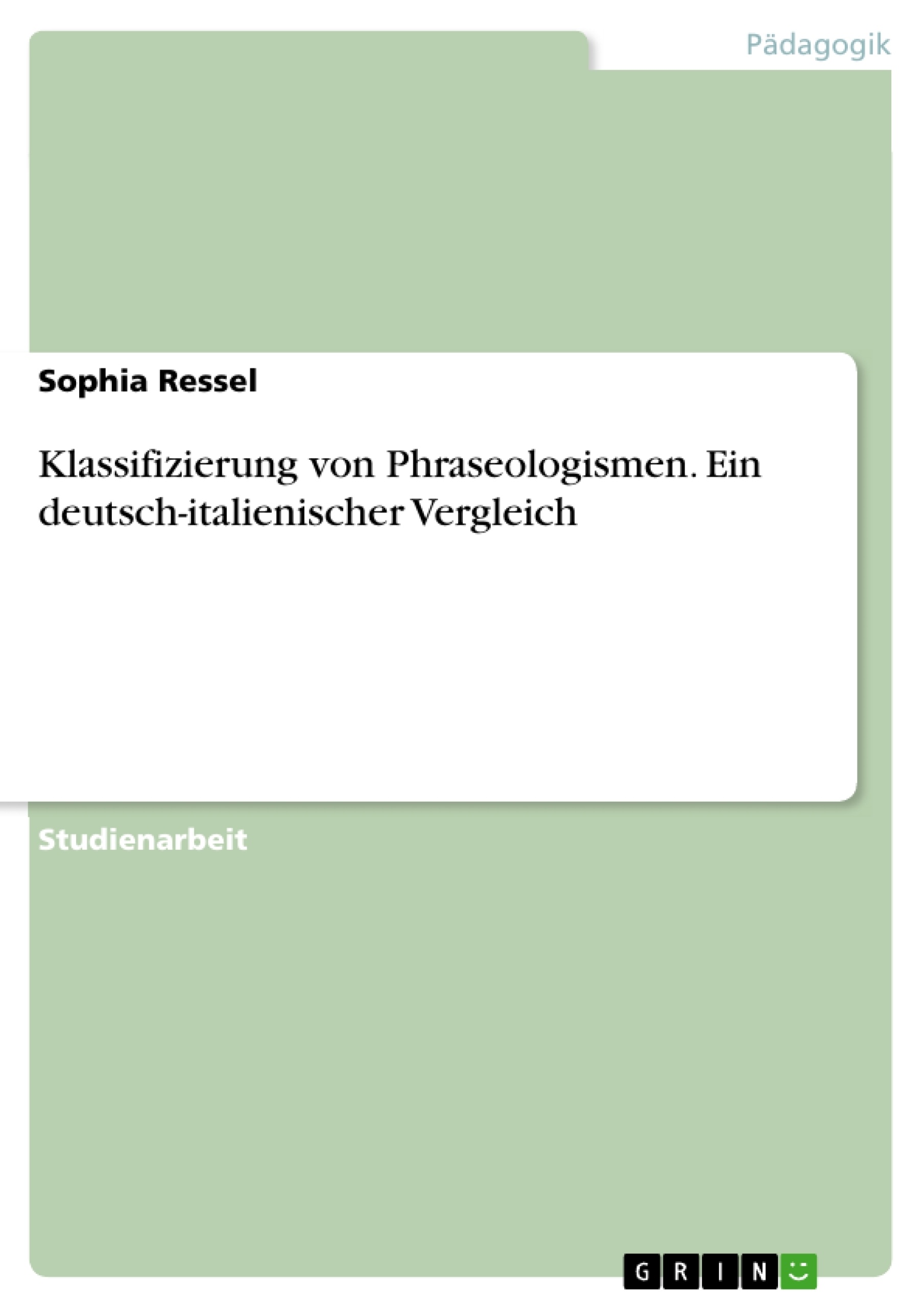Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Phraseologismen und deren Kategorisierung.
Phraseologismen, oder allgemeiner ausgedrückt Redewendungen oder Sprichwörter, fließen in die alltägliche Kommunikation unterbewusst ein. Doch warum genau dieser Name für Phraseologismen sehr ungenau ist und was dieser Begriff wirklich bedeutet, darum geht es in dieser Arbeit.
Doch die Kernaussage ist die gleiche, auch wenn Variationen bei Phraseologismen vorherrschen können.
Auch im Italienischen gibt es diese Unterscheidung zwischen locuzioni, modi di dire und proverbi und auch mit diesen Formen wird sich die vorliegende Arbeit beschäftigen.
Thema der Arbeit soll es sein, eine Aufschlüsselung über die Kategorien von Phraseologismen zu geben, hauptsächlich über die Kategorisierung nach Harald Burger. Dies soll an deutschen und italienischen Beispielen geschehen.
Am Schluss der Arbeit soll das wichtigste Thema folgen: Somatismen mit Organen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. EINLEITUNG
- II. WAS IST PHRASEOLOGIE?
- III. KLASSIFIKATION UND TERMINOLOGIE
- a) Dreiteilung der Phraseologismen nach Harald Burger...
- b) Unterteilung der referentiellen Phraseologismen
- c) Unterteilung der propositionalen Phraseologismen
- IV. SYNTAKTISCHE KlassifikatION NACH BURGER.
- V. SPEZIELLE KLASSEN VON PHRASEOLOGISMEN..
- VI. SOMATISMEN IN DER PHRASEOLOGIE - EIN DEUTSCH-ITALIENISCHER VERGLEICH.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Kategorisierung von Phraseologismen, insbesondere mit der Klassifizierung nach Harald Burger. Es wird eine Analyse der verschiedenen Kategorien von Phraseologismen anhand deutscher und italienischer Beispiele durchgeführt.
- Definition und Abgrenzung von Phraseologismen
- Klassifizierung von Phraseologismen nach Harald Burger
- Analyse von referentiellen, strukturellen und kommunikativen Phraseologismen
- Untersuchung der Unterteilung von referentiellen Phraseologismen in nominative und propositionale Phraseologismen
- Vergleich von Somatismen in der deutschen und italienischen Phraseologie
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema Phraseologie ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Kapitel II beleuchtet die Definition und Abgrenzung von Phraseologismen, wobei verschiedene Ansätze und Definitionen diskutiert werden. Kapitel III befasst sich mit der Klassifikation und Terminologie von Phraseologismen. Hier wird die Dreiteilung nach Harald Burger in referentielle, strukturelle und kommunikative Phraseologismen vorgestellt und erläutert. Des Weiteren werden die Unterteilungen der referentiellen Phraseologismen in nominative und propositionale Phraseologismen sowie die Unterteilung der propositionalen Phraseologismen in verschiedene Kategorien diskutiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Phraseologie, Phraseologismen, Redewendungen, Sprichwörter, Klassifizierung, Harald Burger, referentiell, strukturell, kommunikativ, nominativ, propositional, Somatismen, Deutsch-Italienischer Vergleich.
- Quote paper
- Sophia Ressel (Author), 2015, Klassifizierung von Phraseologismen. Ein deutsch-italienischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307798