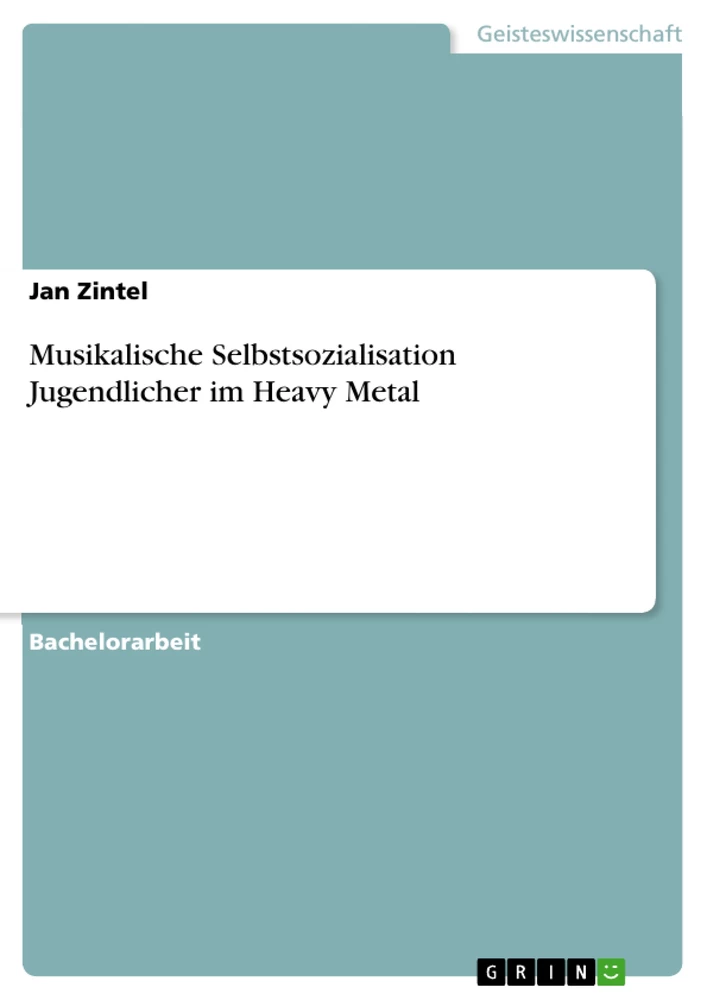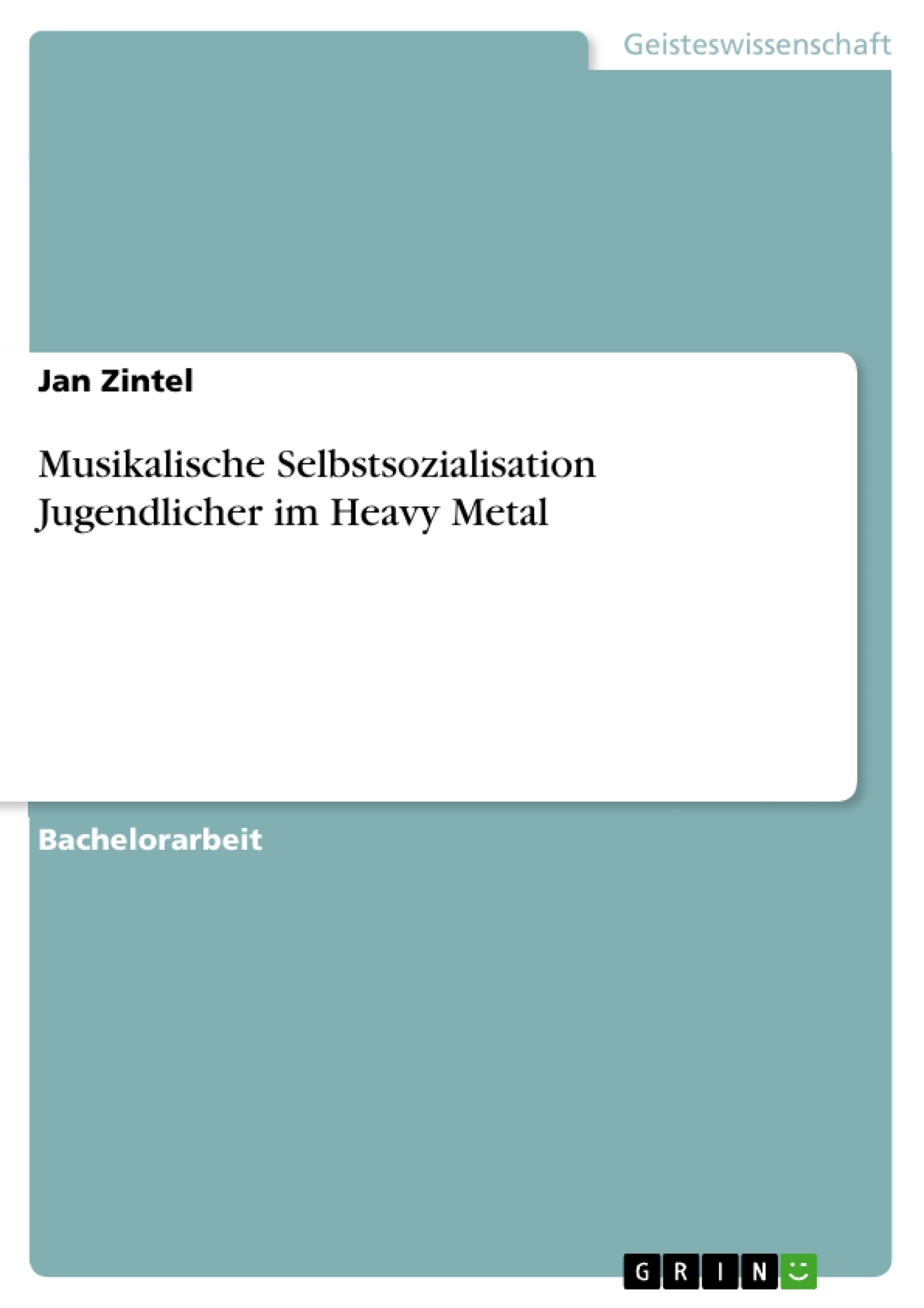Wie kann der Umgang mit einer grundsätzlich negativ belasteten Musikrichtung förderlich für die Sozialisation von Jugendlichen sein? Müsste sich die Beschäftigung damit nicht eher nachteilig auf deren Entwicklung auswirken?
Fakt ist, dass sich laut einer Studie aus dem Jahr 2013 etwa drei Viertel der 15- bis 29-jährigen Deutschen einer Jugendszene zugehörig fühlen (tfactory 2013). Die Heavy-Metal-Szene zählt dabei zu den zahlenmäßig am stärksten vertretenen Szenen. Wäre eine so hohe Beteiligung daran überhaupt möglich, wenn Szenen schädlich für deren „Mitglieder“ wären?
Jugendszenen fallen häufig negativ auf. Besonders die Heavy-Metal-Szene kann auf den ersten Blick wie ein Haufen betrunkener und pöbelnder Langhaariger erscheinen. Bei genauerer Beschäftigung mit der Szene stellen sich diese Vorurteile jedoch oft als unbegründet heraus.
Jugendszenen scheinen eine immer größere Rolle im Leben Jugendlicher einzunehmen, weshalb es wichtig erscheint, zu untersuchen, wie sich diese auf die Heranwachsenden auswirken.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung von Musik und musikalischen Jugendszenen, sowie deren Einfluss auf die Entwicklung und Sozialisation Jugendlicher darzustellen. Es soll außerdem gezeigt werden, dass das schlechte Bild, das viele Menschen von Heavy Metal und Fans des Genres haben, nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Aus pädagogischer Sicht ist die Behandlung dieses Themas als relevant anzusehen, da besonders in der Jugendarbeit das Wissen darüber, wie Jugendliche Musik verwenden und wie Musik dazu verwendet werden kann, Jugendliche zu erreichen, von Vorteil ist.
In Form einer theoretischen Abhandlung sollen die genannten Ziele erreicht werden.
In der modernen Jugendforschung hat vor allem Ronald Hitzler den Szene-Begriff geprägt. Sein gemeinsam mit Arne Niederbacher verfasstes Buch „Leben in Szenen“ (Hitzler/Niederbacher 2010) soll als Grundlage für das Verständnis von Jugendszenen in dieser Arbeit dienen. Speziell für die Heavy-Metal-Szene ist diesbezüglich Bettina Roccors Doktorarbeit über die Szene (Roccor 1998) als deutsches Standardwerk zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Musik und Jugend
- Musik
- Geschichte der Musik
- Musiknutung in der heutigen Zeit
- Jugend
- Geschichte der Jugend
- Jugend in der modernen Gesellschaft
- Bedeutung von Musik im Jugendalter
- Musik
- Musikalische Selbstsozialisation
- Die Theorien Bourdieus
- Der Habitus
- Kapital und Klasse
- Geschmack als Mittel zur Distinktion
- Musikalische Sozialisation
- Das Konzept der Selbstsozialisation
- Das Modell des produktiv Realität verarbeitenden Subjekts
- Selbstsozialisation
- Das Konzept musikalischer Selbstsozialisation
- Kritik am Konzept
- Die Theorien Bourdieus
- Unsichtbare Bildungsprogramme in Jugendszenen
- Jugendkultur(en), Subkultur und Szene
- Der Kompetenz-Leitfaden
- Heavy Metal
- Die Szene und ihre Musik
- Der Metal-Stil
- Szenetreffpunkte und -Events
- Das unsichtbare Bildungsprogramm der Heavy Metal-Szene
- Basale szeneintern relevante Kompetenzen
- Szeneintern relevante Kompetenzen zur Ressourcenschöpfung
- Allgemein alltagspraktisch relevante Kompetenzen
- Nicht-zertifizierte berufspraktisch relevante Kompetenzen
- Quasi-zertifizierte berufspraktisch relevante Kompetenzen
- Formal-zertifizierte berufspraktisch relevante Kompetenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Musik und musikalischen Jugendszenen sowie deren Einfluss auf die Entwicklung und Sozialisation Jugendlicher. Sie zielt darauf ab, die Rolle von Heavy Metal in der Jugendentwicklung zu beleuchten und aufzuzeigen, dass das oft negative Bild des Genres nicht der Realität entspricht. Der Fokus liegt insbesondere auf dem Konzept der musikalischen Selbstsozialisation und dem „unsichtbaren Bildungsprogramm“ in der Heavy Metal-Szene.
- Die Bedeutung von Musik im Jugendalter
- Die Rolle musikalischer Jugendszenen in der Sozialisation
- Das Konzept der musikalischen Selbstsozialisation
- Unsichtbare Bildungsprogramme in Jugendszenen
- Die Heavy Metal-Szene als Beispiel für musikalische Selbstsozialisation
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung von Musik und Jugend in der Gesellschaft. Es beleuchtet die Bedeutung von Musik für Menschen und die besondere Rolle, die sie im Jugendalter einnimmt.
Kapitel 3 stellt das Konzept der musikalischen Selbstsozialisation vor, das von Renate Müller entwickelt wurde. Dabei werden die Theorien Pierre Bourdieus als Grundlage für das Verständnis von musikalischer Selbstsozialisation herangezogen.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit Ronald Hitzlers und Michaela Pfadenhauers Konzept der unsichtbaren Bildungsprogramme in Jugendszenen. Dieses Konzept wird als Erweiterung der Theorie der musikalischen Selbstsozialisation betrachtet und im sechsten Kapitel auf die Heavy Metal-Szene angewendet.
Kapitel 5 bietet eine Darstellung der Heavy Metal-Szene, sowohl im Hinblick auf die Musik als auch die Menschen, die sich darin bewegen. Die Geschichte des Heavy Metal, der typische Metal-Stil sowie Events und Treffpunkte der Szene werden in diesem Abschnitt dargestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Musik, Jugend, Sozialisation, musikalische Selbstsozialisation, unsichtbare Bildungsprogramme, Jugendszenen und Heavy Metal. Sie untersucht die Rolle von Musik im Jugendalter, insbesondere im Kontext der Heavy Metal-Szene, und beleuchtet die Bedeutung dieser Musikrichtung für die Entwicklung und Selbstsozialisation von Jugendlichen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist musikalische Selbstsozialisation?
Es beschreibt den Prozess, in dem Jugendliche Musik aktiv nutzen, um ihre Identität zu formen, sich von anderen abzugrenzen und soziale Kompetenzen innerhalb einer Szene zu erwerben.
Ist die Heavy-Metal-Szene schädlich für Jugendliche?
Nein, Studien zeigen, dass die Szene oft als stabiler sozialer Raum fungiert, der den Zusammenhalt fördert und Vorurteile gegenüber Heavy Metal meist unbegründet sind.
Was sind "unsichtbare Bildungsprogramme" in Jugendszenen?
Dies sind informelle Lernprozesse, durch die Jugendliche Kompetenzen wie Organisationsfähigkeit, technisches Wissen oder soziale Integration erlernen, ohne dass dies als formale Bildung deklariert ist.
Welche Rolle spielt der "Habitus" nach Bourdieu im Heavy Metal?
Der Metal-Stil (Kleidung, Verhalten, Geschmack) dient als Distinktionsmittel, um Zugehörigkeit zur Szene zu signalisieren und sich von der Mehrheitsgesellschaft abzugrenzen.
Welche Kompetenzen erwerben Jugendliche in der Metal-Szene?
Das Spektrum reicht von basalen szeneinternen Regeln bis hin zu berufspraktischen Fähigkeiten, etwa durch das Organisieren von Konzerten oder das Betreiben von Fanzines.
- Quote paper
- Jan Zintel (Author), 2015, Musikalische Selbstsozialisation Jugendlicher im Heavy Metal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307950