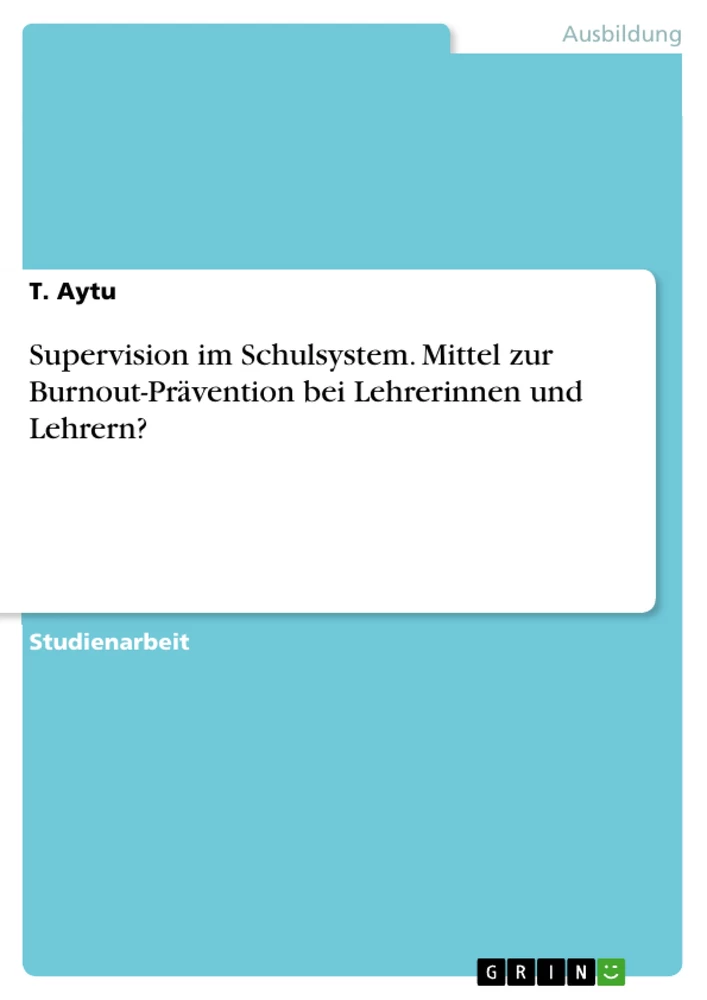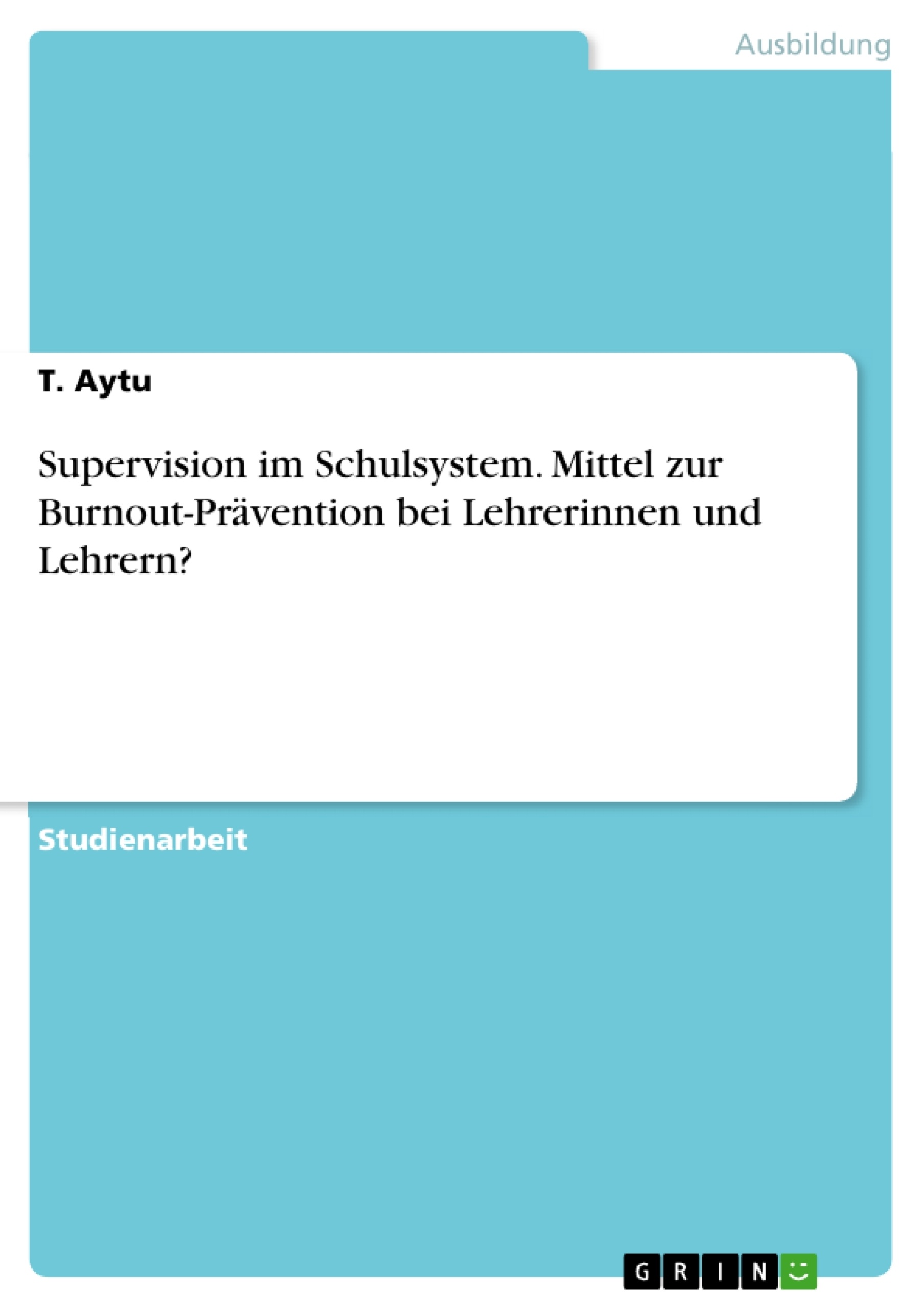In der vorliegenden Arbeit wird das Konzept der Supervision als Beratungs- und Unterstützungsoption im Arbeitsfeld Schule mit speziellem Fokus auf den Lehrerberuf analysiert und besonders geschaut, ob es ein adäquates Mittel zur Burnout-Prävention bei Lehrern und Lehrerinnen darstellt. Zunächst wird hierzu der Begriff ‚Supervision‘ definiert, indem historisch der Weg der Supervisionsarbeit in die Institution Schule aufzeigt wird. Daraufhin wird zunächst die Notwendigkeit des Gebrauchs der Supervision im Schulsystem allgemein genannt, um spezifisch auf den Lehrerberuf eingehen zu können. Welchen enormen Belastungen die Lehrer/innen ausgestellt sind und welche Bedeutung der Prävention des Burnout-Syndroms durch den Einsatz verschiedener Supervisionsansätze und -Settings wird in den weiterführenden Kapiteln nachgegangen, um herauszufinden ob die Supervision bei Lehrer und Lehrerinnen das Burnout-Syndrom vorsorglich verhindern kann.
Die Institution Schule gekoppelt mit dem Thema Bildung genießt in unserer Gesellschaft höchste Priorität, denn ein wichtiger Teil der Sozialisation der Kinder und Jugendlichen findet im Schulsystem statt. Lehrer und Lehrerinnen stehen aufgrund ihres wandelnden Images im gesellschaftlichen Umfeld und dem beklagten Bildungsnotstand in Deutschland bereits unter großem Druck. Ergänzt wird dieser aber noch durch problematische Ereignisse im Unterricht, Leistungsdruck, Erwartungen von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sowie der Schulleitung. Des Weiteren stellen Lehrkräfte sich selber enorme Ansprüche, welche den Wettbewerb mit der Konkurrenz anstacheln und zu mangelnde Unterstützung durch Kolleg/innen führen.
Diese immense Problematik der Lehrenden spiegelt sich gezwungenermaßen auch im Arbeitsfeld der Schule wieder, sodass in den letzten Jahren immer mehr Hilfe in außerschulischen Bereichen zur Konfliktlösung, Entlastung und Beratung der Lehrkräfte herangezogen werden. Die „Supervision“ entspricht einer Beratungsform, welcher ursprünglich aus dem außerschulischen Bereich stammt, sich jedoch - mehr oder weniger willkommen - zunehmend im Arbeitsfeld Schule und in der beruflichen Weiterbildung von Lehrern etabliert, wie hier gezeigt werden soll.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung.
- 2. Was ist Supervision? – Begriff, Entwicklung und Definition…........
- 3. Supervision im Schulsystem.
- 4. Supervision für Lehrende
- 4.1 Belastungen im Berufsfeld
- 4.2 Die Burnout-Gefahr im Lehrerberuf.
- 4.3 Gegenstand und Ziel der Supervision.......
- 4.4 Settings und Ansätze.
- 4.4.1 Die Rolle des Supervisors bzw. der Supervisorin….......
- 4.4.2 Die Einzelsupervision.....
- 4.4.3 Die Gruppensupervision......
- 4.4.3.1 Die Kollegiale Supervision / Intervision .......
- 5. Zusammenfassung und Fazit.
- 6. Quellen-/Literaturverzeichnis......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert das Konzept der Supervision als Beratungs- und Unterstützungsoption im Arbeitsfeld Schule, mit besonderem Fokus auf den Lehrerberuf. Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Supervision für die Prävention des Burnout-Syndroms bei Lehrern und Lehrerinnen.
- Die historische Entwicklung des Begriffs „Supervision“ und seine Bedeutung im Schulsystem
- Die Belastungen im Lehrerberuf und die damit verbundene Burnout-Gefahr
- Die Rolle der Supervision bei der Prävention von Burnout im Lehrerberuf
- Die verschiedenen Settings und Ansätze der Supervision im Schulsystem
- Die Bedeutung der Reflexion und Selbststeuerung für Lehrer und Lehrerinnen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Problematik des Lehrerberufs im Kontext des Bildungssystems dar und führt den Begriff der Supervision als mögliches Mittel zur Burnout-Prävention ein.
Kapitel 2 analysiert den Begriff „Supervision“ in seiner historischen Entwicklung und definiert die verschiedenen Ansätze und Methoden der Supervision.
Kapitel 3 untersucht die Notwendigkeit von Supervision im Schulsystem und die Bedeutung der Supervision für die Unterstützung von Lehrkräften in Veränderungsprozessen.
Kapitel 4 befasst sich mit den Belastungen im Lehrerberuf und der Burnout-Gefahr. Es beleuchtet die Bedeutung der Supervision für die Bewältigung von Stress und für die Steigerung der Resilienz von Lehrkräften.
Schlüsselwörter (Keywords)
Supervision, Burnout-Prävention, Lehrerberuf, Schulsystem, Belastungen, Reflexion, Selbststeuerung, Settings, Ansätze, Kollegiale Supervision / Intervision, Einzelsupervision, Gruppensupervision.
Häufig gestellte Fragen
Kann Supervision Burnout bei Lehrkräften verhindern?
Die Arbeit analysiert Supervision als adäquates Mittel zur Burnout-Prävention, da sie Lehrkräften hilft, berufliche Belastungen zu reflektieren und ihre Resilienz zu stärken.
Welchen Belastungen sind Lehrer und Lehrerinnen ausgesetzt?
Zu den Hauptbelastungen zählen problematische Unterrichtssituationen, Leistungsdruck, hohe Erwartungen von Eltern und Schulleitung sowie mangelnde Unterstützung im Kollegium.
Was ist der Unterschied zwischen Einzelsupervision und Gruppensupervision?
Einzelsupervision konzentriert sich auf die individuellen Anliegen einer Lehrkraft, während Gruppensupervision den Austausch mit Kollegen ermöglicht, um gemeinsame Lösungen für Schulprobleme zu finden.
Was versteht man unter „Kollegialer Supervision“ (Intervision)?
Hierbei beraten sich Lehrkräfte gegenseitig ohne einen externen Supervisor. Es ist ein kostengünstiges Setting, das die Selbststeuerung und den Zusammenhalt im Team fördert.
Welche Rolle hat ein Supervisor im Schulsystem?
Der Supervisor fungiert als neutraler Berater, der Reflexionsprozesse anstößt, hilft, Perspektiven zu wechseln und die professionelle Distanz zum oft stressigen Arbeitsalltag wiederherzustellen.
Warum nimmt der Bedarf an Supervision an Schulen zu?
Durch das wandelnde Image des Lehrerberufs und den beklagten Bildungsnotstand stehen Lehrkräfte unter immer größerem Druck, was professionelle Hilfe zur Konfliktlösung und Entlastung notwendig macht.
- Arbeit zitieren
- T. Aytu (Autor:in), 2015, Supervision im Schulsystem. Mittel zur Burnout-Prävention bei Lehrerinnen und Lehrern?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308002