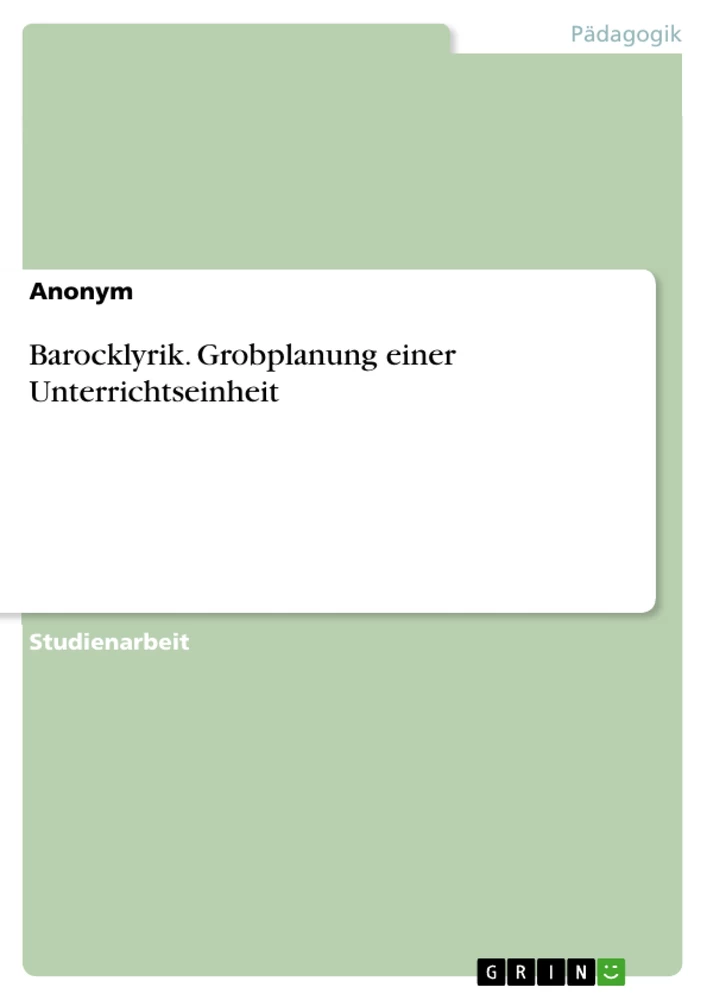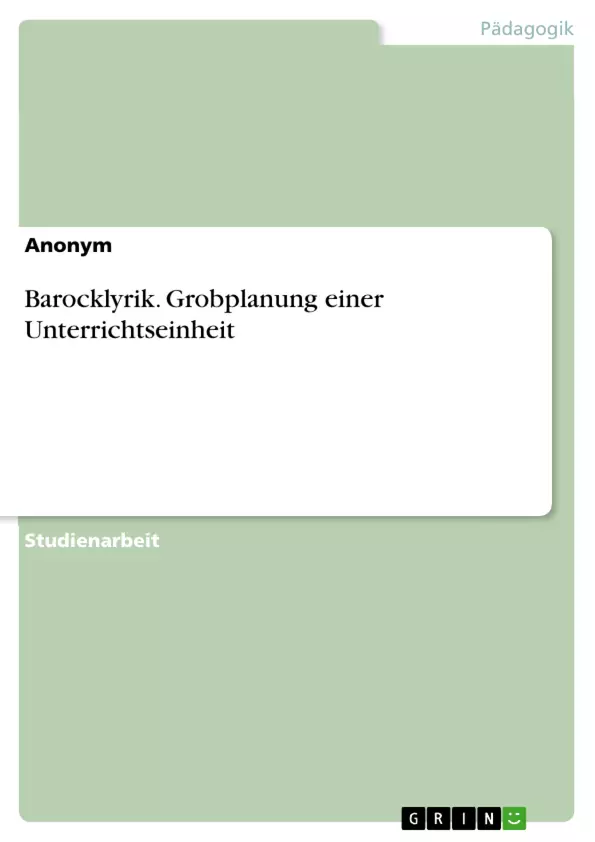Die Unterrichtseinheit „Barocklyrik“ soll die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zur selbstständigen (analytischen) Aufschlüsselung und Interpretation barocker Gedichte hinführen.
Um einen Einstieg zu gewährleisten, der sowohl Motivation schafft als auch Vorkenntnisse und Vorerfahrungen in Erinnerung ruft, wurde ein lehrerzentrierter anschaulicher Unterrichtseinstieg gewählt. Dazu erstellt die Lehrkraft zu Unterrichtsbeginn an der Tafel gemeinsam mit den SuS eine Mindmap zum Thema „Barock“. Dabei sind Erwähnungen aus jeglichen Bereichen (Kunst, Musik, Literatur, etc.) möglich. Somit wurde ein gewisser Grad an Informationen preisgegeben, den es im Folgenden zu erhöhen gilt. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einführung
- Tod und Vergänglichkeit: Vanitas als barockes Lebensgefühl
- Andreas Gryphius: „Thränen des Vaterlandes“
- Andreas Gryphius: „Alles ist eitel“
- Simon Dach: „Letzte Rede“
- Lebenslust und Lebensgier: Carpe diem!
- Martin Opitz: \"Ach Liebste, lass uns eilen\"
- Kompetenzen der Unterrichtseinheit
- Sicherung
- Form der Sicherung
- Beispielaufgabe
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Unterrichtseinheit zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zur selbstständigen Analyse und Interpretation barockzeitlicher Gedichte zu befähigen.
- Das Vanitas-Motiv und die Vergänglichkeit des Lebens als zentrales Thema der Barocklyrik
- Die Darstellung von Krieg und Leid in der Barocklyrik
- Die Rolle der Religion und des christlichen Glaubens in der Barockzeit
- Die Bedeutung der Form und des Metrums in der Barocklyrik
- Die Analyse von Gedichten durch verschiedene Methoden (z. B. Sachanalyse, Interpretation)
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einführung: Die Unterrichtseinheit „Barocklyrik“ soll die Schülerinnen und Schüler mit den wichtigsten Aspekten und Themen dieser Epoche vertraut machen. Ein lehrerzentrierter Unterrichtseinstieg soll Motivation schaffen und Vorwissen aktivieren. Der Fokus liegt auf der Kontrastwirkung von Pracht und Zerstörung, die die Barockzeit prägte.
- Tod und Vergänglichkeit: Vanitas als barockes Lebensgefühl: Die Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit Gedichten, die sich mit dem Thema der Vergänglichkeit und dem Vanitas-Motiv auseinandersetzen.
- Andreas Gryphius: „Thränen des Vaterlandes“: Analyse des Gedichts „Thränen des Vaterlandes“ von Andreas Gryphius, das die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges schildert und die Verzweiflung der Bevölkerung in den Vordergrund stellt. Die Analyse umfasst den Aufbau, den Inhalt und die sprachlichen Mittel.
Schlüsselwörter (Keywords)
Barocklyrik, Vanitas-Motiv, Tod und Vergänglichkeit, Krieg, Leid, Religion, Form, Metrum, Sachanalyse, Interpretation, Andreas Gryphius, „Thränen des Vaterlandes“, Dreißigjähriger Krieg.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Motive der Barocklyrik?
Die wichtigsten Motive sind Vanitas (Vergänglichkeit), Memento Mori (Gedenke des Todes) und Carpe Diem (Nutze den Tag).
Welches Gedicht von Andreas Gryphius wird im Unterricht behandelt?
Die Einheit analysiert unter anderem „Thränen des Vaterlandes“, welches die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges thematisiert.
Welches Ziel verfolgt die Unterrichtseinheit "Barocklyrik"?
Schüler der Sekundarstufe I sollen zur selbstständigen analytischen Aufschlüsselung und Interpretation barocker Gedichte befähigt werden.
Warum spielt der Dreißigjährige Krieg eine so große Rolle?
Der Krieg prägte das Lebensgefühl der Epoche durch allgegenwärtiges Leid, Tod und Zerstörung, was sich in der Lyrik als Vanitas-Motiv widerspiegelt.
Was bedeutet "Carpe Diem" im Kontext des Barock?
Es ist der Aufruf zur Lebenslust als Gegenpol zur allgegenwärtigen Todesgefahr, beispielhaft gezeigt an Martin Opitz' „Ach Liebste, lass uns eilen“.
Welche formalen Merkmale sind typisch für barocke Gedichte?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Form und Metrum, insbesondere des Sonetts und des Alexandriners, für die Lyrik dieser Zeit.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Barocklyrik. Grobplanung einer Unterrichtseinheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308082