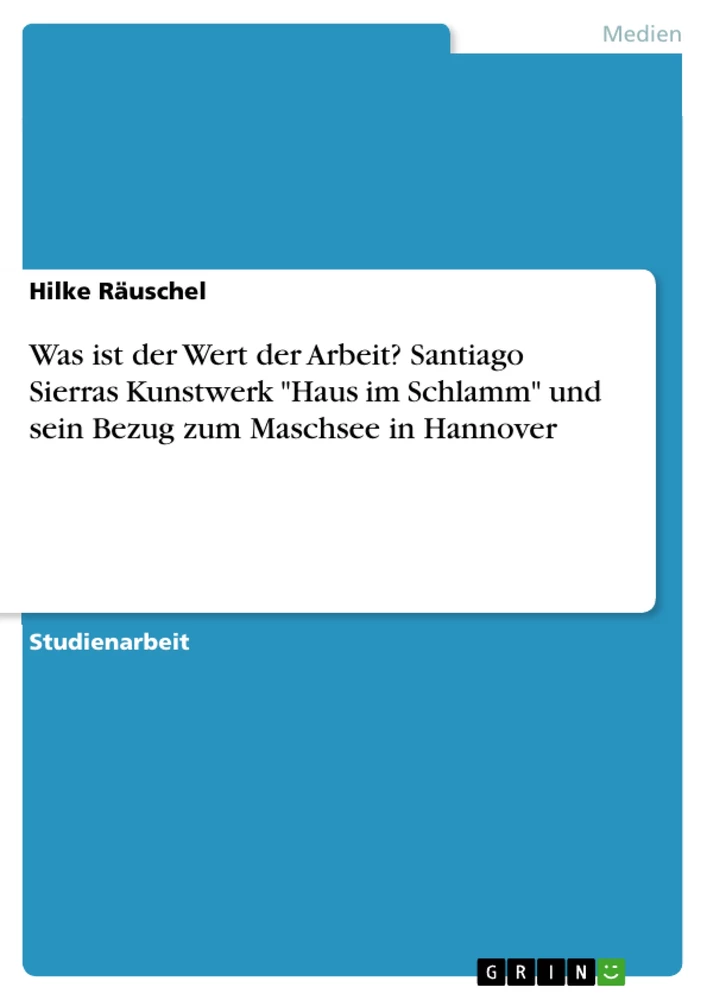Diese Arbeit befasst sich mit dem Werk “Haus im Schlamm” von Santiago Sierra. Für dieses Kunstwerk ließ Sierra im Jahr 2005 circa 320 m³ Schlamm in das Erdgeschoss der Kestnergesellschaft in Hannover einbringen. Der historische Kontext spielt bei der Analyse dieses Werks eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund geht die Autorin auf die Geschichte des Maschsees ein, eines in den 1930er Jahren künstlich angelegten Sees.
Dabei geht Sie in Ihrer Analyse über die Bezugnahme auf das Dritte Reich hinaus und diskutiert das „Haus im Schlamm“ unter Berücksichtigung von Sierras Intentionen und ihrer künstlerischen Übersetzung. Sie zeigt außerdem auf, wie extrem widerständig der Charakter von Sierras Werk ist und wie wichtig es für das Verständnis ist, eine genauere Vorstellung, ein deutlicheres Bild von Santiago Sierra als Künstler zu erhalten. Zur Orientierung werden mehrere andere Werke, nicht nur von Sierra, herangezogen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Im Visier
- Die Arbeit 'Haus im Schlamm'
- Die Geschichte des Maschsees in Hannover
- Die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Arbeit
- Die Intentionen und ihre künstlerische Übersetzung
- Fazit
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert Santiago Sierras Kunstwerk "Haus im Schlamm" und beleuchtet dessen widerständigen Charakter im Kontext der Geschichte des Maschsees in Hannover. Der Fokus liegt auf der Intention des Künstlers, die soziale und historische Dimension des Materials Schlamm im Werk zu vermitteln und den Betrachter zu einem aktiven Mitwisser zu machen.
- Analyse der Installation "Haus im Schlamm" und deren Kontextualisierung im Bezug auf den Maschsee
- Kritik an der Instrumentalisierung von Menschen in Sierras Kunst
- Untersuchung der sozialen und historischen Bedeutung von Materialien in der Kunst
- Betrachtung der Reaktion des Publikums auf die Arbeit
- Hervorhebung der Ortsbezogenheit und der zeitlichen Dimension von Sierras Kunst
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung gibt einen Überblick über Santiago Sierras künstlerisches Schaffen und stellt seine provokanten Methoden sowie die Intentionen hinter seinen Werken vor.
- Das Kapitel "Im Visier" behandelt die Arbeit "Haus im Schlamm" und beschreibt die Installation, ihre Entstehung und die Reaktion des Publikums. Es beleuchtet die Bedeutung des Maschsees im Kontext der Geschichte Hannovers und die Intention des Künstlers, das Material Schlamm als Spiegel der Vergangenheit zu verwenden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Santiago Sierra, "Haus im Schlamm", Maschsee, Hannover, Installation, soziale und historische Dimension von Materialien, Kunst, Betrachter, Reaktion, Widerstand, temporäre Kunst, Ortsbezogenheit, temporäre Aktionen, Dokumentationsformen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kunstwerk "Haus im Schlamm" von Santiago Sierra?
Es handelt sich um eine Installation aus dem Jahr 2005, bei der Sierra 320 m³ Schlamm in das Erdgeschoss der Kestnergesellschaft in Hannover einbringen ließ.
Welchen Bezug hat das Werk zum Maschsee in Hannover?
Der Schlamm stammte aus dem Maschsee, der in den 1930er Jahren künstlich angelegt wurde. Das Werk reflektiert die historische und soziale Dimension dieses Ortes.
Was ist die Intention von Santiago Sierra?
Sierra möchte den Betrachter zum "aktiven Mitwisser" machen und nutzt Materialien wie Schlamm als Spiegel der Vergangenheit und gesellschaftlicher Missstände.
Warum gilt Sierras Werk als widerständig?
Seine Kunst ist oft provokant, ortsbezogen und temporär; sie widersetzt sich klassischer Ästhetik und thematisiert stattdessen die Instrumentalisierung von Menschen.
Welche Rolle spielt der historische Kontext des Dritten Reichs?
Da der Maschsee in der Zeit des Nationalsozialismus entstand, dient die Installation auch als Auseinandersetzung mit dieser spezifischen deutschen Geschichte.
- Arbeit zitieren
- Hilke Räuschel (Autor:in), 2011, Was ist der Wert der Arbeit? Santiago Sierras Kunstwerk "Haus im Schlamm" und sein Bezug zum Maschsee in Hannover, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308156