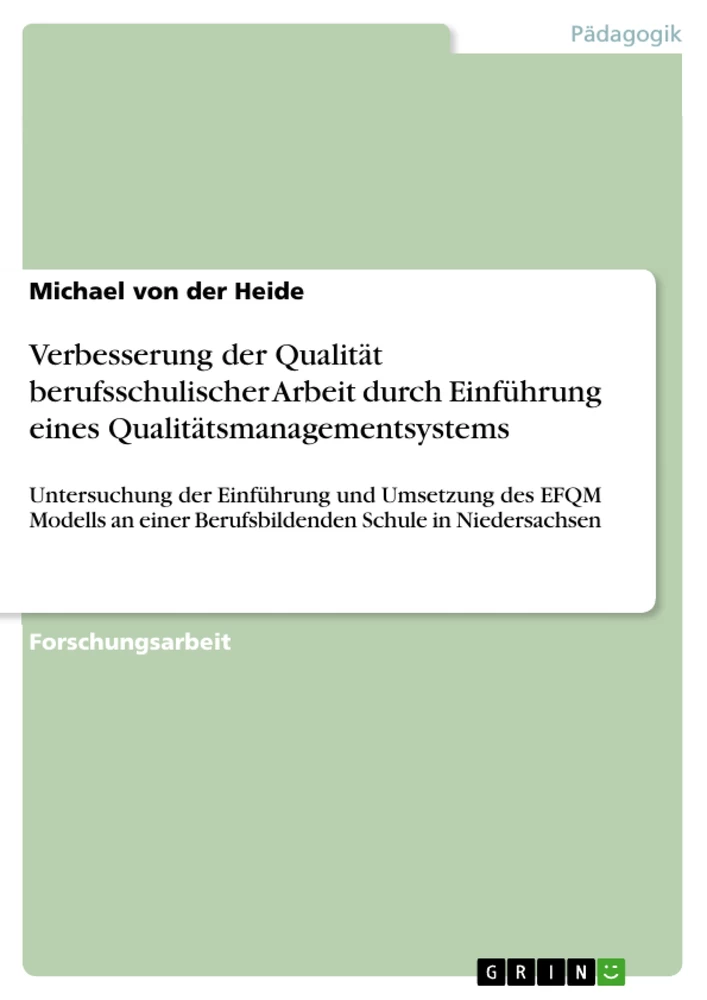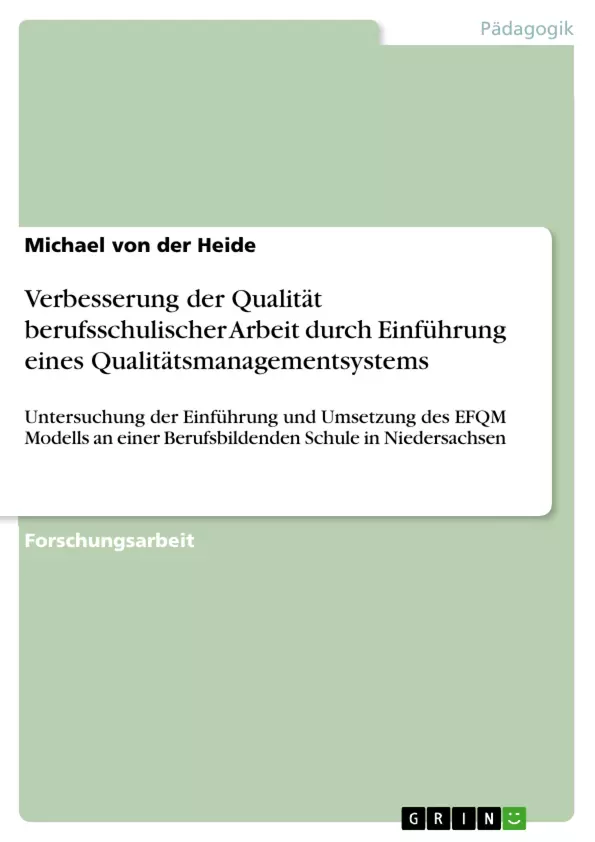Etwa seit Beginn des Jahrtausends werden Qualitätsmanagementsysteme in deutschen berufsbildenden Schulen verstärkt eingesetzt. Die Nutzung dieser Systeme ist eine direkte Folge der Diskussion um strukturelle Verbesserungen des Berufsbildungssystems. Unter dem Oberbegriff Regionale Kompetenzzentren wurden in der Folge dieser Diskussion Modellversuche durchgeführt, die eine strukturelle und organisatorische Entwicklung der Schulen zum Ziel hatten. Kern der Entwicklung der berufsbildenden Schulen zu Regionalen Kompetenzzentren war eine angestrebte Transformation der Schulen zu regionalen Dienstleistern. Gegenüber der bisherigen weitgehenden Abhängigkeit von der Schulverwaltung sollten sie auf diesem Reform-weg ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit erhalten. In diesem Kontext sollen Qualitätsmanagementsysteme als Instrument der inneren Schulentwicklung sowie als Kontroll- und Steuerungsinstrument dienen. In Deutschland wurden vor allem die Qualitätsmanagementsysteme der European Foundation for Quality Management, das Modell Qualität durch Evaluation und Entwicklung, sowie das Qualitätsmanagementsystem ISO 9000 ff für den Einsatz in berufsbildenden Schulen diskutiert und erprobt.
In Niedersachsen wurde in dem Schulversuch „Projekt Regionale Kompetenzzentren (ProReKo)“ das Qualitätsmanagementsystem der European Foundation for Quality Management, kurz EFQM-Modell, zunächst an beteiligten Schulen eingeführt. Das EFQM-Modell war durch seine zentrale Rolle innerhalb des Schulversuchs in besonderem Maße dafür verantwortlich, die sogenannten Globalziele des Schulversuchs, (1) die Schulen zu regional- und kundenorientierten Dienstleistern zu entwickeln und (2) die Qualität der Arbeit der Schulen messbar zu verbessern, zu erreichen. Das EFQM-Modell wurde noch im laufenden Schulversuch für alle anderen niedersächsischen berufsbildenden Schulen verpflichtend eingeführt. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
-
- Einführung und Problemstellung
- Zentrale Fragestellungen und Ziel der Untersuchung
- Zum Aufbau
-
- Weiterentwicklung der berufsbildende Schulen im Sinne des Dänischen Modells und Regionale Kompetenzzentren
- Einfluss des New Public Managements auf die Entwicklung der berufsbildenden Schulen in Regionale Kompetenzzentren
- Komponenten von NPM
- Komponenten des NPM in berufsbildenden Schulen
- Zwischenfazit
- Schulversuch „Berufsbildende Schulen in Niedersachsen als Regionale Kompetenzzentren“ (ProReko)
- Organisation des Schulversuchs auf Landesebene
- Projektstruktur und Arbeitsfelder
- Arbeitsfeld Qualitätsmanagement
- Diskussion der Rolle des Arbeitsfelds Qualitätsmanagement im Schulversuch ProReKo
- Umsetzung des Schulversuchs ProReko an der untersuchten Schule
- Charakteristika der untersuchten Schule
- Projektorganisation auf Schulebene
- Arbeitsfeld Qualitätsmanagement
- Fazit
-
- Zum Begriff „Qualität“
- Allgemeine Definition des Qualitätsbegriffs
- Der Qualitätsbegriff in der Berufsbildung
- Qualitätsmanagement an berufsbildenden Schulen
- Die Qualitätsnorm DIN EN ISO 9000ff
- Das Q2E-Modell
- Das Modell der "European Foundation for Quality Management" (EFQM)
- Struktureller Aufbau des EFQM-Modells
- Selbstbewertung mit dem EFQM-Modell
- Kriterienbasierte, vergleichende Analyse der Qualitätsmanagementsysteme
- Kriterium 1: Kriterien und Standards
- Kriterium 2: Referentielle Systematik
- Kriterium 3: Benchmark
- Ergebnis der vergleichenden Analyse
-
- Leitende Fragen und Ziel der Untersuchung
- Methode
- Begründung des Untersuchungsdesigns
-
- Ergebnis der Analyse der Selbstbewertungen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Reflexion des methodischen Vorgehens
-
- Ergebnis der Analyse der messbaren Verbesserung
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Reflexion des methodischen Vorgehens
-
- Zusammenfassung der Ergebnisse der Systematik der Anwendung des EFQM-Modells
- Zusammenfassung der Ergebnisse der messbaren Verbesserungen der Qualität der schulischen Arbeit
- Desiderata
- Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Untersuchung befasst sich mit der Verbesserung der Qualität berufsschulischer Arbeit durch die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems. Sie analysiert den Einfluss des New Public Managements (NPM) auf die Entwicklung von berufsbildenden Schulen im Kontext des Schulversuchs „Berufsbildende Schulen in Niedersachsen als Regionale Kompetenzzentren“ (ProReko). Die Studie untersucht die Implementierung des EFQM-Modells an einer berufsbildenden Schule und bewertet dessen Auswirkungen auf die Qualität der schulischen Arbeit. Darüber hinaus werden verschiedene Qualitätsmanagementsysteme verglichen und deren Eignung für den Einsatz an berufsbildenden Schulen beurteilt.
- Einführung und Analyse des New Public Managements (NPM) im Kontext von berufsbildenden Schulen
- Bewertung der Auswirkungen des Schulversuchs ProReko auf die Qualität berufsbildender Arbeit
- Implementierung und Anwendung des EFQM-Modells an einer berufsbildenden Schule
- Vergleich verschiedener Qualitätsmanagementsysteme für den Einsatz an berufsbildenden Schulen
- Bewertung der messbaren Verbesserungen der Qualität schulischer Arbeit durch den Einsatz des EFQM-Modells
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Qualitätsverbesserung in der berufsbildenden Schule ein. Es werden die zentrale Fragestellung und das Ziel der Untersuchung definiert. Das zweite Kapitel befasst sich mit Qualitätsmanagement in regionalen Kompetenzzentren und dem Schulversuch ProReko. Es werden die Entwicklungen im Sinne des Dänischen Modells, der Einfluss des NPM und die Organisation des Schulversuchs auf Landesebene beleuchtet. Kapitel drei bietet eine Übersicht über Qualitätsmanagementsysteme an berufsbildenden Schulen, darunter die Qualitätsnorm DIN EN ISO 9000ff, das Q2E-Modell und das EFQM-Modell. Das vierte Kapitel beschreibt das Untersuchungsdesign der Studie, die Leitenden Fragen, die gewählte Methode und die Begründung des Designs. Kapitel fünf analysiert die Selbstbewertungen der Schule im Hinblick auf die Anwendung des EFQM-Modells. Kapitel sechs untersucht die messbaren Verbesserungen der Qualität der schulischen Arbeit durch den Einsatz des EFQM-Modells.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Studie behandelt die Themen Qualitätsmanagement, berufsbildende Schulen, New Public Management (NPM), Regionalisierung, Schulversuch ProReko, EFQM-Modell, Selbstbewertung, Qualitätsverbesserung, messbare Verbesserungen, Vergleich verschiedener Qualitätsmanagementsysteme, DIN EN ISO 9000ff, Q2E-Modell, und Qualitätsbegriff in der Berufsbildung. Die Untersuchung basiert auf empirischen Daten und analysiert die Umsetzung von Qualitätsmanagementsystemen in der Praxis. Die Ergebnisse können als Grundlage für die Weiterentwicklung von Qualitätsmanagement in berufsbildenden Schulen dienen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Projekts ProReKo in Niedersachsen?
Das Projekt "Regionale Kompetenzzentren" (ProReKo) zielte darauf ab, berufsbildende Schulen zu eigenverantwortlichen, kundenorientierten Dienstleistern zu entwickeln und die Qualität ihrer Arbeit messbar zu steigern.
Wie beeinflusst New Public Management (NPM) die Schulentwicklung?
NPM überträgt Managementkonzepte aus der Wirtschaft auf den öffentlichen Sektor, was in Schulen zu mehr Selbstständigkeit, Wettbewerbsorientierung und dem Einsatz von Qualitätsmanagementsystemen führt.
Was unterscheidet das EFQM-Modell von der DIN EN ISO 9000ff?
Während ISO 9000ff stark prozessorientiert ist, fokussiert das EFQM-Modell auf eine umfassende Selbstbewertung und kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen einer Organisation (Total Quality Management).
Was ist das Q2E-Modell im schulischen Qualitätsmanagement?
Q2E steht für "Qualität durch Evaluation und Entwicklung" und ist ein spezifisch für Schulen entwickeltes System, das die Feedbackkultur und interne Selbstevaluation betont.
Wie wird die Verbesserung der Schulqualität messbar gemacht?
Durch kriterienbasierte Analysen der Selbstbewertungen und den Vergleich von Leistungsindikatoren (Benchmarks) über verschiedene Zeiträume hinweg.
- Quote paper
- Magister Artium Michael von der Heide (Author), 2015, Verbesserung der Qualität berufsschulischer Arbeit durch Einführung eines Qualitätsmanagementsystems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308346