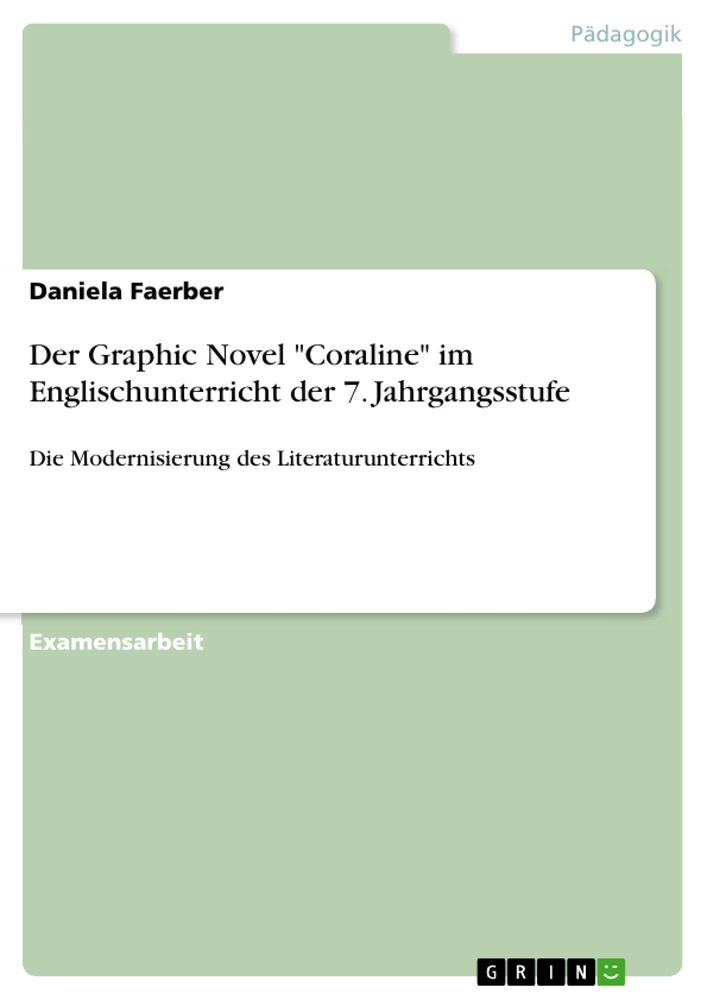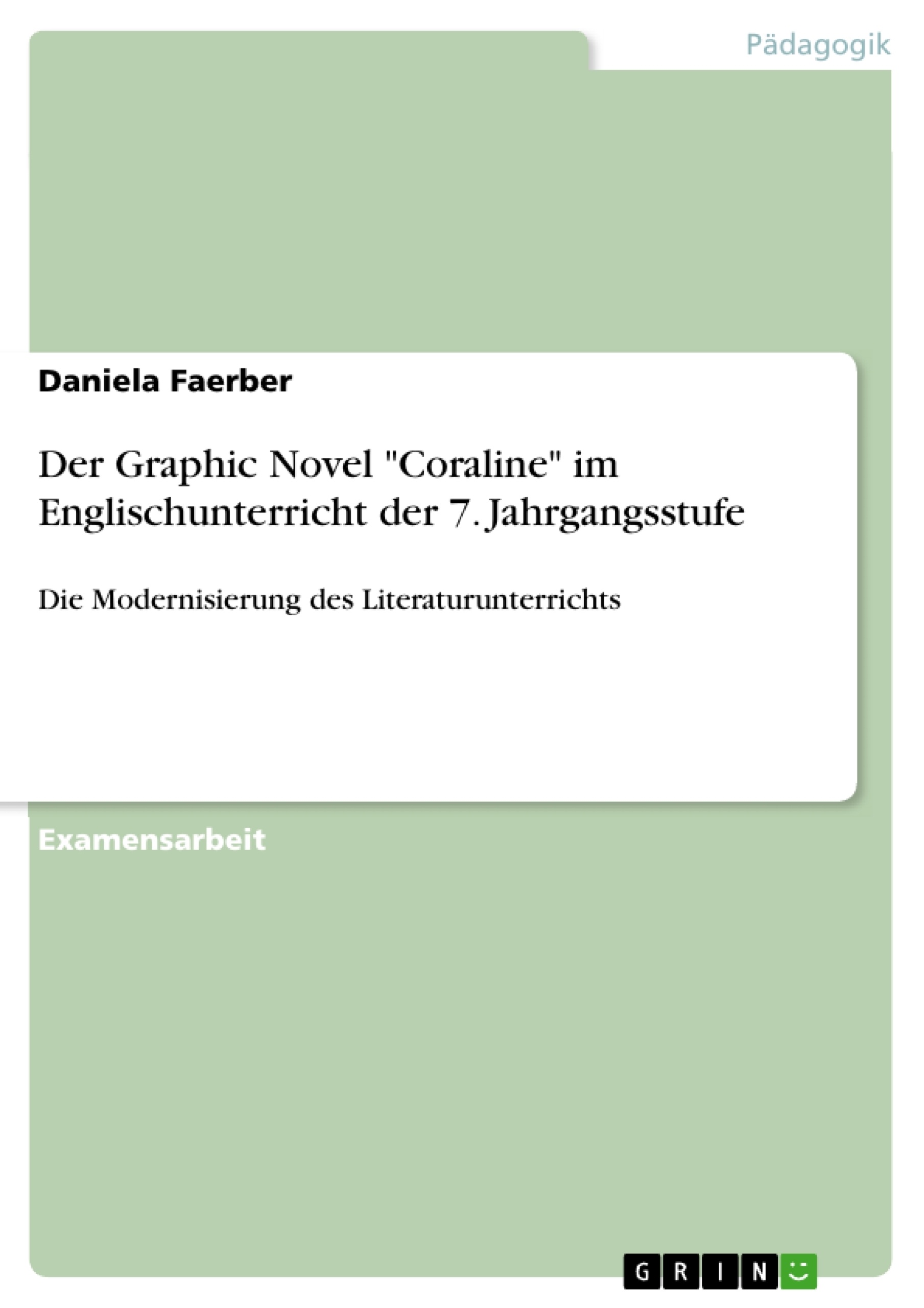Kinder lesen gerne. Nur eben oft nicht in der Schule. Die dort behandelten Lektüren heben zu häufig den moralischen Zeigefinger, sind zu problemorientiert sind oder es fehlt ihnen am nötigen „Schwung“, um die Schülerinnen und Schüler so zu begeistern, dass diese in bester Harry-Potter-Manier nicht dazu in der Lage sind, ihr Buch aus der Hand zu legen.
Durch eine Modernisierung des Kulturbegriffs kam es aber in den letzten Jahrzehnten nicht nur in den Schulen zu einem Wandel, der sich stärker an eben dieser Existentialsphäre der Schülerinnen und Schüler orientiert.
Die Behandlung von Graphic Novels im Unterricht ist eine Weiterentwicklung dieser Modernisierung und ein noch sehr junges Forschungsfeld auf dem Gebiet der Literatur. Während im angelsächsischen Bereich bereits verstärkt Graphic Novels ihren Weg in die Klassenzimmer gefunden haben, was nicht zuletzt aus der Literaturliste dieser Arbeit zu ersehen ist, steht ihnen in Deutschland immer noch ein gewisses Maß an Skepsis gegenüber. Nachdem Wolfgang Haller sich in den gängigen Fachzeitschriften nun aber der Thematik angenommen hat, scheint ein weiterer wichtiger Schritt getan, um diese Form der Literatur stärker in die Klassenzimmer zu integrieren.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Der Wandel des Kanons
- Theoretischer Teil
- Der Stellenwert literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht
- Gründe für die Behandlung einer Lektüre
- Vorgaben des bayerischen Lehrplans in Bezug auf Literatur
- Multimodale Romane und Graphic Novels
- Definition Multimodale Romane
- Versuch einer Definition des Begriffs Graphic Novels
- Die Bedeutung von Graphic Novels im Klassenzimmer
- Warum Graphic Novels?
- Multimodale Romane und Multiliteralität
- Visual Literacy
- Coraline als mögliche Lektüre im Englischunterricht der 7.Klasse
- Inhalt
- Sachanalyse
- Sonstige relevante Vorüberlegungen zum Buch
- Relevante Vorüberlegungen zum Lesen einer Graphic Novel
- Vorüberlegungen zum Lesen von Coraline in einer siebten Jahrgangsstufe
- Einbettung der Lektüre in die Sequenz
- Didaktisch-methodische Vorüberlegungen zur Lektüre der Graphic Novel Coraline
- Beobachtungen zur Klasse
- Bedeutung der Inhalte für die Schülerinnen und Schüler
- Lernziele der Unterrichtssequenz
- Der Stellenwert literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht
- Praxisteil
- Planung der Lektüresequenz
- Vorüberlegungen: Schwerpunktsetzung und Handlungsorientierung
- Grobsequenz: Ausführliche tabellarische Darstellung des Verlaufs
- Feinsequenz: Stundenverläufe
- Planung der Lektüresequenz
- Schlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Eignung der Graphic Novel „Coraline“ für den Englischunterricht der siebten Jahrgangsstufe. Sie setzt sich zum Ziel, die Relevanz von Graphic Novels im Unterricht aufzuzeigen und eine didaktisch-methodische Grundlage für die Verwendung des Buches im Unterricht zu schaffen.
- Die Bedeutung von Graphic Novels im Englischunterricht
- Didaktische Ansätze zur Arbeit mit Graphic Novels
- Die Relevanz von „Coraline“ für den Englischunterricht der 7. Jahrgangsstufe
- Die Einbettung der Graphic Novel in eine Unterrichtssequenz
- Methodische Ansätze für die Arbeit mit „Coraline“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Wandel des Kanons im Englischunterricht und thematisiert die wachsende Bedeutung von nicht-traditionellen Textformen, wie z.B. Graphic Novels.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem theoretischen Hintergrund der Arbeit mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht und erörtert die didaktischen und methodischen Aspekte der Verwendung von Graphic Novels im Unterricht.
Der dritte Teil der Arbeit stellt eine konkrete Planung der Lektüresequenz für „Coraline“ vor, die sich an den Besonderheiten des Buches und der 7. Jahrgangsstufe orientiert. Die Planung beinhaltet eine ausführliche tabellarische Darstellung des Verlaufs sowie detaillierte Stundenverläufe.
Schlüsselwörter (Keywords)
Graphic Novels, Englischunterricht, 7. Jahrgangsstufe, Coraline, Didaktik, Methodik, Unterrichtsplanung, Multiliteralität, Visual Literacy.
Häufig gestellte Fragen
Warum eignen sich Graphic Novels für den Englischunterricht?
Graphic Novels orientieren sich stärker an der Lebenswelt der Schüler, fördern die Lesemotivation und schulen die "Visual Literacy" durch die Kombination von Text und Bild.
Was ist das Ziel der Untersuchung von "Coraline" in der 7. Klasse?
Die Arbeit möchte die Eignung der Graphic Novel aufzeigen und eine didaktisch-methodische Grundlage für deren Einsatz im Fremdsprachenunterricht schaffen.
Was versteht man unter "Visual Literacy" im Unterrichtskontext?
Visual Literacy bezeichnet die Fähigkeit, visuelle Informationen (Bilder, Symbole) zu verstehen, zu interpretieren und im Zusammenhang mit Texten kritisch zu analysieren.
Welche Vorgaben macht der bayerische Lehrplan zu diesem Thema?
Die Arbeit untersucht die Vorgaben des Lehrplans in Bezug auf Literatur und zeigt auf, wie moderne Textformen wie Graphic Novels in den Kanon integriert werden können.
Wie ist die Unterrichtsplanung für "Coraline" aufgebaut?
Die Planung umfasst eine Grobsequenz (tabellarischer Verlauf) sowie detaillierte Feinsequenzen für die einzelnen Unterrichtsstunden, abgestimmt auf die 7. Jahrgangsstufe.
Was sind "multimodale Romane"?
Es handelt sich um Texte, die verschiedene Zeichensysteme (wie Schrift und Bild) nutzen, um Bedeutung zu generieren, wobei Graphic Novels eine prominente Form darstellen.
- Citation du texte
- Daniela Faerber (Auteur), 2015, Der Graphic Novel "Coraline" im Englischunterricht der 7. Jahrgangsstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308364