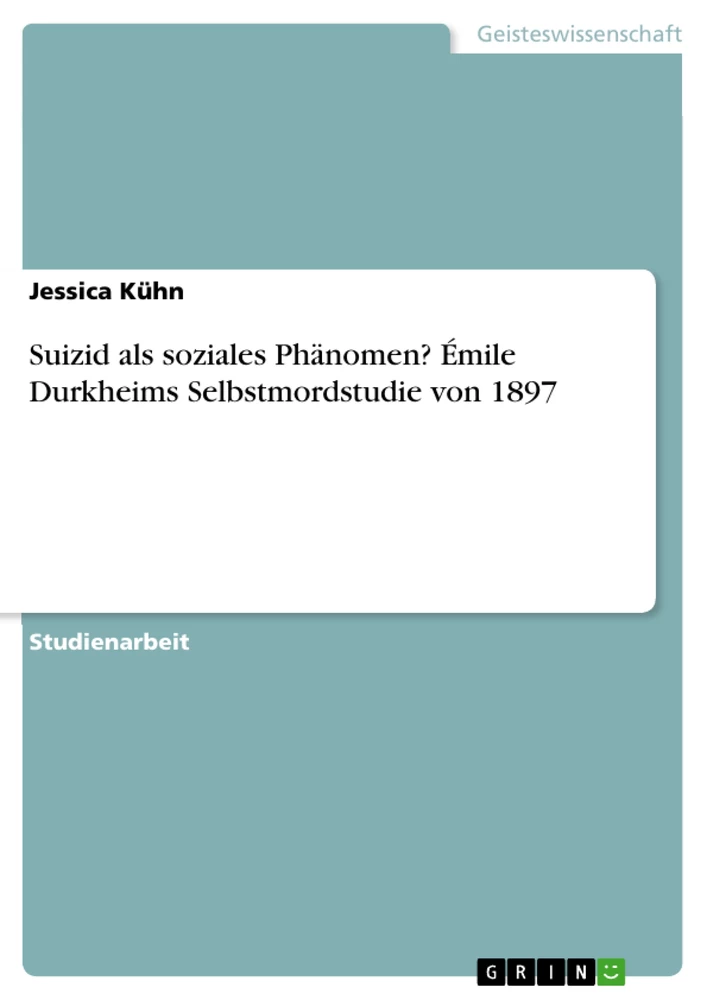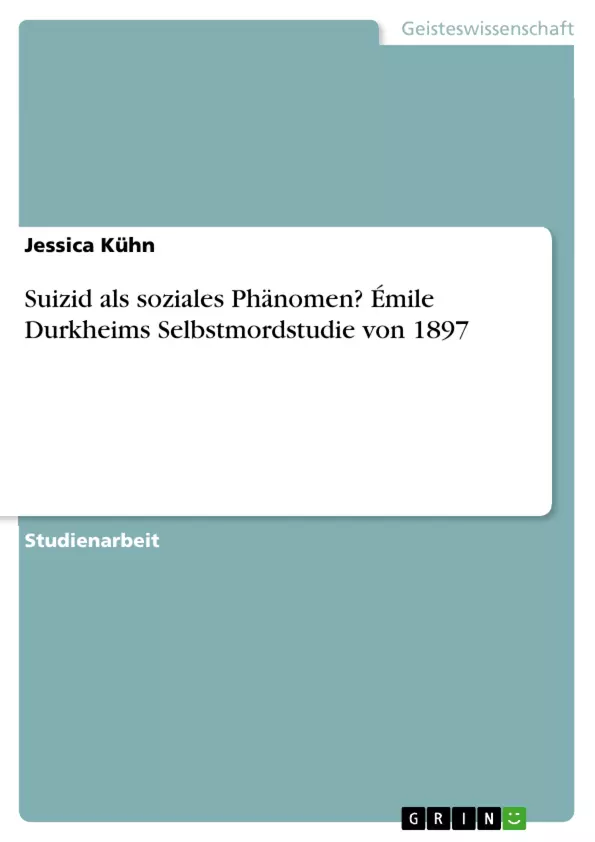Weltweit nehmen sich jährlich mehr als 800.000 Menschen das Leben – und auf jeden einzelnen Suizid kommen nochmals zehn bis zwanzig Selbstmordversuche (Jiménez, 2014, 1.Abs.). Obwohl Suizid demnach einen nicht unerheblichen Teil der Todesursachen ausmacht, wurde er lange öffentlich tabuisiert: Beispielsweise galt Selbstmord zu Zeiten altrömischer Herrschaft sowohl für Männer als auch für Frauen als „Verbrechen gegen die Gesellschaft“ (Rübenach, 2007).
Mit der Entwicklung des Denkens und der Gesellschaft änderte sich der Umgang mit der Thematik. In der Wissenschaft beschäftigen sich unterschiedliche Gebiete mit der Erklärung von Suiziden. Während Selbsttötung „nach psychiatrischem Verständnis als Ende einer krankhaften Entwicklung“ (Rübenach, 2007) gilt, untersucht der Fachbereich der Soziologie das Phänomen Selbstmord auf sozialer Ebene. Dazu gehört der Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und der Suizidrate in verschiedenen Gesellschaften. Bereits im 19. Jahrhundert thematisierte der französische Soziologe und Ethnologe Émile Durkheim in seiner Studie „Der Selbstmord“ diese Beziehungen. Durkheim untersucht hierbei nicht den Selbstmord anhand einzelner Fälle auf dessen individuelle Ursachen, sondern er betrachtet ihn streng soziologisch als soziales Phänomen mit ebenso sozialen Kriterien.
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Todesursache Suizid aus soziologischer Sicht. Zentral ist hierbei die inhaltliche Untersuchung Émile Durkheims Selbstmordstudie aus dem Jahr 1897. Daraus folgernd wird die Frage beantwortet, inwieweit Suizid objektiv betrachtet als soziales Phänomen betrachtet werden kann. Zu Beginn der Arbeit wird die Definition des Selbstmordbegriffes vorgestellt und erläutert, wie Durkheim zu dieser gelangte. Im Anschluss daran geht es zunächst um die Untersuchung außer-gesellschaftlicher Faktoren, bevor im nachfolgenden Kapitel die sozialen Aspekte begründet und die drei Selbstmordtypen vorgestellt werden. Darauf auf-bauend dient das sechste Kapitel dazu, herauszuarbeiten, wie Durkheim seine These rechtfertigt, Selbstmord als ein soziales Phänomen zu betrachten. Auf diesen Grund-lagen soll die Arbeit mit Beantwortung der anfangs gestellten Frage abschließen: Inwiefern kann Selbstmord nach Émile Durkheim als ein soziales Phänomen betrachtet werden??
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Definition des Selbstmordbegriffes nach Durkheim
- 3. Die soziale Selbstmordrate als ein Phänomen sui generis
- 3.1 Untersuchung außergesellschaftlicher Faktoren bei Selbsttötungen
- 3.1.1 Selbstmord und psychopathische Zustände
- 3.1.2 Selbstmord und psychologische Normalzustände, Rasse, Erblichkeit
- 3.1.3 Selbstmord und kosmische Faktoren
- 3.1.4 Nachahmung
- 3.2. Soziale Ursachen und soziale (Selbstmord) Typen
- 3.2.1 Bestimmungsverfahren
- 3.2.2 Der egoistische Selbstmord
- 3.2.3 Der altruistische Selbstmord
- 3.2.4 Der anomische Selbstmord
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Hausarbeit untersucht Émile Durkheims klassische Studie „Der Selbstmord“ aus dem Jahr 1897 und beleuchtet den Selbstmord aus soziologischer Perspektive. Die Arbeit analysiert, wie Durkheim Selbstmord als ein soziales Phänomen definiert und untersucht, welche sozialen Faktoren die Selbstmordrate beeinflussen.
- Definition des Selbstmordbegriffes nach Durkheim
- Untersuchung außergesellschaftlicher Faktoren bei Selbsttötungen
- Soziale Ursachen und soziale (Selbstmord) Typen
- Die soziale Selbstmordrate als ein Phänomen sui generis
- Durkheims These von Selbstmord als sozialem Phänomen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext des Themas Selbstmord dar und erklärt die Relevanz von Durkheims Studie. Sie skizziert den wissenschaftlichen Diskurs um den Selbstmord, von der Betrachtung als individuelles Phänomen hin zu einer soziologischen Perspektive. - Kapitel 2: Definition des Selbstmordbegriffes nach Durkheim
Durkheim analysiert den Selbstmordbegriff und entwickelt eine wissenschaftliche Definition, die sich von der umgangssprachlichen Bedeutung abgrenzt. Er untersucht die Kriterien für die Klassifizierung eines Todesfalls als Selbstmord und betont die Wichtigkeit des Wissens des Opfers über die Folgen seiner Handlung. - Kapitel 3: Die soziale Selbstmordrate als ein Phänomen sui generis
Durkheim argumentiert, dass die Selbstmordrate einer Gesellschaft ein soziales Phänomen ist und nicht auf individuelle Ursachen zurückzuführen ist. Er untersucht verschiedene außergesellschaftliche Faktoren wie psychische Störungen, Rasse und kosmische Faktoren, bevor er sich den sozialen Ursachen zuwendet. - Kapitel 3.1: Untersuchung außergesellschaftlicher Faktoren bei Selbsttötungen
Durkheim untersucht verschiedene außergesellschaftliche Faktoren, die Einfluss auf die Selbstmordrate haben könnten, wie psychische Störungen, Rasse, Erblichkeit und kosmische Einflüsse. Er zeigt, dass diese Faktoren nicht ausreichen, um die Selbstmordrate zu erklären. - Kapitel 3.2: Soziale Ursachen und soziale (Selbstmord) Typen
Durkheim analysiert die sozialen Ursachen von Selbstmord und entwickelt drei Typen: egoistischen, altruistischen und anomischen Selbstmord. Er erklärt, wie die Integration des Individuums in die Gesellschaft, die soziale Solidarität und die soziale Regulation die Selbstmordrate beeinflussen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit Émile Durkheims "Der Selbstmord", einem soziologischen Klassiker, der die soziale Selbstmordrate als ein Phänomen sui generis untersucht. Wichtige Schlüsselwörter sind: Selbstmord, Soziologie, soziale Integration, soziale Solidarität, soziale Regulation, egoistischer Selbstmord, altruistischer Selbstmord, anomischer Selbstmord, Selbstmordrate, gesellschaftliche Entwicklungen, Durkheim, Soziales Phänomen.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel von Durkheims Selbstmordstudie?
Durkheim wollte beweisen, dass Suizid kein rein individuelles, sondern ein soziales Phänomen ist, das durch gesellschaftliche Bedingungen erklärt werden kann.
Was versteht Durkheim unter einem „Phänomen sui generis“?
Er betrachtet die soziale Selbstmordrate als eine eigenständige Tatsache, die nicht durch die Summe individueller psychischer Zustände erklärbar ist.
Welche drei Haupttypen des Selbstmords definiert Durkheim?
Er unterscheidet den egoistischen, den altruistischen und den anomischen Selbstmord.
Was ist ein anomischer Selbstmord?
Dieser Typ tritt auf, wenn soziale Regulierungen fehlen oder instabil sind, oft infolge von wirtschaftlichen Krisen oder schnellem gesellschaftlichem Wandel.
Welchen Einfluss hat die soziale Integration auf die Suizidrate?
Laut Durkheim sinkt die Suizidrate bei moderater Integration; zu schwache (egoistisch) oder zu starke Integration (altruistisch) erhöhen das Risiko.
Warum schloss Durkheim kosmische Faktoren als Ursache aus?
Er analysierte Daten zu Klima und Jahreszeiten und stellte fest, dass diese keine konsistente Erklärung für die Schwankungen der Selbstmordraten bieten.
- Quote paper
- Jessica Kühn (Author), 2015, Suizid als soziales Phänomen? Émile Durkheims Selbstmordstudie von 1897, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308412