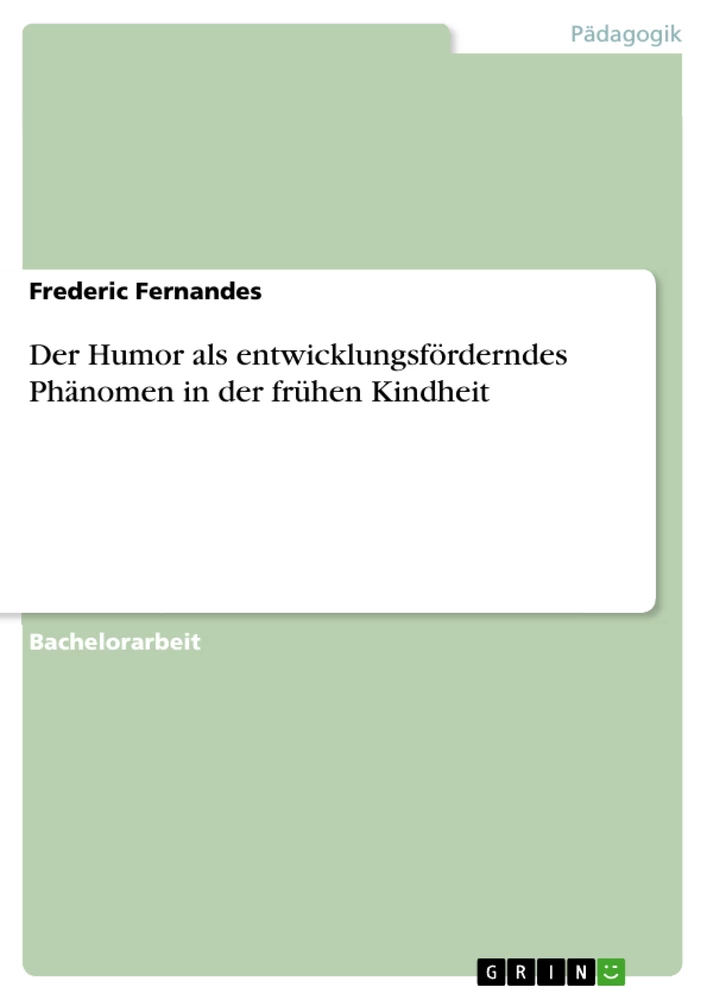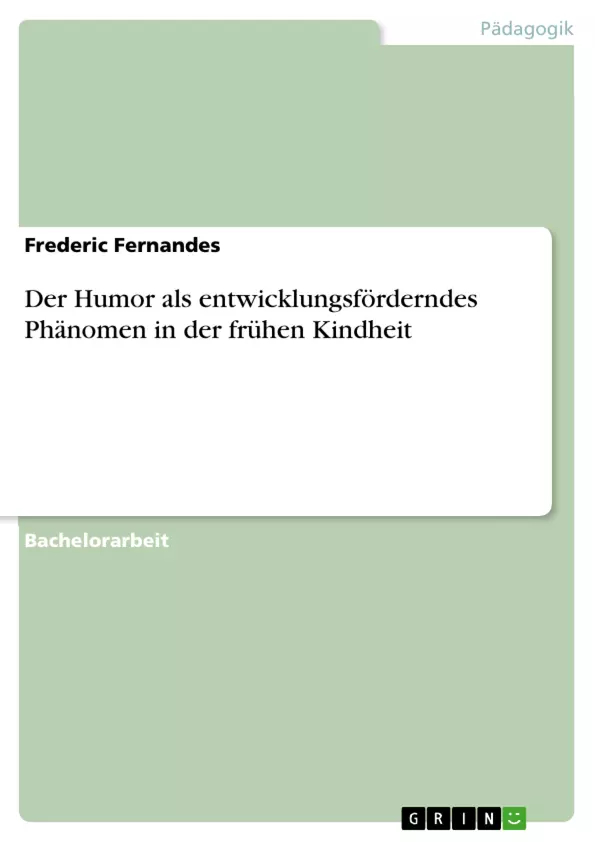Diese Arbeit setzt sich mit dem Phänomen Humor und seiner Relevanz für die individuelle Entwicklung in verschiedenen Bereichen während der Phase der frühen Kindheit auseinander. Menschen beschäftigen sich mit dem Humor und dem Lachen schon seit der griechischen Antike. In den darauffolgenden Jahrhunderten entstanden in verschiedenen Wissenschaftsbereichen vielzählige Ansätze zur Erklärung des Humors, bis schließlich in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts eine eigenständige Humorforschung im englischen Sprachraum gegründet wurde.
Anhand wissenschaftlicher Literatur aus verschiedenen Wissenschaftsfeldern wird in dieser Arbeit das Phänomen Humor definiert. Anschließend werden durch die Ausarbeitung entwicklungspsychologischer Werke die kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungsschritte in der frühen Kindheit umgerissen. Zum Schluss wird gezeigt, wie sich die Entfaltung wichtiger frühkindlicher Kompetenzen und diejenige des Humors gegenseitig bedingen.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Zitate
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Der Humor
2.1.1 Theorien zur Erklärung des Humors
2.1.2 Der frühkindliche Humor und seine Entwicklung
2.2 Die frühkindliche kognitive, emotionale und soziale Entwicklung
2.2.1 Kognitive Aspekte
2.2.2 Soziale und emotionale Aspekte
2.3 Neurobiologischer Exkurs: Motivationssyteme und Humor
3. Diskussion: Ist der Humor entwicklungsfördernd?
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
Abstract
Diese Arbeit setzt sich mit dem Phänomen Humor und seiner Relevanz für die individuelle Entwicklung in verschiedenen Bereichen während der Phase der frühen Kindheit auseinander. Menschen beschäftigen sich mit dem Humor und dem Lachen schon seit der griechischen Antike. In den darauffolgenden Jahrhunderten entstanden in verschiedenen Wissenschaftsbereichen vielzählige Ansätze zur Erklärung des Humors, bis schließlich in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts eine eigenständige Humorforschung im englischen Sprachraum gegründet wurde.
Anhand wissenschaftlicher Literatur aus verschiedenen Wissenschaftsfeldern wird in dieser Arbeit das Phänomen Humor definiert. Anschließend werden durch die Ausarbeitung entwicklungspsychologischer Werke die kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungsschritte in der frühen Kindheit umgerissen. Zum Schluss wird gezeigt, wie sich die Entfaltung wichtiger frühkindlicher Kompetenzen und diejenige des Humors gegenseitig bedingen.
Abstract
This work will take a critical look at the phenomenon humour and its relevance for the development in different individual fields during early childhood. People have contemplated humour and laughter since the ancient Greece. While the ensuing centuries, an abundance of approaches has been developed to explain humour, until an independent humour research has been created in English-speaking countries during the seventh decade of the 20th Century.
This work will define the humour phenomenon with the help of scientific literature from various science fields. Afterwards the cognitive, social and emotional development steps in the early childhood will be outlined with the help of works from the psychology of development. In conclusion, it will be demonstrated how much the evolvement of infant skills and of the humour condition each other.
Zitate
„Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.“ Charlie Chaplin
„Aller höhere Humor fängt damit an, daß man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt.“ Hermann Hesse
„Der Humor ist keine Gabe des Geistes, sondern des Herzens.“ Ludwig Börne
„Humor ist Liebe. Er macht die Unzulänglichkeiten etwas zulänglicher, den Schaden etwas leichter, den Schmerz etwas erträglicher. Nur die Überheblichkeit macht er lächerlich, die lacht er aus.“ Henri Nannen
„Sinn für das Komische verbindet.“ Ralph Waldo Emerson
„Wer über sich selbst lachen kann, wird am ehesten ernst genommen.“ Unbekannt
„Humor kann niemals fanatisch oder dogmatisch sein. Er ist immer menschlich und freundlich.“ Michael Ende
„Gibt es schließlich eine bessere Form mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor?“ Charles Dickens
„Wenn Leute lachen, sind sie fähig zu denken.“ Dalei Lama
1. Einleitung
Aus eigener Erfahrung während meiner Schullaufbahn in Frankreich konnte ich feststellen, dass das schulische Lernen selten vom Lachen begleitet war. Im pädagogischen Bereich schien (und scheint noch) oft ein gewisser Ernst zu herrschen, außer vielleicht bei den Kindern. Säuglinge und Kleinkinder lachen nämlich im Durchschnitt ungefähr 400 Mal am Tag, während Erwachsene nur annähernd 15 Mal dieses Vergnügen haben (vgl. Liebertz 2007, S. 11). Nicht umsonst spricht man auch vom „Ernst des Lebens“, wenn die Kinder die Schulzeit antreten. Aber woran liegt das? Muss pädagogische Arbeit wirklich ernst sein?
In ihrem Artikel über den Humor und den Witz in der Pädagogik greift Eggert-Schmid Noerr auf Theodor Adornos Aufsatz „Tabus über den Lehrerberuf“ zurück, um diese Frage zu beantworten. Sie führt die Humorlosigkeit auf eine fehlende Anerkennung ja sogar auf eine Geringschätzung des Lehrerberufes von Seiten der Gesellschaft zurück (vgl. Eggert-Schmid Noerr 2002, S. 128). Die Autorin erwähnt u.a. diesbezüglich ein „gewisses Aroma des gesellschaftlich nicht ganz Vollgenommenen“ (Adorno 1965, 656ff zit. n. Eggert-Schmid Noerr 2002, S. 128) trotz der akademischen Ausbildung.
Obwohl Adornos Aussagen damals die Lehrerschaft betrafen, verleiten die Veränderungen des letzten Jahrzehnts im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung, die Akademisierung der pädagogischen Fachkräfte sowie die wachsenden Anforderungen und Erwartungen an sie, analoge Gedanken zu hegen. Diese Betrachtungen sollen jedoch nicht den Kern meiner Arbeit darstellen, sondern den persönlichen Hintergrund für die Entscheidung beleuchten, mich mit dem Humor, seinen Ursachen und Auswirkungen auf Menschen und insbesondere auf Kinder zu beschäftigen.
In dieser Arbeit werde ich mich mit dem Thema Humor im Zusammenhang mit den allgemeinen kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungen in der frühen Kindheit auseinandersetzen. Das Ziel ist dabei herauszufinden, ob der Humor eine förderliche Wirkung auf die individuelle Entwicklung in der Altersspanne aufweist. Zunächst werde ich Standardwerke aus der Humorforschung sowie einzelne Beiträge aus der Psychologie bearbeiten, um einen Überblick über die Definitionen und die Entwicklung von Humor zu verschaffen. Anschließend werde ich mich entwicklungspsychologischer Literatur widmen, um darzustellen, welche Stufen Kinder sowohl in ihrer kognitiven als auch in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung durchlaufen.
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Der Humor
Etymologisch betrachtet kommt das Wort Humor aus der lateinischen Sprache, in welcher es Flüssigkeit bedeutet (vgl. McGhee 1979, S. 4). In der altertümlichen und mittelalterlichen Medizin bis zur Renaissance wurde damit jede der vier physiologischen Körperflüssigkeiten bezeichnet: Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Man ging davon aus, dass ihr Gleichgewicht oder Ungleichgewicht das Temperament oder die Laune einer Person beeinflusst (vgl. McGhee 1979, S. 5). Wenn die gelbe Galle im Überfluss war, neigte der Mensch zum Jähzorn. Wenn wiederum die schwarze Galle überwog, führte dies eher zu einer niedergeschlagenen Stimmung. Während zu viel Blut einen fröhlichen und zuversichtlichen Gemütszustand hervorrief, verursachte ein Überfluss von Schleim Trägheit und Apathie (vgl. ebd., S.5). Wenn jedoch diese vier Flüssig-keiten ausgeglichen vorhanden waren, war eine Person in „good humor“ (vgl. ebd., S.5)
Diese ursprüngliche Bedeutung von Humor als physikalisches und physiologisches Phänomen weist lustigerweise auf die seit Jahrhunderten andauernde Schwierigkeit vieler Wissenschaftsgattungen hin, diesem Begriff klare Konturen zu geben, also ihn zu definieren. Von dem Philosophen Aristoteles, über Sigmund Freud bis hin zur heutigen Humorforschung wurden verschiedene Erklärungsansätze zur Entstehung, Entwicklung und zum Sinn des Humors aufgestellt. Aber wie Paul McGhee, welcher als Begründer der modernen Humorforschung gilt, schrieb: „it is preposterous [...] to try to explain cognitive, social, motivational, and physiological aspects of humour within a single explanatory system“ (McGhee 1979, S.42).
Im folgenden Abschnitt werden mehrere Humortheorien vorgestellt, da sie trotz ihrer Vielzahl alle ein Stück weit zutreffende Aspekte zur Erklärung dieses Phänomens beinhalten. Im Anschluss wird die Entwicklung des frühkindlichen Humors genauer betrachtet, wobei wir auf die Phänomene des Lächelns und Lachens, sowie auf das Stufenmodell nach Paul McGhee eingehen werden.
2.1.1 Theorien zur Erklärung des Humors
Die folgenden sechs Theorien zur Erklärung des Humors stammen aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft überwiegend aus dem 20. Jahrhundert, wobei Philosophen sich schon im griechischen Altertum mit dem Thema auseinandersetzten.
Geisteswissenschaftliche und philosophische Theorien
Für die griechischen Philosophen Platon und Aristoteles war der Humor mit der Schadenfreude verwandt und sie verstanden ihn deshalb als „Inbegriff des Bösen im Menschen“ (Böhnsch-Kauke 2003, S. 17). Andere Philosophen wiederum sahen im Lachen und Humor „eine Waffe gegen das Böse“ und ein „wertvolles Mittel, um die Narreteien der Gesellschaft zu korrigieren“ (vgl. ebd., S. 18). Bei Thomas Hobbes findet man eine naheliegende Auffassung des Humors, die derjenigen von Platon und Aristoteles ähnelt. Für ihn äußert sich das Lachen als Reaktion auf die festgestellte Unvollkommenheit Anderer im Vergleich zu den überwundenen Fehlern und Schwächen des Lachenden (vgl. ebd., S. 18). Ähnlich wie Hobbes sieht Theodor Lipps im Humor und Lachen einen Ausdruck der Überlegenheit, da wir oft über die Unterlegenheit, die Torheit oder das Unglück anderer lachen (vgl. ebd., S. 18). Für den französischen Soziologen Henri Bergson stellt das Lachen „eine Reaktion auf das Schauspiel der Unangepasstheit an das Leben“ (ebd., S. 18) dar. Nach seiner Auffassung ist das Komische, welches das Lachen und Gefühle von Humor hervorruft, eine typisch menschliche Eigenschaft (vgl. Bergson 1900, S. 10). Natürliche Umstände, wie Landschaften, können zwar ästhetisch bewertet werden, aber sie können nicht zum Lachen reizen, es sei denn, wir sehen in ihnen Merkmale eines menschlichen Einflusses. Bei Tieren nehmen wir lustige Ereignisse wahr, weil sie in diesen Handlungen Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Verhalten aufweisen (vgl. ebd., S. 10). Weiterhin wird über Ungeschick gelacht, denn Bergson sieht darin eine Fehlreaktion auf die sich ständig verändernden Umstände. Obwohl eine bestimmte Situation eine Verhaltensänderung erfordern würde, verharrt der Mensch wegen einer fehlenden körperlichen oder geistigen Anpassungsfähigkeit oder Zerstreutheit (vgl. ebd, S. 12) in seiner Handlungsweise. Das unangepasste bzw. scheinbar mechanische Verhalten löst dann das Lachen bei den Beobachtenden aus. Alle diese Erklärungsansätze für den Humor sind der Überlegenheits- bzw. Respektlosigkeits-Theorie unterzuordnen.
Psycho-physiologische Theorien
Unter diesem Begriff werden die Arousal- und Reversaltheorien verstanden, welche sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Humor und der neuralen Aktivierung befassen. Die Nerven werden beispielsweise durch das Erzählen eines Witzes stimuliert und dadurch wird Spannung aufgebaut. Dieses wird nach der Theorie des Psychologen Berlyne als neuraler Anstieg oder „arousal boost“ betrachtet und entspricht einer künstlich erzeugten Gefahrensituation (vgl. Janata 1998, S. 18). Wenn die Stimulation ein bestimmtes Niveau erreicht und die Person den Reiz als ungefährlich einschätzt, dann lacht sie, um diese Spannung zu verringern („arousal jag“), was angenehme Gefühle hervorruft.
Apter beschäftigte sich weiterhin mit der neuralen Stimulation und fügte die Begriffe von telischen und paratelischen Zuständen für die Begründung seiner Reversaltheorie hinzu. Der erste Zustand kennzeichnet Ernsthaftigkeit sowie zielorientiertes Denken und Handeln, während der paratelische Zustand für den Humor förderlich ist. In einem telischen Zustand empfindet man eine starke neurale Stimulation als unangenehm und eine niedrige als entspannend. Im Gegenteil wirkt sich eine hohe Stimulation im paratelischen Zustand herausfordernd aus und eine niedrige löst Langeweile aus (vgl. Böhnsch-Kauke 2003, S. 24). Abhängig von dem Erregungsniveau kann die Stimmung schwanken, wie der Name der Theorie es beschreibt („reversal“ = Umschwung).
Evolutionsbiologische Theorien
Gemäß diesen Theorien sind Lächeln und Lachen Endprodukte der menschlichen Entwicklung. An deren Ursprung steht das Zähnefletschen, welches eine Verteidigungs-maßnahme bei einem Angriff darstellt. Daraus entwickelte sich zuerst das Lächeln, dann das Lachen als Signale für eine entspannte Situation (vgl. Böhnsch-Kauke 2003, S. 27). Demzufolge stehen Lachen und Humor als „ein Ersatz für eine tatsächliche Attacke“ (ebd., S.27). Aus diesem Grund wird der Humor als naturgegebenes Phänomen betrachtet, dessen Ausdruck im Lachen als physiologisch angelegter Mechanismus eine wohltuende Funktion für den Körper erfüllt und gleichzeitig einem vermeintlichen Feind Entwarnung signalisiert. Daraus kann gefolgert werden, dass jeder Mensch ein angeborenes Potenzial zum humorvollen Agieren besitzt, wobei Anlage und Erfahrungen dessen individuelle Entwicklung unterschiedlich beeinflussen (vgl. Drews 2009, S. 41).
Soziologische und sozialpsychologische Theorien
Diese Ansätze betonen die sozial verbindende Funktion des Lachens und des Humors. Freud machte diese Funktion schon deutlich als er schrieb:
„Der humoristische Vorgang kann sich in zweierlei Weisen vollziehen entweder an einer einzigen Person, die selbst die humoristische Einstellung einnimmt, während der zweiten Person die Rolle des Zuschauers und Nutznießers zufällt, oder zwischen zwei Personen, von denen die eine am humoristischen Vorgang gar keinen Anteil hat, die zweite aber diese Person zum Objekt ihrer humoristischen Betrachtung macht.“ (Freud 1948, S.383).
Nach dieser Auffassung setzt der Humor eine dreigliedrige Menschenkonstellation voraus. Diese besteht aus einer erzählenden, einer zuhörenden Person sowie aus der „Zielscheibe“ (Böhnsch-Kauke 2003, S. 28) des humoristischen Prozesses. Diese Zielscheibe kann sowohl die erzählende Person selbst sein als auch reale oder fiktive Individuen sein. Damit eine humorvolle Situation entsteht, müssen jedoch Erzähler /-in und Zuhörer /-in den gleichen oder zumindest einen naheliegenden Standpunkt zum Thema des Witzes teilen (vgl. ebd, S. 28). Ein sexistischer Witz beispielsweise kann der erzählenden Person viel Freude bereiten, während die Zuhörende ihn als unangemessen und inakzeptabel wahrnehmen wird, denn beide nicht die selben Ansichten über das Thema teilen.
Psychoanalytische Theorien
In seinen zwei Schriften „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“ von 1905 und „Der Humor“ von 1927 legte Freud die Grundlage der Theorien der Spannungsabfuhr. Witz, Komik und Humor betrachtet er als Lusterfahrungen, welche „die Ersparnis oder Ökonomie der psychischen Energie“ gemeinsam haben (Böhnsch-Kauke 2003, S. 20).
Nach Freud dürfen bestimmte Triebe (wie aggressive oder sexuelle Impulse) gesellschaftlich nicht zum Ausdruck kommen, was die Menschen zu deren Verdrängung bringt. In dem Witz sah er deshalb eine sozial akzeptierte Form, diese Bedürfnisse zu befriedigen und zugleich mit dem inneren Konflikt zwischen Norm und Bedürfnis fertig zu werden (vgl. ebd., S20). Die Energie, welche für das Zähmen des Impulses notwendig gewesen wäre, ist überschüssig und entlädt sich im Lachen.
Bei der Komik handelt es sich um nonverbale Ausdrucksformen wie Slapstick, Komödie und Clownerie. Indem der Beobachter bestimmte Ereignisse erwartet, verwendet er mentale Energie, welche in Lachen abgeführt wird, wenn das Erwartete nicht geschieht.
Den Humor setzt Freud in Verbindung mit unangenehmen Emotionen, wie Furcht, Traurigkeit oder Ärger. Indem man lustige oder inkongruente Aspekte in einer solchen Gefühlssituation wahrnimmt, sieht man die Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel (vgl. Böhnsch-Kauke 2003, S. 21). Die Energie, welche aus diesen unangenehmen Gefühlen entstanden wäre, wird dann in Vergnügen umgewandelt. Freud sieht in dieser Eigenschaft des Humors einen Abwehr- bzw. Bewältigungsmechanismus, der es ermöglicht den Umständen entgegen zu kommen, ohne von ihnen bezwungen zu werden.
„ Der Humor hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes […]. Das Großartige liegt offenbar im Triumph des Narzißmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das Ich verweigert es, sich durch die Veranlassungen aus der Realität kränken, zum Leiden nötigen zu lassen, es beharrt dabei, daß ihm die Traumen der Außenwelt nicht nahe gehen können, ja es zeigt, daß sie ihm nur Anlässe zu Lustgewinn sind.“ (Freud 1948, S.385).
Freud lokalisiert den Ursprung des Humors im Über-Ich, welches nach seinem Strukturmodell der Persönlichkeit das „genetische Erbe der Elterninstanz“ darstellt (Freud 1948, S.387). Während das ES das Unbewusste vertritt und damit „das triebhafte Element der Psyche“ bildet, steht das ÜBER-ICH für „die aus der erzieherischen Umwelt verinnerlichten Handlungsnormen, Rollen, Weltbilder etc.“ (Drews 2009, S. 37). Die Vermittlung zwischen diesen beiden psychischen Instanzen erfolgt über das ICH, welches mithilfe der durch Denken sowie Vernunft gefestigten Werte und Normen beabsichtigt, soziale und psychische Konflikte zu lösen. Humor wird dann ausgelöst, wenn eine Person einer Situation trotzt und wenn das ÜBER-ICH dem gefährdeten ICH dabei hilft, die Kontrolle zurückzubekommen und zugleich Freude zu empfinden. Dies stellt das Prinzip der Leidersparnis dar (vgl. ebd., S.37).
Kognitionstheorien
Diese Theorien beschäftigen sich hauptsächlich mit den kognitiven Aspekten von Humor und betonen dabei dass „die Wahrnehmung von Inkongruenzen eine zentrale Voraussetzung für Humoraktionen und das Erleben von Humor ist“ (Drews 2009, S.39).
Unter Inkongruenz wird eine Erwartungsverletzung verstanden. Es besteht ein Konflikt zwischen dem, was eine Person erwartet und dem, was sie tatsächlich erlebt. Nach der Inkongruenztheorie bringt also der Humor „zwei separate Ideen, Begriffe oder Situationen in einer überraschenden oder unerwarteten Weise zusammen“ (Böhnsch-Kauke 2003, S. 25).
Bei dem Verarbeitungsprozess inkongruenter Wahrnehmungen scheinen beide Hirn-Hemisphäre unterschiedliche Rollen zu spielen. Nach Janata: „ Die gesunde rechte Hemisphäre ist fähig, alle ungewöhnlichen, inkongruenten Situationen zu entdecken, egal, ob diese einen Bezug zum Humor haben oder nicht“ (Janata 1998, S. 88, Herv. i. Orig.). Die Wahrnehmung einer Inkongruenz durch diese Hirnhälfte, Grundlage für die Humorentstehung, ruft negative Emotionen wie Angst, Fremdheit oder Erschrecken hervor. Dies führt zu einer Steigerung der neuralen Stimulation („arousal boost “). In der linken Hirnhälfte werden die Eigenschaften der Situation analysiert. Dieser kognitive Prozess enthüllt dann die Pointe bzw. das Lustige an den Umständen. Durch diese Analyse werden vermutlich die zuerst unangenehmen Gefühle in positiven, heiteren Emotionen von Humor gewandelt (vgl. Drews 2009, S.39).
Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung des frühkindlichen Humors unter anderem mit Hilfe des Stufenmodells von Paul McGhee dargelegt, welcher als Pionier der modernen Humorforschung und Vertreter der Inkongruenztheorie von Humor gilt.
2.1.2 Der frühkindliche Humor und seine Entwicklung
„Are human infants born with the ability to experience humor, or does it develop at some point later in infancy or childhood?“ (McGhee 1979, S.46)
Wie im Abschnitt 2.1. schon erwähnt, wird der Humor seit Jahrhunderten erforscht. Nichtsdestotrotz ist die Untersuchung dessen Entwicklung bei Kindern bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts unberücksichtigt geblieben. Freud behauptete sogar, dass Kinder keinen Humor besitzen, weil sie ihn nicht brauchen, um sich glücklich zu fühlen (vgl. Böhnsch-Kauke 2003, S. 23). Dennoch haben spätere Studien (wie u.a. diejenigen von Paul McGhee) nachgewiesen, dass Kinder schon zwischen dem ersten und dem zweiten Lebensjahr Humor entwickeln (vgl. ebd., S.49). Diese Annahme beruht auf der Erfor-schung der zwei kommunikativen Phänomenen Lächeln und Lachen, welche schon in der Säuglingszeit entstehen, wobei sie lediglich als Indikatoren und nicht als Beweis für die Humorentwicklung verstanden werden (vgl. Wicki 2000, S. 176). Aus diesem Grund wird im folgenden Absatz zunächst auf die Entwicklung des Lächelns und Lachens in den ersten Lebensmonaten eingegangen, bevor die stufenartige Entwicklung des Humors vorgestellt wird.
In der ersten Woche nach der Geburt kann bei Säuglingen ein erstes Lächeln während des Schlafs beobachtet werden, wobei dies nur ein Zeichen der Aktivität des Zentralen Nervensystems ist (vgl. McGhee 1979, S. 48). Im wachen Zustand tritt das Lächeln um die erste Lebenswoche auch bei einem Sättigungsgefühl auf. Gegen Ende des ersten Lebensmonats reagiert der Säugling mit aufgewecktem Lächeln auf körperliche Reize (z.B. Streicheln), meist in Kombination mit der Stimme der Mutter oder einer Bezugsperson. Im zweiten Lebensmonat wecken visuelle und akustische Reize in Zusammenhang mit Bewegung das Interesse des Kindes und können ebenso ein Lächeln hervorrufen (vgl. ebd. S. 49).
In den folgenden Monaten (ca. zwischen dem dritten und dem vierten Monat) scheint die Form eines unbewegten menschlichen Gesichts die zuverlässigste Quelle für das Lächeln darzustellen. Piaget nennt dieses Phänomen das „Erkennungslächeln“. Er erklärt dies damit, dass der Säugling sich an genügend Merkmale eines Gesichts erinnern kann, um dieses als vertraut zu erkennen (vgl. ebd., S. 49).
Besonders interessant scheint das Auftreten des Lächelns bis zum sechsten Monat. Einerseits erkennt der Säugling allmählich genauer das Gesicht seiner Bezugspersonen und lächelt sie eher an als eine fremde Person, was als Zeichen einer beginnenden Bindung gesehen werden kann. Andererseits rufen Gegenstände, welche mit einem gewissen Aufwand erkannt werden, eher das Lächeln hervor, als welche, die sofort eingeordnet werden oder völlig unbekannt sind (vgl. ebd. S. 50). Das Kind muss sich erst an den Gegenstand gewöhnen und eine kognitive Verarbeitung leisten, indem es diesen mit früheren Erfahrungen vergleicht, um Interesse und Freude daran zu haben. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass bei Säuglingen Neugier und Lächeln durch ein bestimmtes Niveau von Diskrepanz und geistiger Anstrengung ausgelöst werden.
Säuglinge lachen in der Regel zum ersten Mal zwischen dem 3. und dem 4. Monat. Dies geschieht meistens, wenn sie mit einer Bezugsperson interagieren. Die Ursachen sind ähnlich wie bei dem Lächeln, nämlich akustische Reize in Verbindung mit körperlichen Stimuli (vgl. McGhee 1979, S. 52). Dabei ist anzumerken, dass Säuglinge im Laufe des ersten Lebensjahres immer häufiger lachen, da diese Stimuli mit zunehmendem Alter zahlreicher und komplexer werden (vgl. Falkenberg 2010, S.25). Beispielsweise reagieren Kinder zwischen sieben und acht Monaten mit einem Lachen eher auf taktile Reize, während Einjährige dies auch bei visuellen oder sozialen Reizen (z.B. Grimasse schneiden oder die Zunge herausstrecken) häufiger tun.
Obwohl es in seinen früheren Veröffentlichungen nicht der Fall war, bildet heute für Paul McGhee das Lachen als Reaktion auf solche inkongruenten Situationen die erste Stufe der Humorentwicklung bei Kindern im Alter zwischen sechs und 12-15 Monaten (vgl. McGhee 2010a, o.S.). Kinder lachen über Verhaltensweisen ihrer Bezugspersonen, welche ihnen ungewöhnlich vorkommen, können aber selber noch nicht humorvoll agieren. Die Begründung dafür liegt seiner Ansicht nach darin, dass „[...] imagination, make-believe, and fantasy […] are emphasized as playing a central role in children's humor” (McGhee 1979, S. 47). Kinder müssen also die notwendigen kognitiven Fähigkeiten entwickeln, um sich fantasievoll mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen, bevor sie die Inkongruenz des Humors verstehen und selber produzieren können (vgl. ebda. S. 53).
Ein Zeichen dieser kognitiven Entwicklung stellt das Auftreten des Symbolspiels bzw. Als-ob-Spiel bei Kindern zwischen zwölf und dreizehn Monaten dar. Kennzeichnend für diese Tätigkeit ist, dass der Spielgegenstand umgedeutet (z.B. eine Banane wird als Telefon benutzt) bzw. durch einen Fiktiven, Gedachten ersetzt wird, wenn das Kind beispielsweise vorgibt, aus einer leeren Tasse zu trinken (vgl. Oerter et al. 2008, S. 240). Diese neuerworbene Fähigkeit ermöglicht den Kindern selbst erste humorvolle Situationen zu erzeugen. Dies bedeutet für McGhee die zweite Stufe der Humor-entwicklung, in der Kinder inkongruente Handlungen gegenüber Objekten vollziehen. (vgl. McGhee 1979, S. 66).
Die dritte Stufe setzt ca. zwischen dem 24. und dem 27. Lebensmonat an und geht mit der Entwicklung der Sprache des Kindes einher. Indem Kinder in diesem Alter über sprachliche und begriffliche Kompetenzen verfügen, können sie nun mit Hilfe von Wörtern Humor hervorbringen. Kinder haben Freude daran, Bezeichnungen von Gegenständen oder Namen von Personen zu vertauschen (vgl. ebd., S. 68). Beispielsweise sagen sie, dass eine Katze ein Hund ist oder Paul Anna heißt. Ein wichtiges Merkmal dieser Phase ist, dass Kinder nicht nur mit Objekten sondern auch mit Wörtern agieren und wegen verbaler Äußerungen lachen. Diese Tatsache weist auf die Entwicklung der Fähigkeit zur Abstraktion hin (vgl. ebd., S. 69).
Die vierte Stufe ist zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr einzuordnen und scheint die Phase der Entstehung des Sinns für Humor bei Kindern zu sein (vgl. Mc Ghee 2010b, o.S.). In dieser Phase treten multiple Formen von Humor auf. Die Kinder finden Gefallen an Wortklängen und sie beginnen damit zu spielen, indem sie beispielsweise ein Wort mehrmals wiederholen und bei jeder Wiederholung die Anfangsbuchstaben ändern. Dadurch ergeben sich Wörterketten wie “daddy, faddy, paddy,” oder “silly, dilly, willy, squilly.” (vgl. McGhee 2010b, o.S.). Eine andere Art der humorvollen Interaktionen liegt in der Kombination von wirklichen und unwirklichen Wörtern, wie beispielsweise „I want more treemilk.“ (vgl. ebd., o.S.). Die letzte charakteristische Humorinteraktion nach McGhee betrifft das Spiel mit Konzepten. Kinder wissen nun, dass ein Begriff verschiedene Erscheinungsbilder und Eigenschaften besitzen kann und empfinden Freude daran, die Konventionen zu verletzen. Witzig finden sie beispielsweise, Eigenschaften dort hinzuzufügen, wo sie nicht hingehören (wie ein menschlicher Körper mit einem Hundekopf), Eigenschaften von familiären Dingen zu verändern (wie eine Person mit einem quadratischen Kopf) oder unmögliches Verhalten darzustellen (wie eine Kuh auf Schlittschuhen) (vgl. ebd., o.S.).
Bevor in dem nächsten Teil dieser Arbeit die Abläufe der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungen in der frühen Kindheit dargelegt werden, wird dieser Abschnitt mit einem zusammenfassenden Zitat über die Definition von Humor beendet. Marion Böhnsch-Kauke fasst also den Humor auf als:
„eine Kategorie des zwischenmenschlichen Verhaltens und Erlebens, wodurch Widerwärtigkeiten, Unergründliches und Unzulänglichkeiten im Zusammenleben spielerisch kreiert, erheiternd verstanden und witzig(er)weise aufgelöst werden. Humor ist damit eine Form der soziopsychischen Kompetenz.“ (Böhnsch-Kauke 2003, S. 81).
2.2 Die frühkindliche kognitive, emotionale und soziale Entwicklung
Zeitgenössische psychologische Auffassungen von Entwicklung tendieren dazu, diesen Prozess als eine durch das Alter beeinflusste Veränderung zu betrachten. (vgl. Bischof-Köhler 2011, S. 21). Dennoch entspricht nicht jede Veränderung gleich einer Entwicklung und das Alter stellt in sich auch kein Entwicklungskriterium dar, sondern eher der Zeitraum, in dem bestimmte Modifikationen stattfinden. Bischof-Köhler präzisiert den Begriff der Entwicklung und definiert ihn als eine „Ausbildung von Strukturen “, sowie als „ein gerichteter Prozess hin zur Ausbildung und Veränderung von Strukturen, die eine optimale Anpassung an Umweltgegebenheiten gewährleisten“ (Bischof-Köhler 2011, S. 22ff, Herv. i. Orig.).
2.2.1 Kognitive Aspekte
Zur Erklärung von der Entstehung der Intelligenz bzw. der kognitiven Entwicklung des Menschen existieren mehrere Theorien. Eine der berühmtesten und einflussreichsten Theorien ist die des schweizerischen Psychologen Jean Piaget (1896-1980).
Das Kind ist für Piaget ein Wissenschaftler bzw. ein forschendes Wesen, welches sein Wissen in der Auseinandersetzung mit der Umwelt erwirbt. Diese Erfahrungen werden von einer dem Kind innewohnenden Motivation angetrieben, welche als intrinsisch bezeichnet wird (vgl. Baacke 1999, S.181). Voraussetzung für die Stimulation dieser intrinsischen Motivation sind „ dosierte Diskrepanzen oder Inkongruenzen “ (Baacke 1999, S.181, Herv. i. Orig.). Ein Beispiel für eine solche Inkongruenz findet man in dem möglichen Gefälle zwischen den Erwartungen an eine bestimmte Situation und ihre unmittelbare Wahrnehmung. Wenn etwas Unerwartetes auftritt, wird es als fremd wahrgenommen und es löst Überraschung aus. Dieser überraschende Effekt weckt im besten Fall das Interesse des Kindes und motiviert es dazu, das daraus entstandene Problem zu verstehen und zu lösen (vgl. Baacke 1999, S.181). Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass, wie in einem früheren Abschnitt schon erwähnt, Inkongruenzen auch eine wesentliche Rolle in der Entwicklung des frühkindlichen Humors spielen.
Durch diese intrinsische Motivation geleitet, entwickelt das Kind im Umgang mit seiner Umgebung Denkschemata. Diese werden als „Muster von Gedanken oder Hand-lungen“ betrachtet, womit das Kind seine Umwelt deutet (Pinquart et al. 2011, S. 85). Das Greifen nach einem Gegenstand stellt ein Beispiel für ein solches gedankliches Muster dar. Diese Denkschemata werden mit Hilfe von den kognitiven Vorgängen der Organisation und der Adaptation erweitert . Im Prozess der Organisation werden mehrere dieser Denkmuster zu „ kognitiven Strukturen “ kombiniert (Pinquart et al. 2011, S. 85, Herv. FF). Daraus ergeben sich komplexere Handlungen wie beispielsweise das Greifen nach und das Trinken aus einer Tasse. Adaptation bezeichnet laut Piaget das Bedürfnis von Kindern, „sich so an ihre Umwelt anzupassen, dass sie mit ihr in einem kognitiven Gleichgewicht, einem Äquilibrium, stehen“ (ebd., S. 85, Herv. i. Orig.). Dieser Zustand des Gleichgewichts wird durch Assimilation und Akkomodation erlangt. Assimilation definiert den kindlichen Versuch, die Umwelt anhand ihrer vorhandenen mentalen Strukturen (Denkschemata) zu verstehen. Bei der Akkomodation hingegen verändern Kinder ihre Denkmuster in Reaktion auf die Umweltreize (vgl. ebd., S. 85ff).
In seiner Theorie der kognitiven Entwicklung beschreibt Piaget, wie Kinder in jeder der vier aufeinander aufbauenden Phasen (sensumotorische, präoperationale, konkret-operationale, formal-operationale Phase) ihre Denkschemata organisieren und anpassen. Da lediglich die sensumotorische und die präoperationale Phasen für die frühkindliche Entwicklung relevant sind, wird auf die Beschreibung der zwei später auftretenden Phasen verzichtet (Siehe dazu: Pinquart et al. 2011, Oerter et al. 2008).
Piaget ordnet die sensumotorische Phase zwischen der Geburt und dem zweiten Lebensjahr ein. In dieser Zeitspanne erfahren die Säuglinge ihre Umwelt durch eine Kombination von Sinneswahrnehmungen und motorischen Handlungen, welche die Basis für den Aufbau des Denkens bilden (vgl. Oerter et al. 2008, S. 438). Der Säugling nimmt nach und nach die Gegenstände als außerhalb seiner selbst wahr und bildet geistige Vorstellungen von ihnen aus. In dieser Phase können die Anfänge des Spiels und der Nachahmung beobachtet werden (vgl. Baacke 1999, S. 182). Da diese Phase für die Entstehung des Denkens besonders prägend ist, widmete sich Piaget ausführlich ihrer Erforschung und unterteilte sie in sechs weiteren Unterstufen (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 86).
Im ersten Lebensmonat zeichnet sich das Verhalten des Säuglings durch den Einsatz von angeborenen Reflexen aus, wie beispielsweise der Saug- oder Greifreflex, aus. Piaget sieht in diesen instinktiven Handlungen „Glieder einer […] organischen Evolution“ (Piaget 1975, S. 35). Für ihn sind Reflexe keine isolierten Automatismen. Indem sie sich gegenseitig bedingen und auf einander aufbauen, folgen sie einem bestimmten Verlauf, dessen Ursprung in der Psyche liegt (vgl. ebd., S. 35). Die Betätigung und Übung dieser angeborenen Fähigkeiten ermöglichen dem Säugling die Ausbildung von ersten Denkmustern (Denkschemata), wobei diese Reflexe durch Akkomodation an die Umwelt angepasst, also entwickelt und koordiniert werden (vgl. ebd., S. 40). Mit der Akkomodation geht die Assimilation einher. Diese äußert sich in der Betätigung des Reflexes und zeichnet sich durch „ein wachsendes Bedürfnis an Wiederholung“ aus (vgl. ebd., S. 42). Piaget sieht in der Assimilation zugleich einen organischen und geistigen Prozess, bei dem „die Bedürfnisse die Rolle eines Verbindungsgliedes zwischen dem Organismus und dem Bereich des Psychischen“ spielen (vgl. ebd., S. 55).
Zwischen dem ersten und vierten Lebensmonat treten primäre Kreisreaktionen auf (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 88). Dieser Begriff bezeichnet die Wiederholung von Handlungen, welche aufgrund ihres Effekts das Interesse des Kindes wecken (vgl. ebd., S. 88). In diesem zweiten Stadium beziehen sich diese Aktivitäten ausschließlich auf den eigenen Körper. Charakteristisch ist auch die Kombination von einfachen Handlungen, wie das Schauen oder das Kopfdrehen, zu umfassenderen Verhaltens-einheiten (vgl. Oerter et al. 2008, S. 438).
Sekundäre Kreisreaktionen charakterisieren das dritte Stadium, welches zwischen dem vierten und dem achten Lebensmonat eingeordnet wird (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 88). Sekundär sind sie in dem Sinne, dass die Tätigkeiten, welche dem Säugling interessant erscheinen, nun die Umwelt einbeziehen. Der kausale Zusammenhang zwischen der vollzogenen Handlung und dem auftretenden Effekt bleibt aber für das Kind noch unklar (vgl. ebd., S. 88). Ein weiteres Merkmal ist die Tatsche, dass Kinder in diesem Alter aufhören nach einem Objekt zu suchen, sobald dieses vollständig verdeckt ist. Darin sah Piaget einen Nachweis für das Fehlen der Objektpermanenz (vgl. Oerter et al. 2008, S.438).
Im vierten Stadium (8 bis 12 Monate) bildet sich bei Kindern dieses Konzepts der Objektpermanenz aus. Sie wissen nun, dass ein schon bekannter Gegenstand immer noch existiert, auch wenn sie ihn augenblicklich nicht sehen können (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 86). Dennoch zeigen sie sogenannte Perseverationsfehler auf. Wenn ein Gegenstand mehrmals an einem Ort versteckt und anschließend vor dem Blick eines Kindes an einer anderen Stelle verdeckt wird, dann sucht ihn das Kind an der ersten Stelle (vgl. Oerter 2008, S.438). Die Suche nach verdeckten Objekten beweist den Aufbau von „Mittel-Ziel-Verbindungen“ (Oerter et al. 2008, S.438). Kinder wenden nun gezielte Handlungen an, um ein bestimmtes Effekt zu produzieren. Ein Beispiel dafür ist das Ziehen an einem Tuch, um nach einem darunter versteckten Gegenstand zu greifen. In diesem Phänomen kann man die „Koordination sekundärer Kreisreaktionen“ beobachten (Pinquart et al. 2011, S. 88).
Tertiäre Kreisreaktionen treten zwischen dem 12. und dem 18. Lebensmonat auf. Sie kennzeichnen sich durch die Anwendung von verschiedenen und neuen Handlungen zur Erzeugung eines Effektes, wie beispielsweise der Einsatz von Gegenständen als Werkzeug (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 88). Ein zusätzlicher Entwicklungsschritt ist auch, dass Kinder versteckte Objekte wiederfinden können, wenn sie dessen Verlagerung gesehen haben (vgl. Oerter et al. 2008, S.439).
Das letzte Unterstadium der sensumotorischen Phase zwischen dem 18. und dem 24. Monat zeichnet sich durch das mentale Schlussfolgern aus und bildet den „Übergang zum symbolisch-repräsentationalen Denken“ (Oerter et al. 2008, S.439). Kinder werden schrittweise mit dem Symbolgebrauch vertraut. Als Beweis hierfür kann das Auftreten des Symbol- bzw. Fiktionsspiels und die rasche Erweiterung des Wortschatzes gelten (vgl. ebd., S.439). Diese Fähigkeit, mit Symbolen umzugehen, ermöglicht es den Kindern verzögerte Imitationsverhalten zu nutzen sowie kausale Zusammenhänge bzw. „Wenn-dann-Beziehungen“ aufzubauen (Pinquart et al. 2011, S. 88).
Die zweite Hauptphase in Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung wird als präoperational genannt und betrifft die Altersspanne der Kindheit zwischen zwei und sieben Jahren. Dieter Baacke bezeichnet diesen Entwicklungszeitraum sowohl als Stufe des „ symbolischen “ als auch des „anschaulichen Denkens “ (Baacke 1999, S.182; Herv. i. Orig.). Wichtige Merkmale dieser Phase sind „ Irreversibilität “, „ Egozentrismus “ und „ Animismus “ (ebd. S.182, Herv. i. Orig.). Kinder bilden stabile geistige Vorstellungen von Gegenständen und Vorkommnissen aus ihrer Umwelt aus, die die Form von Symbolen annehmen können (Pinquart et al. 2011, S. 88). Sie nehmen schon logische Zusammenhänge („Wenn-dann-beziehungen“) wahr, können aber trotz dieser Fähigkeit solche Prozesse mental noch nicht rückgängig machen (vgl. ebd. S.89). Der kindliche Egozentrismus zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder unfähig sind, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen, sodass ihr Denken sich ausschließlich auf ihren Standpunkt bezieht. Eine Folge des egozentrischen Denkens spiegelt sich bei Kindern in die Tendenz zum Animismus. Kinder neigen dazu, unbelebte Gegenstände und Naturphänomene für lebendig zu halten, weil sie ihnen ihre eigene Denkweise verleihen (vgl. Oerter et al. 2008, S.442). Ab dem vierten Lebensjahr setzt die Stufe des anschaulichen Denkens ein. Dabei denken Kinder stets anhand geistiger Bilder. Sie bilden auch Begriffe, deren Entwicklung noch von der Wahrnehmung hervorstechender Aspekte abhängig ist (vgl. Textor 2005, o.S.).
Auch wenn mehrere Kritikpunkte an Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung bestehen (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 92ff; vgl. Oerter et al. 2008, S. 443ff), behält sie dennoch als Richtwert sowohl in der Wissenschaft als auch in der Pädagogik einen maßgeblichen Einfluss.
Jaromir Janata behauptet in seinem Buch „Zur Anatomie des Humors“, dass die Kognition nicht getrennt von den Emotionen betrachtet werden kann (vgl. Janata 1998, S. 129). Er bezeichnet sogar Emotionen als „soziale Kognitionen“ (ebd., S. 130). Aufgrund der Relevanz dieser Aussage in Bezug auf den Humor als Emotion und auf wichtige individuelle Entwicklungsbereiche des Menschen werden die frühkindlichen sozialen und emotionalen Entwicklungen im folgenden Abschnitt erläutert.
2.2.2 Soziale und emotionale Aspekte
Warum werden diese beiden Gesichtspunkte in einem gemeinsamen Abschnitt behandelt? Dieter Baacke liefert uns dazu eine geeignete Begründung:
„Die Fähigkeit, Emotionen zu haben, ist also ebenso angeboren wie die Fähigkeit, die Motorik, das Bewegungs-, Beobachtungs- und Denkvermögen zu entwickeln, aber es sind die sozialen Situationen, die die emotionale Kompetenz in allen Richtungen ausarbeiten.“ (Baacke 1999, S. 154).
Unter emotionaler Kompetenz können die Fähigkeiten, Emotionen zu empfinden und auszudrücken sowie mit ihnen umzugehen, verstanden werden. Wie es in diesem Zitat zum Ausdruck kommt, werden diese Kompetenzen von dem sozialen Kontext beeinflusst. Einerseits ist der Humor ein interaktives bzw. ein auf Kommunikation gerichtetes Phänomen (vgl. Böhnsch-Kauke 2003, S. 58) und beinhaltet somit eine soziale Komponente. Die Autorin benennt drei wichtige Funktionen des Humors in der frühen Kindheit. Die erste soll dem Überleben des Kindes dienen. Eine weitere besteht in der Verstärkung der Beziehungen von einem Kind zu seinen Eltern und zu gleichaltrigen Kindern (vgl. ebd., S.59). Die letzte soll „effektive Transaktionen mit der Umwelt im umfassenderen Sozialisationsprozesse“ ermöglichen (Böhnsch-Kauke 2003, S. 59). Andererseits wird der Humor auch als komplizierte, zusammengesetzte Emotion (vgl. Janata 1998, S. 140) definiert. Aus diesem Grund erscheint es im Bezug auf Humor wichtig, das Augenmerk zugleich auf den Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen zu richten, bevor auf die emotionale Ebene näher eingegangen wird.
soziale Entwicklung
Oerter zitiert die Ansicht von Bowlby, nach welchem Bindung und Fürsorge evolutionär entstanden sind und der Erhaltung der Gattung Mensch dienen (vgl. Oerter et al. 2008, S. 213). Auf Kinder und Erwachsene bezogen, behauptet außerdem Bauer, dass es der „Kern aller menschlichen Motivation ist […], zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben“ (Bauer 2006, S. 21). Aus diesen Annahmen können wir schlussfolgern, dass das menschliche Sozialverhalten angeboren ist und dass sogar eine lebenswichtige Notwendigkeit in ihm besteht.
Einen wichtigen Beitrag zur Erklärung zwischenmenschlicher Beziehungen leistete der britische Kinderarzt und Psychoanalytiker John Bowlby (1907-1990) mit seiner Bindungstheorie. Er beschrieb vier normative Phasen für den Aufbau selektiver Bindungen (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 199). In den ersten drei Lebensmonaten drücken Säuglinge ihre Bedürfnisse aus, ohne eine soziale Absicht zu erzielen. Ab ca. drei Monaten beginnen sie ihre Bedürfnissignale an ihrer sozialen Umwelt auszurichten. Der erste Bindungsansatz setzt zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem dritten Lebensjahr ein, wobei Kinder die Zuwendung von ausgewählten Personen bei Belastungen suchen. Der Einsatz von Humor durch erwachsene Personen während dieser Phase ist besonders wichtig. In für das Kind belastenden Situationen kann eine humoristische Einstellung von Seiten der Erwachsenen ihm dabei helfen, die schwierigen Umstände zu relativieren wobei die Gefühle des Kindes aber ernst genommen und nicht herablassend betrachtet werden müssen (vgl. Drews 2010, S. 230). Diese Verhaltensweise soll sich positiv auf die Bindung auswirken, denn das Kind erlebt, dass es geschützt ist und dass ihm eine angenehme und angemessene Lösung für seine Probleme angeboten wird (vgl. ebd., S. 231). Weiterhin ist die Entwicklung des Humors in dieser Zeitspanne mit sozialen Kontakten gekoppelt. Wie im Paragraph 2.1.2. schon erwähnt, reagieren Säuglinge und Kleinkinder mit Lächeln und Lachen zunächst auf körperliche, akustische und visuelle Stimuli, dann auf komische Verhaltensweisen ihrer Bezugspersonen. Dies zeigt, dass die Entwicklung des Humors von der sozialen Bindung bedingt wird, so wie sie wiederum durch humorvolles Agieren beeinflusst wird.
„Die Phase der zielkorrigierten Partnerschaft“ (ebd., S. 199) ab ca. vier Jahren verweist auf einen Wendepunkt in der Bindungsentwicklung. Kinder sind dann in der Lage den Standpunkt ihrer Bezugspersonen zu berücksichtigen. Demzufolge wenden sie sich weniger an die Erwachsenen und können ohne Gefühl der Ablehnung akzeptieren, dass diese eventuell augenblicklich auf die kindlichen Bedürfnisse nicht eingehen können (ebd., S. 200).
Im Bezug auf Bowlbys Bindungstheorie definierte Mary Ainsworth drei Muster der Bindungsqualität. Diese wurden durch Beobachtungen des Kindesverhaltens in Situationen herausgearbeitet, in denen das Kind intensiven negativen Gefühlen ausgesetzt wurde (die „Fremde Situation“; vgl. Oerter et al. 2008, S. 215; Pinquart et al. 2011, S. 200ff). Ainsworth unterschied zwischen dem sicheren, dem unsicher-vermeidend und dem ambivalent-unsicheren Bindungsstil (vgl. Oerter et al. 2008, S. 216). Sicher gebundene Kinder drücken ihre unangenehmen Gefühle aus, wenn sie allein gelassen werden. Dennoch werden sie entlastet und suchen den Kontakt mit ihrer Mutter, wenn diese wiederkommt. Unsicher-vermeidende Kinder zeigen wenig Gefühle und widmen sich ihrem Spielzeug weiter, anstatt Kontakt mit der Mutter aufzunehmen, wenn sie sich wieder im Raum befindet. Auf dieser Weise bewahren Kinder die für sie notwendige Distanz mit der Bezugsperson. Dieses Bindungsverhalten ist unter anderem auf ein Mangel an Einfühlsamkeit von Seiten der Mutter zurückzuführen (vgl. ebd., S.216). Bei ambivalent-unsicher gebundenen Kindern werden die negativen Gefühle zum Ausdruck gebracht. Die Ambivalenz liegt in ihrem Verhalten, wenn die Mutter wieder anwesend ist: Auf der einer Seite wollen sie Kontakt wiederaufnehmen, dennoch lehnen sie ihn ab. Ainsworth erklärt diese Reaktion als Folge eines wechselhaft, gegensätzlichen Verhaltens der Mutter dem Kind gegenüber, in dem sie sich mal „überschwänglich“ verhielt und mal „unerreichbar“ verhielt (ebd., S. 216).
Parallel zu diesen drei Hauptbindungsstilen kann außerdem eine Bindungsdesorganisation zu Tage treten. Kinder zeigen merkwürdige Verhaltensweisen, wie beispielsweise Grimassen oder ein abgewandtes Gesicht, wenn sie versuchen, sich ihrer Bezugsperson anzunähern (vgl. ebd., S.217). Laut Studien erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer desorganisierten Bindung in Fällen von Kindesmisshandlung (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 205).
Bindungsunterschiede werden sowohl von sozialen als auch von individuellen Kriterien beeinflusst. Zimmermann & Pinquart nennen zwei Interaktionsqualitäten, welche sich positiv auf den Bindungsaufbau auswirken. Zum einen ist es die Feinfühligkeit bzw. die „Sensitivität“ der Eltern (ebd. S. 206). Sie umfasst die Fähigkeit, die emotionalen Signale des Kindes wahrzunehmen und richtig zu deuten, so dass die kindlichen Bedürfnisse umgehend und angemessen befriedigt werden (vgl. ebd., S. 206). Zum anderen ruft das Verbalisieren von gedeuteten psychischen Prozessen beim Kind eine zusätzliche förderliche Wirkung hervor. Selbst wenn das Kind psychische oder genetische Eigenschaften aufweist, welche sich auf die Bindung hinderlich auswirken können (z.B. eine hohe Irritierbarkeit), scheint die elterliche Feinfühligkeit einen Ausgleich zu schaffen (vgl. ebd., S. 207ff).
Im Bezug auf die Humorentwicklung und auf seine förderliche Wirkung stellt die Eltern-Kind-Bindung einen zentralen Aspekt dar. Indem das Kind sich in dieser Beziehung mehr oder weniger sicher fühlt, wird sein Erkundungs- und Spielverhalten beeinflusst. Dies kann sich wiederum auf die Entfaltung seines eigenen humoristischen Handlungsweisen in der Form des Symbolspiels auswirken, denn diese Spielart ist die erste Strategie, mit der ein- und zweijährige Kinder aktiv humorvolle Interaktionen mit Erwachsenen gestalten (vgl. Drews 2010, S. 82).
Neben der Eltern- bzw. Bezugsperson-Kind-Bindung spielt fernerhin der Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen eine wesentliche Rolle für die frühkindliche soziale Entwicklung sowie für das Erleben von Humor. Schon im ersten Lebensjahr zeigen Kinder Interesse für das Verhalten und das Empfinden ihrer Gleichaltrigen, dennoch sind sie noch nicht fähig ihre Handlungen auf einander einzustellen, so wie sie es in der Interaktion mit ihren jeweiligen Bezugspersonen machen (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 212ff). Eine Veränderung im Kooperationsverhalten tritt zwischen dem zweiten und dem fünften Lebensjahr auf, wobei gemeinsame Aktivitäten immer häufiger und komplexer werden (vgl. ebd., S. 213). Diese Modifikation spiegelt sich sowohl im Spielverhalten als auch in den Spielarten wider, welche die Kinder in dieser Altersspanne ausüben. Zweijährige Kinder beschäftigen sich hauptsächlich mit sensomotorischen Aktivitäten, wobei sie eher allein und neben einander handeln. Kinder ab dem dritten Lebensjahr kooperieren wesentlich mehr und entwickeln ihre Fantasie im Rahmen von sozialen Rollenspielen (vgl. ebd. 213).
Mit der Kooperationsfähigkeit geht auch die Entwicklung des Humors zwischen Gleichaltrigen einher, dessen Höhepunkt bei vierjährigen Kindern zu beobachten ist (vgl. Drews 2010, S. 83). In diesem Alter wirken sich humorvolle Interaktionen sozial und motivational aus. Das gemeinsame Handeln in Form vom „Quatschmachen“ sowie das sich immer differenzierende Spiel mit der Sprache verbindet die Kinder und regt sie an, immer neue kreative, lustige Ideen zu entwickeln.
Zimmermann & Pinquart charakterisieren die Bindung, also das Fundament für die menschliche soziale Entwicklung, als „soziale Emotionsregulation“ (Pinquart et al. 2011, S. 199). In dieser knappen Definition wird der Zusammenhang zwischen dem Bedürfnis bzw. der Notwendigkeit nach sozialem Kontakt und der Emotionalität, spricht der evolutionär ältesten Art der Kognition (vgl. Janata 1998, S. 130), erkennbar.
emotionale Entwicklung
Zunächst erscheint es notwendig, den Begriff Emotion zu definieren, wobei dies aufgrund der diesbezüglich vielzähligen Ansichten eine schwierige Angelegenheit darstellt (vgl. Janata 1998, S. 129). Ursprünglich stammt dieses Wort aus dem Lateinischen und bezeichnet nach Übersetzung „Bewegungen und Beweglichkeit im physischen und psychischen Bereichen“ (ebd., S. 129). Nach dieser Definition könnten Emotionen als ein Motor des menschlichen Lebens angesehen werden. Nach Holodynski und Oerter sind Emotionen „kulturell überformte psychische Prozesse“, welche eine handlungsregulierende Funktion im Bezug auf ein Ziel ausüben (Oerter et al. 2008, S. 554). Sie treten hervor und werden empfunden, wenn in der Gegenwart oder in Vorstellungen etwas Wesentliches für die Erfüllung von Bedürfnissen wahrgenommen wird (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 176 ). Diese Empfindungen verändern und steuern daher das menschliche Verhalten auf die Erlangung dieser Ziele. Um die Entwicklung von Emotionen zu erklären, wurden drei Theorien vorgebracht.
Die “Differential Emotions Theory” (Pinquart et al. 2011, S.177; Herv. FF) nach Izard schreibt dem Menschen zehn veranlagte Grundemotionen zu: Ekel, Interesse, Freude, Ärger, Trauer, Furcht, Überraschung, Scham/Schuld, Distress/Schmerz und Verachtung (vgl. ebd., S. 177). Aus evolutionären Gründen verfügt der Mensch über spezifische mimische Ausdrucksformen. Die Aktivierung von bestimmten Gesichtsteilen durch die Gesichtsregungen stimuliert dazu gehörende Hirnareale, durch die Emotionen ausgebildet werden können (vgl. ebd., S.177).
Die zweite Theorie begründet sich auf das „ Internalisierungsmodell“ (ebd., S. 179; Herv. FF). Nach diesem Ansatz besitzt ein Säugling Vorläuferemotionen, welche durch Interaktion mit Bezugspersonen ab dem zweiten Lebensjahr zu vollentwickelten Emotionen werden. Weiterhin werden Gefühlszustände mit zunehmendem Alter schrittweise internalisiert. Ein erlebtes Gefühl wird in der sozialen Interaktion ausgedrückt, aber nicht mehr, wenn das Kind allein ist (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 179).
Das „ Differenzierungsmodell“ stellt den dritten und letzten Erklärungsansatz für die Entwicklung von Emotionen dar (vgl. ebd., S. 178; Herv. FF). In diesem Modell sind physiologische Zustände der Ursprung von Emotionen. In den ersten sechs Lebensmonaten werden sie zu „Proto-Emotionen“ (ebd., S. 178), bevor sie eine psychische Gefühlsqualität im zweiten Halbjahr erhalten. Bei der Geburt sind nur die „Basisemotionssysteme“ Ärger, Angst und Freude vorhanden (ebd., S. 178). Aus ihnen entwickeln sich dank sozialer Interaktionen und fortlaufender kognitiver Fortschritte differenziertere Emotionen. Zimmermann & Pinquart schreiben beispielsweise, dass sich Scham und Schuld zwischen anderthalb und drei Jahren aus dem Basissystem Angst entwickeln.
Oerter seinerseits benennt fünf Vorläuferemotionen, mit denen der Säugling ausgestattet zur Welt kommt: Distress, Wohlbehagen, Interesse, Erschrecken und Ekel. Diese frühen Emotionen drücken sich jeweils durch das Schreien, das Lächeln, eine Fokussierung der Aufmerksamkeit, ein Schreckreflex mit Körperanspannung und das Rümpfen der Nase mit vorgestreckter Zunge aus (vgl. Oerter et al. 1998, S. 554ff.). Diese Verhaltensweisen dienen der Information der Bezugsperson, damit sie auf die Bedürfnisse des Säuglings eingehen kann. In diesem Fall spricht man von einer interpersonalen Regulation der Emotionen, da diese von einer erwachsenen Person in der Interaktion gelenkt und kanalisiert werden. Dank der interpersonalen Regulation wird der Säugling dazu befähigt, seine Gefühlszustände immer mehr zu differenzieren, bis das Kind mit drei Jahren über ein zweifaches Repertoire an Emotionen verfügt (vgl. ebd., S. 556ff; Herv. FF). Mit zunehmendem Alter verschiebt sich jedoch die Regulation auf die intrapersonale Ebene und wird durch den Erwerb neuer Strategien selbst-initiiert. Während Säuglinge beispielsweise ihren Daumen lutschen, um sich zu beruhigen, disponieren Kleinkinder über steigende sprachliche Kompetenz, um ihre Gefühle zu äußern (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 193ff). Es ist nichtsdestotrotz anzumerken, dass die soziale Form der Emotionsregulation sich lebenslang fortsetzt (vgl. ebd., S.193).
Die Fähigkeit, die eigenen Gefühlszustände zu temperieren, geht in der emotionalen Entwicklung mit dem „ Emotionswissen“ (vgl. ebd., S. 179; Herv. FF) einher. Unter diesem Begriff werden verschiedene Wissensbestände betreffs Emotionen impliziert, die in unterschiedlichen Altersstufen erreicht werden, wobei bisher nicht von einem fortlaufenden Ablauf von Entwicklungsstufen gesprochen werden kann (vgl. ebd., S. 180). Der erste Bestandteil des Emotionswissens stellt das Erkennen von Gefühlen im Gesichtsausdruck dar, ein Verhalten das beinahe als angeboren erfasst wird. Dabei werden positive Emotionen, wie Freude, früher als negative korrekt gedeutet. Mit zunehmendem Alter können Kinder jedoch schneller und sicherer die Gemütszustände ihrer Interaktionspartner /-innen von ihrer Mimik ablesen (vgl. ebd., S. 180ff).
Ab dem dritten Lebensjahr erkennen Kinder die Zusammenhänge zwischen Emotionen und deren Anlässen und wissen, welche Ereignisse ein bestimmtes Gefühl auslösen können. Dasselbe gilt ebenso für innerpsychische Vorgänge, wie z.B. Wünsche oder Erinnerungen. Allerdings wissen sie erst zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr, dass Personen bei einer angenommen identischen Situation unterschiedliche Gefühle empfinden können (vgl. ebd., S. 184ff).
Zum Emotionswissen gehören sowohl Kenntnisse über die zuvor erwähnte Regulation der Emotionen als auch über ihre Ausdruckskontrolle. Diese Kompetenz gilt als „kulturelle Anpassungsleistung“ und „dient dem Erhalt sozialer Beziehungen“ (Pinquart et al. 2011, S. 187). Bei der Äußerung von Gefühlen übt jedoch der Sicherheitsgrad der Bindung zu den Bezugspersonen einen beträchtlichen Einfluss aus. Je sicherer die Bindung ist, desto wahrscheinlicher werden Kinder ihre Emotionen mitteilen, anstatt sie zu kontrollieren (vgl. ebd. S.187).
Zimmermann & Pinquart benennen mehrere Einflussfaktoren für den Umfang des Emotionswissens: nämlich die Sprachentwicklung sowie die Eltern-Kind-Kommuni-kation und -Bindung (vgl. Pinquart 2011, S. 190ff). Die sprachliche Kompetenz von Kindern ermöglicht ihnen die Entwicklung einer „Theory of mind“, welche die Fähigkeit, „Bewusstseinsinhalte als das Ergebnis von Bewusstseinsakten zu verstehen“ (Bischof-Köhler 2011, S.352) darstellt. Kinder sind dadurch fähig, sich in anderen Personen hineinzuversetzen und sich deren Verhalten zu erklären, indem sie Wünsche, Intentionen oder Meinungen bei sich selbst vermuten und den Anderen dann zuschreiben. Diese Fähigkeit wird ebenso durch die Qualität der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern gefördert. Wenn Eltern auf die inneren Zustände des Kindes eingehen und diese verbalisieren, ist das Kind immer mehr in der Lage das Befinden von seinen Mitmenschen nachzuvollziehen (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 191). Ein sicherer Bindungsstil begünstigt ebenso den Aufbau von Emotionswissen, insbesondere bezogen auf negative Emotionen (vgl. ebd., S. 191).
Zu Beginn des Paragraphs 2.2.2 wurde erwähnt, dass der Humor eine komplizierte, zusammengesetzte Emotion ist. Er gehört nicht zu den Grundemotionen (wie Freude oder Angst), die von einem Reiz unmittelbar erzeugt werden, weil er erst nach der kognitiven Verarbeitung von einer früheren meist negativen Grundemotion empfunden wird (vgl. Janata 1998, S. 140). Der Humor setzt sich aus verschiedenen emotionellen Komponenten zusammen, die ihm nicht spezifisch sind und auch nie in der gleichen Kombination wiederauftreten (vgl. ebd., S.140). Ein wichtiger emotioneller Bestandteil des Humors sind dennoch die angenehmen Gefühle, sogenannte „ Glücksgefühle “ (ebd. S. 141). Sie gehen zwar mit dem Empfindung von Humor einher, sind ihm aber nicht spezifisch, weil sie in anderen Situationen, wie beispielsweise nach einem guten Essen oder beim Musik hören, empfunden werden können (vgl. ebd., S. 141). Die emotionelle Komplexität des Humors zeigt, wie wichtig das Wissen über Emotionen ist, um ihn in seiner Ganzheit zu verstehen. Daher kann vermutet werden, dass es seine lustvolle und belohnende Seite ist, die die Kinder motiviert, lustige Situationen zu produzieren.
Zum Schluss wird die emotionale Entwicklung als „Veränderungen im Erleben und im Ausdruck von Emotionen, im Emotionswissen, der Fähigkeit zum Erkennen von Gefühlen und in der Emotionsregulation“ zusammengefasst (Pinquart et al. 2011, S. 195).
Wie im Laufe dieses Abschnittes festgestellt werden konnte, sind die sozialen und emotionalen Entwicklungen in der frühen Kindheit eng mit einander geflochten. Zudem können sie von der Kognition nicht gesondert betrachtet werden. Janata schreibt: „ Mit der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten entwickelt sich auch die Emotionalität des Kindes. Und umgekehrt mit Hilfe der Emotionalität werden die Kognitionen weiterentwickelt “ (Janata 1998, S. 163, Herv. i. Orig.). Emotionen und Beziehungen üben einen erheblichen Einfluss auf die kindliche Motivation aus, sich die Welt intellektuell anzueignen. Aus diesem Grund erscheint es an dieser Stelle angemessen, bevor wir in dem nächsten Hauptteil dieser Arbeit eine mögliche Bedeutung des Humors als entwicklungsförderndes Phänomen für die frühe Kindheit erwägen, einen kleinen Exkurs in die neurobiologischen Aspekte der Motivation zu machen.
2.3 Neurobiologischer Exkurs: Motivationssyteme und Humor
Interessanterweise findet man am etymologischen Ursprung der Begriffe Motiv und Motivation dasselbe lateinische Wort wie für Emotion, nämlich „movere“ (vgl. Köbler 1995, S. 274). Wie wir zu Beginn des Paragraphen über die emotionale Entwicklung im Abschnitt 2.2.2 schon angedeutet haben, bedeutet das Verb „movere“ bewegen. Daraus könnten wir ableitend vermuten, dass Emotionen und Motivation eng verknüpft sind und sich eventuell gegenseitig beeinflussen. Aber ist die Herkunft dieser zwei Aspekte des menschlichen Erlebens und Verhaltens im Gehirn ermittelbar und neurobiologisch nachweisbar?
In seinem Buch „Prinzip Menschlichkeit“ berichtet Joachim Bauer nach langjähriger Erforschung von der Entdeckung der „Antriebsaggregate des Lebens“ (Bauer 2006, S.24), welche auch als Motivations- bzw. Belohnungssyteme gekennzeichnet werden.
Ihre biologischen Bestandteile befinden sich in einer sehr zentralen Region des Gehirns, genauer in der „Ventralen Tegmentalen Area“ („VTA“) innerhalb des Mittelhirns. Sie bestehen aus Nervenzellen und bilden zusammen eine sogenannte Dopamin-Achse (vgl. ebd. S.28). Dopamin ist ein Botenstoff, der bei seiner Freisetzung durch Aktivierung des zuvor genannten Gehirngebietes ein Gefühl von Wohlbefinden vermittelt und Konzentration sowie Handlungsbereitschaft anregt (vgl. ebd., S. 29).
Oberhalb dieser für die Motivation zuständigen Region befindet sich das limbische System. Dieser gilt in der menschlichen Phylogenese als einer der ältesten Gehirnteile und ihm wird eine Funktion in der Entwicklung von Emotionen und Gefühlen zugeschrieben (vgl. Janata 1998, S.44). Das limbische System „generiert und drückt […] Emotionen, Motivationen, Sexual- und Sozialverhalten aus“ (Janata 1998, S. 47).
Zum limbischen System gehören u.a. der „Gyrus Cinguli“, welcher als Sitz des obersten Emotionszentrums aufgefasst wird, sowie der Hypothalamus, der durch die Freisetzung der Botenstoffe Dopamin und Oxytocin „an der Entstehung der angenehmen, belohnenden Gefühle maßgeblich beteiligt“ ist (Janata 1998, S. 51; Herv. i. Orig.).
In den letzten zehn Jahren wurde entdeckt, worin die natürliche Funktion der Motivationssyteme besteht. Neurobiologisch betrachtet zielen sie darauf ab, „soziale Gemeinschaft und gelingende Beziehungen mit anderen Individuen“, unter welche auch Tiere gerechnet werden, zu fördern (Bauer 2006, S.34). Bauer drückt ebenfalls aus, worauf der Mensch laut Forschung aufgrund seiner genetischen Veranlagung ausgerichtet ist: „ Kern aller Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben. “ (Bauer 2006, S. 34, Herv. i. Orig.)
Diese neuere neurobiologische Erkenntnis sorgte in der wissenschaftlichen Fachwelt für Überraschung, da seit der Veröffentlichung der Evolutionstheorie des britischen Naturwissenschaftlers Charles Darwins in 1859 die Annahme galt, dass der Mensch sowie alle andere Lebewesen zum Überleben naturbedingt für den Kampf und somit für aggressives Verhalten ausgestattet sei.
Auf dem ersten Blick erscheint es vielleicht nicht einleuchtend, warum an dieser Stelle neurobiologische Befunde im Bezug auf Emotionen und Motivationen im Rahmen einer Arbeit über die Bedeutung des Humors für die kindliche Entwicklung präsentiert werden. Bauer liefert den Ansatz einer Begründung, wenn er schreibt: „Jede Form von zwischenmenschlicher Resonanz und erlebter Gemeinschaft scheint die Motivations-syteme zu erfreuen“ (Bauer 2006, S. 42). Unter zwischenmenschlicher bzw. sozialer Resonanz wird u.a. das gemeinsame Lachen gemeint (vgl. ebd. S. 42), worin beispielsweise Zuwendung oder Anerkennung für einen guten Witz Ausdruck finden. Witze, Humor und ihre mögliche Begleiterscheinung, das Lachen, lösen eine Reaktion der Dopamin-Achse (Motivationssyteme) aus, wodurch die Produktion von den Botenstoffen Dopamin, Oxytocin sowie endogener Opioide (körpereigene Drogen) stimuliert wird. Die zwei ersten Botenstoffe wirken antreibend unter anderem wegen des Glücks- und Genuss-Potentials des Oxytocin, das außerdem für den Aufbau und die Aufrechterhaltung von Bindungen eine Rolle spielt. Die endogenen Opioide Endorphine, Enkephaline und Dynorphyne, die in verschiedenen Gehirnarealen produziert werden (vgl. Bauer 2006, S. 30), wirken sich auf die Emotionszentren aus. Somit veranlassen sie „positive Effekte auf das Ich-Gefühl, auf die emotionale Gestimmtheit und die Lebensfreude“ (vgl. ebd., S. 31).
Durch diesen Exkurs war beabsichtigt, die biologische bzw. neurobiologische Grundlage der fördernden Wirkung von Humor aufzuzeigen, bevor wir im Folgenden seine Effekte auf einzelne frühkindliche Entwicklungsebenen kritisch betrachten.
3. Diskussion: Ist der Humor entwicklungsfördernd?
Nach Janata sind das Lächeln und das Lachen, die Begleiterscheinungen des Humors, biologisch veranlagt (vgl. Janata 1998, S. 19). Hingegen ist seiner Meinung nach die Fähigkeit zum Humor nicht angeboren, sondern sie entstand im Laufe der menschlichen Evolution, weil sie durch ihren „positiven, belohnenden psychologischen und sozialen Wert“ vermutlich eine Rolle für das Überleben spielte (ebd. S. 21). Demnach können wir behaupten, dass in Menschen etwas wie ein humoristischer Keim ruht, der nur darauf wartet gepflegt zu werden, um zu gedeihen.
Wie dies schon im Paragraph 2.1.2. dargestellt wurden, erfolgt die Entwicklung des Lächelns, des Lachens und dessen, was Kinder als lustig empfinden, stufenweise. Ein ähnliches Stufenprinzip dringt ebenso die Entfaltung auf den kognitiven und sozialen Ebenen, während ein stufenartiger Ablauf der Entwicklung des Emotionswissens, als Bestandteil der emotionalen Entwicklung, bisher nicht nachgewiesen wurde (vgl. Pinquart et al. 2011, S. 180).
Anhand der vorhergehenden Kapitel dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass die Fähigkeit zum humorvollen Agieren mit der Reife bestimmter kognitiven Fertigkeiten eng in Verbindung steht. Eine für die Kindheit charakteristische Form der Wissens-aneignung und Kompetenzerweiterung ist das Spiel. Es wird außerdem sowohl als eine der „am stärksten beobachteten Ausdrucksformen im Kinderleben“ als auch „eine Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozess“ aufgefasst (Drews 2010, S. 251). In ihrer Dissertation bezeichnet Drews auch den Humor, sowie das Spiel, als eine besondere Form des kindlichen Ausdrucks (vgl. Drews 2010, S. 252). Paul McGhee definiert seinerseits den Humor als eine Art kognitives Spiel (vgl. McGhee 1979, S. 42). Anhand dieser Aussagen stellen wir fest, dass die humoristischen und spielerischen Tätigkeiten von hoher Bedeutung für die Kindheit sind.
In Piagets Stufen der kognitiven Entwicklung treten verschiedene Spielformen begleitet auf, nämlich das Übungs-, das Symbol- und das Regelspiel (vgl. Drews 2010, S. 252ff).
Das Übungsspiel ist charakteristisch für die sensomotorische Phase, in der Kinder sich durch die Wiederholung von Handlungen mit ihrem Körper und mit Gegenständen Verhaltensschemata aneignen. Der Spaß an der Ausführung von solchen Handlungen kann als Zeichen von Humor gesehen werden (vgl. ebd., S. 253). In dieser Phase erfassen Kinder ihre Umwelt überwiegend über ihre Sinne. Sie beginnen zu lächeln und zu lachen, da sie auf körperliche, visuelle und akustische Reize besonders rezeptiv sind. In diesen Beobachtungen ist zugleich die erste Phase der Humorentwicklung zu sehen. Dabei sind soziale Interaktionen, wie das Kitzeln, Versteckspiele oder die Produktion von lustigen Geräuschen, sehr geeignet, um den Sinn des Kindes für Humor und zugleich die Bindung an Bezugspersonen zu fördern. Dennoch ist dabei anzumerken, dass sich diese Interaktionsformen im Bezug auf die Emotionen des Kindes ambivalent auswirken können. Nach McGhee können die Inkongruenzen, welche das Lachen und die damit verbundenen Humorgefühle auslösen, ebenso gut die Neugier des Kindes wecken als auch einen Angstzustand hervorrufen (vgl. McGhee 1979, S. 46). Für das Empfinden von Humor muss sich das Kind sicher fühlen, indem die interagierende Person ihm das Gefühl vermittelt, dass die unmittelbare Situation nicht ernst zu nehmen ist (vgl. ebd., S. 47). Hierbei ist demzufolge die Bedeutung der Bindung zu den InteraktionspartnerInnen hervorzuheben, welche sich nach John Bowlby zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem dritten Lebensjahr entwickelt.
Die zweite Spielform, welche Kinder ab ca. dem 12. Lebensmonat entwickeln, ist das Symbolspiel. Es wird als „die eigentliche kindliche Form des Spiels“ (Drews 2010, S. 253) betrachtet. Zudem charakterisiert es sowohl die zweite Stufe der Humor-entwicklung nach McGhee als auch die zweite Phase der kognitiven Entwicklung nach Piaget (präoperationale Phase), welche als Stufe des symbolischen Denkens gilt. Durch die Anwendung von Symbolen grenzen sich Kinder zeitweilig von der Realität ab, indem sie Gegenständen und / oder Personen eine andere Bedeutung zuschreiben. Dennoch scheint es im Bezug auf die dahinter stehende Absicht einen Unterschied zwischen dem Symbolspiel und humorvollen Interaktionen zu geben (vgl. ebd., S. 253). Das Symbolspiel wird als eine ernsthafte Tätigkeit gesehen, welche der „Erschaffung einer kompensatorischen Welt, in der Ängste, Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck kommen“ (ebd., S. 253) dient. Nach dieser Auffassung nutzen die Kinder das Symbolspiel als Problemlösungsprozess, um die Macht ihrer Gefühle besser bewältigen zu können und beabsichtigen damit nicht humorvoll zu handeln. Die daraus entstehenden Inkongruenzen und das damit verbundene Empfinden von Humor liegen insofern nur an der Wahrnehmung der beobachtenden Personen und nicht an der kindlichen Intention. Wenn wiederum Kinder den Bezug zur Realität mit Absicht manipulieren, indem sie für eine beobachtende Person unerwartete Ereignisse durch ihr Handeln hervorbringen, dann wenden sie Humor an. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein Kind seine Füße in zwei Kartons steckt und damit auf dem Boden gleitet, als ob es Schlittschuh führe, während es sich lächelnd einer anwesenden Person zuwendet.
Das Regelspiel ist die dritte Spielform, welche Kinder erlernen. Diese Spielform herrscht nach Piaget auf der Stufe der konkreten Operationen zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr und wird im Jugend- sowie im Erwachsenenalter ausdifferenziert. Obwohl diese Alterspanne nicht mehr zur frühen Kindheit gehört, ist das Regelspiel trotzdem relevant, da die Fähigkeit zum Umgang mit Regeln bzw. sozialen Vereinbarungen sich schon im Kindergartenalter zwischen vier und sieben Jahren beginnt. Dabei können sowohl eigentliche Spiele, wie „Mensch, ärgere dich nicht“ oder Schach, als auch in einem breiteren Sinn das menschliches Zusammenleben, welches durch bestimmte gesellschaftliche Normen strukturiert wird, aufgefasst werden. Betrachten wir diese gemeinschaftliche Seite der Spieltätigkeit, dann können wir nämlich ebenfalls Humorinteraktionen entdecken. Diese können sich hierbei durch das Austesten und die Verletzung von explizit oder implizit vereinbarten gesellschaftlichen Normen äußern (vgl. Drews 2010, S. 254). Anbei ein Beispiel aus der Praxis. Zwei Kinder sitzen am Tisch zum Mittagessen im Kindergarten. Eines dieser Kinder beginnt in sein Glas zu spucken, worauf das andere Kind mit Lachen reagiert und die Handlung seines Freundes nachzuahmen beginnt. Der Spaß der Kinder wird durch die Wiederholung und die Übertreibung stark gesteigert, obwohl ihnen durch die Sozialisation im Elternhaus sowie in der Tageseinrichtung sicherlich schon bewusst ist, dass ihr Handeln der gesellschaftlich angenommenen Norm des Tischverhaltens widerspricht. In diesem Fall entsteht die humorvolle Situation durch den Verstoß gegen die Regel. Dieses Beispiel zeigt, dass der Humor unangepasste und unerwünschte Formen für den kindlichen Erziehungsprozess annehmen kann. Hierbei eignet sich ein verständnis- und humorvoller Umgang mit der Situation von Seiten der Erziehenden, da das kindliche Verhalten nicht auf bösem Willen beruht. Es gründet eher auf einem lustvollen, interaktiven und herausfordernden Spieltrieb, wie Drews im Spiel „ein Bedürfnis nach lustvoller Spannung“ und eine „Suche nach Diskrepanz“ (Drews 2010, S. 254) sieht. Dabei stellen der Humor und das Lachen ein Ventil dar, um die Spannung zu reduzieren.
Johanna Drews macht zum Schluss ihrer Studie eine positive Feststellung. Nach ihrem Befund verlaufen Humorinteraktionen sowohl zwischen Kindern als auch zwischen Kinder und pädagogischen Fachkräften überwiegend adaptiv (vgl. Drews 2010, S. 256).
Von adaptivem Humor spricht man, wenn mit humorvollen Handlungen Kontakt-aufnahme und Kommunikation erzielt werden und diese damit erfolgreich sind, während mit maladaptivem Humor, wie beispielsweise dem Auslachen, Abwehr und Verletzung beabsichtigt werden (vgl. ebd., S. 52). Da die Erhebung, die dieser Studie zu Grunde liegt, sich nur auf eine begrenzte Anzahl von Kindertageseinrichtungen bezieht, ist es leider nicht möglich diese Aussage zu verallgemeinern.
In Anbetracht der positiven Auswirkungen des Humors auf die allgemeine kindliche Entwicklung, erwähnt die Autorin sogar die Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit, Humor als Bildungs- und Erziehungsziel in die Bildungspläne der baden-württem-bergischen Kindertageseinrichtungen aufzunehmen. Wir können diesem Vorhaben nur zustimmen, wenn der Humor hiermit einen besonderen Stellenwert in der Erziehung bekommt. Dennoch lässt er sich nicht wie Zahlen oder Buchstaben erlernen, auch wenn kognitive Voraussetzungen für seine Entwicklung notwendig sind, sondern er braucht im Wesentlichen das Zwischenmenschliche um gedeihen zu können. Hierbei kommt sowohl Eltern als auch pädagogischen Fachkräften eine wichtige Rolle zu. Zwar richten sich die Empfehlungen der Autorin hinsichtlich pädagogischer Maßnahmen zur Förderung des Humors an ErzieherInnen und KindheitspädagogInnen, aber diese Anregungen können gleichwohl von den Eltern umgesetzt werden. Zum einen kommt es auf die Umgebung an, welche anregend gestaltet werden sollte. Zu einer den Humor fördernder Raumgestaltung gehören Verkleidungsmaterial, sowie visuelle und akustische Medien, wie Bilder, Bücher und Lied- oder Geschichtenaufnahmen (vgl. Drews 2010, S.229), auf welche die Kinder selbstständig nach eigenem Interesse Zugang haben. Eine wichtigere Bedeutung als die materiellen Bedingungen kommt es der gesamten zwischenmenschlichen Atmosphäre zu. Kinder müssen sich geborgen und sicher fühlen, um die für den Humor notwendigen Neugier und Spielfreude freien Lauf lassen zu können. Dabei spielt die „wohlwollende Aufmerksamkeit der Erwachsener“ (vgl. ebd., S. 229) eine verstärkende Rolle und fördert durch die Anerkennung des kindlichen Humorverhaltens die Entwicklung eines Selbstwertgefühls.
Dennoch liegt der zentrale Aspekt, der zur Entwicklung von Humor beiträgt, in der Person des Erziehenden. Da Kinder sich unter anderem durch Beobachtung und Nachahmung Wissen und Verhaltensweisen aneignen, betrachten sie die Erwachsenen als Modell. Es ist deswegen notwendig sowohl für pädagogische Fachkräfte als auch für Eltern, sich ihre persönliche Einstellung und ihr Wissen über den Humor zu vergegenwärtigen und kritisch zu betrachten (vgl. ebd., S. 230). Angesichts des Altersgefälles und des damit verbundenen Erfahrungsschatzes verfügen Kinder und Erwachsene über unterschiedliche Formen und Interpretationen von Humor. Aus diesem Grund ist es die Aufgabe der Erziehenden ihre humorvollen Verhaltensweisen an das Verständnis der Kinder anzupassen, damit diese von ihren Vorbildern profitieren und somit ihr Handlungsrepertoire erweitern können.
Da Erwachsene im Allgemeinen für Kinder diese Vorbildfunktion ausüben, ist eine kritisch reflexive Auseinandersetzung mit dem eigenen humoristischen Profil wirklich notwendig, denn der Humor hat nicht nur eine positive, förderliche Seite. Zwar spielt er die Rolle eines sozialen Schmiermittels (vgl. McGhee 1979, S. 103), welches die Entstehung und die Aufrechterhaltung zwischenmenschlicher Beziehungen fördert. Aber: “Seine erfrischendste und heilsamste Wirkung entfaltet der Humor, wenn er deutlich mit Liebe legiert ist“ (Reifarth 2003, S. 68). Der Autor beschreibt eine Abstufung humoristischer Verhaltensweisen, welche mit steigendem Liebesmangel korreliert. Je weniger Liebe es in der humorausübenden Person gibt, desto feindlicher wird der Ausdruck. Humor mit wenig Liebe wandelt sich in Ironie und schafft somit eher Distanz als Nähe zwischen dem Sender und dem Empfänger. (vgl. ebd., S.68). Ein trauriger oder enttäuschter Mensch, dessen Wunschbilder nicht erfüllt werden können, kann zum Sarkasmus neigen. Der aggressivste Ausdruck von Humor tritt dennoch in Form des Zynismus auf, wenn der Hass bei dem Sender die Liebe ersetzt hat. Der Humor spielt dabei für den Sender eine kathartische Funktion, indem er es ihr/ihm ermöglicht, sich von seinen negativen Gefühlen zu befreien, was zum Schaden der sozialen Umwelt geschieht (vgl. ebd., S.68). Diese Kehrseite des Phänomens Humor muss auf Grund dieser Tatsache allen pädagogisch tätigen Personen unbedingt bewusst und von ihnen berücksichtigt werden, damit der Humor seine entwicklungsfördernde Wirkung entfalten kann.
4. Fazit
Im Laufe dieser Arbeit haben wir erfahren, wie vielfältig die Ansichten und Theorien über den Humor sind und wie dies das Vorhaben erschwert, ihn zu definieren. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass jede der vorgestellten Theorien eine andere Facette dieses Phänomens aufdeckt und beleuchtet, ohne den Anspruch erheben zu können, die einzige Erklärung zu sein. Es kann somit behauptet werden, dass der Humor wie eine Abbildung der menschlichen Natur ist: zugleich biologisch, physio-logisch, emotional, psychisch, kognitiv und sozial.
Die Ergebnisse der jüngeren Humorforschung zeigen, nach welchem Ablauf sich der Humor in der Phase der frühen Kindheit entfaltet und welche seine Kennzeichen sind. Im nächsten Schritt wurde anhand der Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget, der Bindungstheorie von Bowlby und verschiedener Emotionstheorien geschildert, wie sich Kinder in diesem Lebensabschnitt kognitiv, sozial und emotional entwickeln.
Dank dieser Darlegungen kam das Ergebnis heraus, dass die Entwicklung des Humors sowohl den Erwerb kognitiver Fähigkeiten als auch die soziale Entwicklung qualitativ beeinflusst, weil er sich aufgrund seiner Tendenz zur sozialen Resonanz motivierend und verbindend auswirkt. Wiederum verlangt er hierfür Interaktionen mit einer aufmerksamen, zugewandten sozialen Umwelt.
In Anbetracht des breiten Wirkungsspektrums des Humors erscheint er möglicherweise als relevant für das Konzept des ganzheitlichen Lernens, welches nach der Äußerung des berühmten Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi als "Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ bezeichnet wird. In ihrem Artikel über die Bedeutung des ganzheitlichen Lernens ergänzt Liebertz sogar Pestallozis Aussage mit dem Wort Humor (vgl. Liebertz 2010, o.S.).
Zum Schluss dieser Arbeit wird eine vielleicht weniger wissenschaftliche, sondern persönliche Überlegung beigefügt. Anfangs wurde der deutsche Verleger und Publizist Henri Nannen (1913-1996) erwähnt, welchem die Worte „Humor ist Liebe.“ nachgesagt werden. Seiner Meinung nach hat der Humor eine wohltuende, tröstende Wirkung, indem er Menschen dabei hilft, Unvollkommenheiten und schwierige Situationen zu relativieren. Weiterhin wurde anhand der Literatur über die Humorforschung festgestellt, dass dieses Phänomen als eine Art Spiel verstanden wird (vgl. McGhee 1979, S. 42; Drews 2010, S. 251ff).
Auf der Suche nach Quellen für die Grundlage dieser Arbeit stieß ich auf das Buch von Roberto Maturana und Gerda Verden-Zöller, in welchem sie in der Liebe und im Spiel „die vergessenen Grundlagen des Menschseins“ sehen. Diese Assoziation der Begriffe Liebe und Spiel, welche zuvor in anderen Zusammenhängen auch zur Bezeichnung des Humors angewendet wurden, veranlasste mich dazu, dieses Phänomen auch als eine mögliche Grundlage des Menschseins zu betrachten. Obwohl Anzeichen von Humor bei Schimpansen und Gorillas entdeckt wurden, denen die Zeichensprache beigebracht wurde (vgl. McGhee 1979, S. 113ff), scheint der Humor aufgrund der Fähigkeit zu sprechen eine menschliche Eigenschaft zu sein.
Wenn adaptiver Humor, der auf Kommunikation und Kontakte abzielt, sowohl als wohlwollendes, liebevolles Spiel als auch im Menschen immanent betrachtet wird, dann kann dieses Phänomen ein Förderer auf dem Weg zur Menschlichkeit im Sinne von Joachim Bauer sein. Er definiert die Menschlichkeit als das „Ergebnis gelingender Kooperation“ (Bauer 2006, S. 223). Wie im Abschnitt 2.3 bereits erwähnt, ruft der Humor soziale Resonanz hervor, indem die neurobiologischen Motivationsysteme aktiviert werden, welche aufgrund der menschlichen genetischen Veranlagung Zuwendung, gelingende Beziehungen und somit Kooperationsverhalten erzielen. Daher ist es wichtig, insbesondere im pädagogischen Bereich aber auch für zwischen-menschliche Beziehungen im Allgemeinen, sich des eigenen Humors bewusst zu werden und zu pflegen. Der Humor ist in jeder Person vorhanden und kann sogar erlernt bzw. entwickelt werden. Aus diesem Grund werden in Instituten, wie an der Tamala Clown-Akademie in Konstanz, Workshops, Seminare und Fortbildungen angeboten, um in Form eines Persönlichkeitstrainings die eigenen humoristischen Kompetenzen zu befreien und sie im beruflichen bzw. privaten Leben einsetzen zu können.
Liebevoller Humor, wie gesunde Ernährung, kann nicht schaden und macht uns vielleicht menschlicher, wenn wir uns dadurch selber nicht zu viel ernst nehmen und damit besser mit einander kommunizieren und kooperieren.
5. Literaturverzeichnis
- Bauer, J. (2006): Prinzip Menschlichkeit – Warum wir von Natur aus kooperieren. Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Bergson, H. (1900): Le rire. Essai sur la signification du comique. http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/le_rire/le_rire.html (Zugriff am 12.12.2011).
- Bischof-Köhler, D. (2011): Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend – Bindung, Empathie und Theorie of Mind. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bönsch-Kauke, M. (2003): Psychologie des Kinderhumors – Schulkinder unter sich. Opladen: Leske + Budrich.
- Drews, J. (2010): Kategorien und Funktionen des frühkindlichen Humors, seine Wirkungen und die Möglichkeiten einer bewussten Induzierung in Bildungs- und Erziehungsprozessen von Kindern. http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2010/5268/pdf/01_Dissertation_drews.pdf (Zugriff am 14.12.2011).
- Eggert-Schmid Noerr, A. (2002): Über Humor und Witz in der Pädagogik. In: Gstach, J. (Hrsg.): Professionalisierung in sozialen und pädagogischen Feldern. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik. Nr. 13, S. 123-140. Gießen: Psychosozial Verlag.
- Falkenberg, I. (2010): Entwicklung von Humor und Lachen in den verschiedenen Lebensphasen. In: Zeitschrift für Gerontologie und Psychiatrie. Jg. 43, Nr. 1, S. 25-30. Heidelberg: Springer.
- Janata, J. (1998): Zur Anatomie des Humors – Interdisziplinäre Betrachtungen. Prag: Maxdorf.
- Köbler, Gerhardt (1995): Deutsches Etymologisches Wörterbuch. http://www.koeblergerhard.de/derwbhin.html (Zugriff am 05.12.2011).
- Liebertz, C. (2007): Lachen und bilden ein Traumpaar – Bedeutung des Lachens für das Lernen. In: Unsere Kinder – Das Fachjournal für Bildung und Betreuung in der frühen Kindheit. Jg. 62, Nr. 3, S. 10-13. Linz: UNSERE KINDER.
- Liebertz, C. (2010): Warum ist ganzheitliches Lernen wichtig? http://www.kindergartenpaedagogik.de/419.html (Zugriff am 11.12.2011).
- Lorenzen, A. (2007): Humor und Pädagogik. Zur Bedeutung des Humors in pädagogischen Zusammenhängen. Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.
- McGhee, P. (1979): Humor – Its origin and development. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- McGhee, P. (Hrsg.) (1980): Children's Humour. New York: John Wiley and Sons.
- McGhee, P. (2010a): Children's Humor: Infancy to Age Three. http://www.laughterremedy.com/2010/12/children%E2%80%99s-humor-infancy-to-age-three/ (Zugriff am 24.11.2011).
- McGhee, P. (2010b): Children's Humor: The Preschool Years. http://www.laughterremedy.com/2011/01/children%E2%80%99s-humor-the-preschool-years/ (Zugriff am 24.11.2011).
- Oerter R, Montada, L. (2008) (Hrsg.): Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz.
- Piaget, J. (1975): Das Erwachen der Intelligenz bei Kindern. Stuttgart: Klett.
- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2011): Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter. Göttingen: Hogrefe.
- Reifarth, W. (2003): Das AHLMOZ-Prinzip: Grundfaktoren des Zwischenmenschlichen. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Jg. 83, Nr. 2, S. 64-69. Berlin: Deutscher Verein für Öffentliche und Private Fürsorge.
- Textor, M. (2005): Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung. http://www.kindergartenpaedagogik.de/1226.html ( Zugriff am 04.12.2011).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit setzt sich mit dem Phänomen Humor und seiner Relevanz für die individuelle Entwicklung in verschiedenen Bereichen während der Phase der frühen Kindheit auseinander. Sie untersucht, ob Humor eine förderliche Wirkung auf die allgemeine kognitive, soziale und emotionale Entwicklung in dieser Altersspanne hat.
Wie definiert die Arbeit Humor?
Die Arbeit stellt verschiedene Humortheorien vor, da sie trotz ihrer Vielzahl alle ein Stück weit zutreffende Aspekte zur Erklärung dieses Phänomens beinhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Humor schwer zu definieren ist und viele wissenschaftliche Bereiche sich damit auseinandergesetzt haben.
Welche Humortheorien werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit stellt geisteswissenschaftliche, philosophische, psycho-physiologische, evolutionsbiologische, soziologische, sozialpsychologische, psychoanalytische und Kognitionstheorien zur Erklärung des Humors vor.
Welche Entwicklungsstufen des Humors werden bei Kindern beschrieben?
Es wird auf die Entwicklung des Lächelns und Lachens eingegangen. Die Arbeit beschreibt ein Stufenmodell der Humorentwicklung nach Paul McGhee, beginnend mit dem Lachen über inkongruente Situationen (6-12 Monate), über inkongruente Handlungen mit Objekten (12-13 Monate), sprachlichen Humor (24-27 Monate), bis hin zu multiple Formen von Humor in der Phase der Entstehung des Sinns für Humor (3-5 Jahre).
Wie wird die kognitive Entwicklung in der frühen Kindheit dargestellt?
Die Arbeit stellt Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung vor, wobei insbesondere auf die sensumotorische und präoperationale Phase eingegangen wird.
Wie werden soziale und emotionale Aspekte der Entwicklung behandelt?
Es wird auf die Bedeutung von Bindungstheorie und Bindungsstilen eingegangen. Die Arbeit beschreibt verschiedene Theorien zur Entwicklung von Emotionen und die Entwicklung emotionaler Kompetenz.
Welche Rolle spielt das Gehirn bei Motivation und Humor?
Es wird ein neurobiologischer Exkurs über Motivationssysteme und deren Zusammenhang mit Emotionen, Glücksgefühlen und sozialer Interaktion gegeben.
Ist Humor entwicklungsfördernd?
Die Arbeit diskutiert, ob Humor entwicklungsfördernd ist. Es wird auf die Bedeutung von Spiel und Humorinteraktionen eingegangen. Abschließend werden Empfehlungen für die Förderung von Humor in der Erziehung gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass es adaptiven und maladaptiven Humor gibt.
Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Humor die kognitive und soziale Entwicklung beeinflusst, weil er sich motivierend und verbindend auswirkt. Voraussetzung ist dafür jedoch ein aufmerksames, zugewandtes soziales Umfeld.
- Citation du texte
- Frederic Fernandes (Auteur), 2011, Der Humor als entwicklungsförderndes Phänomen in der frühen Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308455