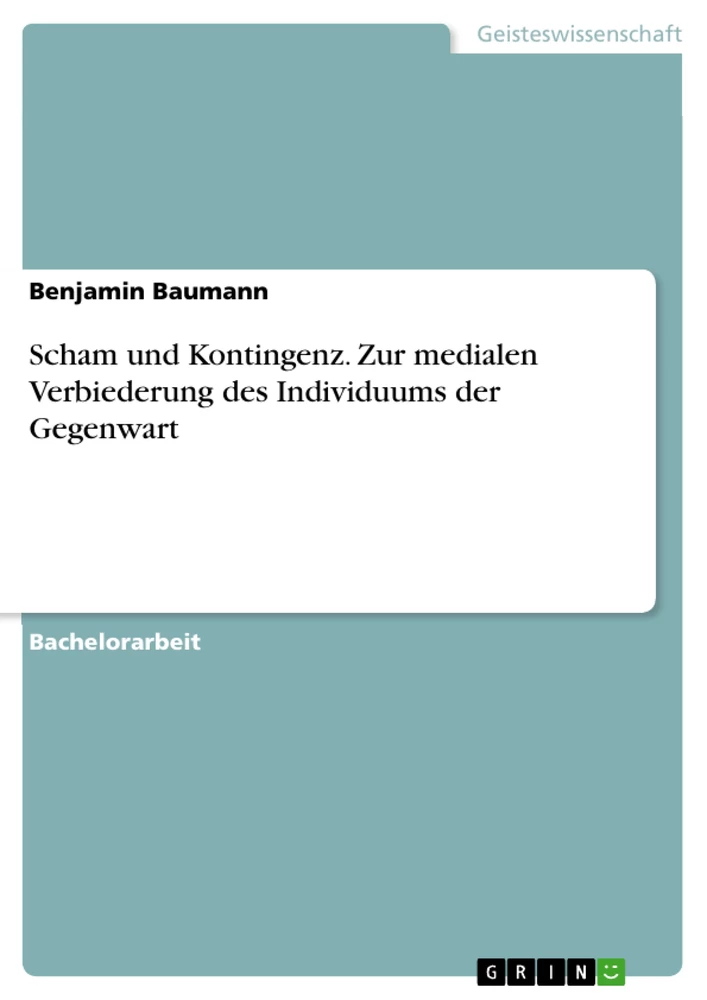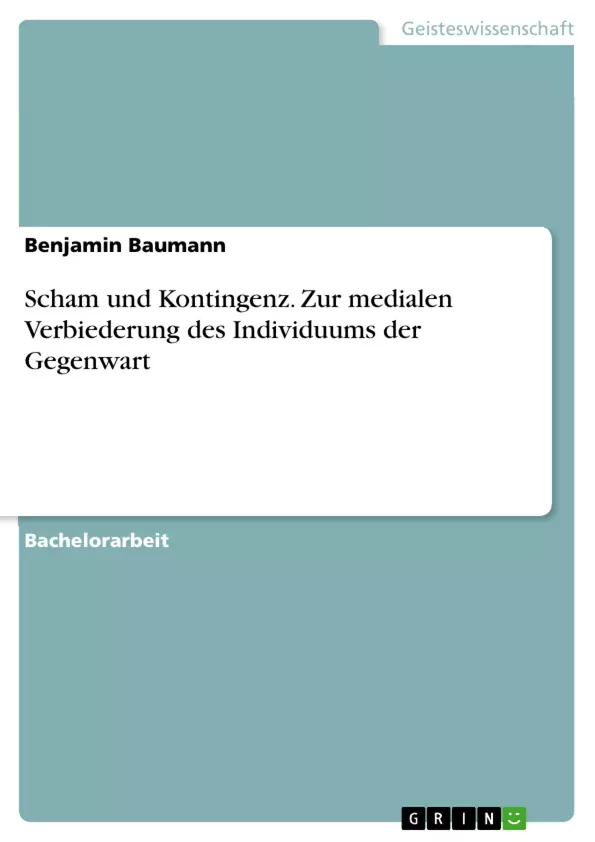Die vorliegende Arbeit nimmt Anstoß an der Beobachtung, dass gegenwärtig eine erstaunlich fraglose Bereitschaft zur umfangreichen Medienkonsumtion in breiten Teilen der modernen Gesellschaft entwickelt ist. Dabei werden Folgen der Individualisierung, Isolation und Virtualisierung ganzer Spektren von Lebenswelten ins Selbstverständnis der Protagonisten übernommen.
Die Arbeit fragt nach den anthropologischen Hintergründen der medialen Verbiederung, als dem durch Medien gestützten und forcierten Rückzug der Menschen aus der sich leerenden Öffentlichkeit in den Raum mediengefüllter Intimsphären. Welche anthropologischen Phänomene können die paradoxen Entwicklungen moderner Gesellschaften begründen, deren Angehörige sich nach Nähe, Wärme und persönlicher Anerkennung zu sehnen scheinen, während sie sich in eine durch Sichtbarkeit geprägte Isolation sozialen Handelns begeben, indem sie zu passiven Mitgliedern einer in einsame Individuen ausdifferenzierten Zuschauermasse mutieren?
Die Ursachen dafür finden sich – laut Arbeitsthese – im Konflikt von Autonomie und Kontingenz, der im säkularen Selbstverständnis moderner Individuen unbewältigt bleibt. Die fehlende Akzeptanz der Abkünftigkeit eigenen Daseins führt zur ontischen Scham, die als dauernde Identitätsstörung auftritt. Das destabilisierte Selbst zieht sich aus Furcht vor weiteren Zurücksetzungen innerhalb öffentlicher Blick- oder kommunikativer Anerkennungsverhältnisse in ein asozial-narzisstisches Dasein zurück. Infolge dessen kommt es zur Degeneration der Öffentlichkeit zugunsten einer individualisierenden Virtualisierung von Interaktion in Bild und Ton.
Die Arbeit will zeigen, dass die Stabilität gegenwärtiger Demokratien auf systemimmanenten Beschämungs- u. Beleidigungsverhältnissen fußt, die zur Entstehung einer klassenlosen Klassengesellschaft beitragen und den Wunsch nach virtueller Selbstverbergung verständlich werden lassen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. VON DER KONTINGENZ ZUR DASEINSSCHAM
- 1.1 Das Geschlecht als existentielles Zeichen der ontischen Scham
- 1.1.1 Internalisierte Schuld ist nicht Scham.
- 1.1.2 Die Geschlechtsscham
- 1.1.2.1 Die ontische Scham im Genesis-Mythos
- 1.1.2.2 Das Geschlecht bei Platon: Eros und Thymos
- 1.2 Die transzendierende Identität und die moderne Frage nach dem Selbstseinkönnen bei Kierkegaard
- 2. VON DER TRANSZENDENZ DES SELBSTSEINKÖNNENS ZUR IMMANENZ DES SELBSTSEINMÜSSENS..
- 2.1 Säkularismus
- 2.2 Von der ontischen Scham zur moralischen Scham
- 2.3 Der Säkularismus begünstigt das Schamempfinden.
- 2.3.1 Das sichtbare Haben als Vorurteil des verborgenen Seins
- 2.3.2 Scham und der Blick des Anderen: Anerkennungsprobleme
- 3. VON DER ÖFFENTLICHKEIT ZUR PRIVATHEIT
- 3.1 Das Ideal der persönlichen Empfindung
- 3.2 Intimität, Narzissmus und die Pflicht zur Authentizität.
- 3.3 Vom Raum öffentlichen Handelns zur Durchgangsstrecke
- 3.3.1 Intimität und Zivilisiertheit
- 3.3.2 Der Raum als Durchgang.....
- 4. VON DER GESELLSCHAFT ZUR GEMEINSCHAFT
- 4.1 Statusscham: Von der Ehre zur Würde
- 4.2 Charismatische Beleidigungshierarchien moderner Gesellschaften.
- 4.3 Statusgruppen sind charismatische Herrscher
- 4.4 Statusgruppen als fundamentalistische Gemeinschaften
- 5. VON DER GEMEINSCHAFT ZUR VEREINZELUNG: VIRTUALISIERUNG DER LEBENSWELT...
- 5.1 Immanente Transzendierung des Selbst und prometheische Scham
- 5.2 Kompensationsformen der Prometheischen Scham...
- 5.2.1 Autonome Raumbewegung des Users.....
- 5.2.2 Vom Film und Fernsehen.
- 5.2.3 Vom gemeinsamen Handeln zur gemeinsamen Flucht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die mediale Verbiederung der Öffentlichkeit als Symptom einer Anerkennungskrise des säkularen Individuums der Gegenwart. Sie befasst sich mit den anthropologischen Ursachen dieser Entwicklung und beleuchtet den Konflikt zwischen Autonomie und Kontingenz im Selbstverständnis des modernen Menschen. Die Arbeit analysiert, wie die fehlende Akzeptanz der Abkünftigkeit des eigenen Daseins zu ontischer Scham führt und welche Folgen diese für die soziale Interaktion, die Öffentlichkeitskultur und die Virtualisierung von Lebenswelten hat.
- Die Rolle der ontischen Scham in der Moderne
- Der Konflikt zwischen Autonomie und Kontingenz
- Die mediale Verbiederung der Öffentlichkeit
- Die Individualisierung und Virtualisierung von Lebenswelten
- Die Bedeutung von Anerkennung und Status in modernen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Kontingenz und Daseinsscham, wobei das Geschlecht als existentielles Zeichen der ontischen Scham betrachtet wird. Das zweite Kapitel untersucht den Einfluss des Säkularismus auf die Entwicklung von Scham und die Herausforderungen, die sich für die Selbstfindung des modernen Menschen ergeben. Kapitel drei thematisiert den Wandel von der Öffentlichkeit zur Privatheit und den Einfluss von Intimität und Narzissmus auf die gesellschaftliche Interaktion. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Statusscham und der Entstehung einer klassenlosen Klassengesellschaft, die durch charismatische Beleidigungshierarchien geprägt ist. Das fünfte Kapitel untersucht die Virtualisierung der Lebenswelt und die Auswirkungen der prometheischen Scham auf das Selbstverständnis des modernen Menschen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: ontische Scham, Kontingenz, Autonomie, Säkularismus, Anerkennung, Öffentlichkeit, Privatheit, Virtualisierung, Status, Gesellschaft, Gemeinschaft, Individualisierung, Medienkonsum.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „mediale Verbiederung“?
Er beschreibt den durch Medien forcierten Rückzug des Individuums aus der Öffentlichkeit in eine mediengefüllte Intimsphäre, geprägt von passiver Isolation.
Wie hängen Scham und Kontingenz zusammen?
Die fehlende Akzeptanz der eigenen Endlichkeit und Zufälligkeit (Kontingenz) führt im säkularen Selbstverständnis zu einer „ontischen Scham“, einer dauerhaften Identitätsstörung.
Welche Rolle spielt der Säkularismus bei der Entstehung von Scham?
Der Säkularismus begünstigt Scham, da das Individuum ohne transzendente Rückbindung allein auf sein „sichtbares Haben“ und die Anerkennung durch den Blick anderer angewiesen ist.
Was ist „prometheische Scham“?
Es ist die Scham des Menschen angesichts der Überlegenheit seiner eigenen technischen Schöpfungen, was zur Flucht in virtuelle Welten führen kann.
Warum ziehen sich Menschen in die Virtualität zurück?
Aus Furcht vor Zurücksetzung und Beschämung in realen sozialen Räumen suchen Individuen Anerkennung in virtuellen Räumen, was jedoch die Isolation verstärkt.
Wie beeinflusst diese Entwicklung die Demokratie?
Die Arbeit argumentiert, dass moderne Demokratien auf systemimmanenten Beschämungsverhältnissen fußen, die eine „klassenlose Klassengesellschaft“ und den Wunsch nach Selbstverbergung fördern.
- Citar trabajo
- Benjamin Baumann (Autor), 2011, Scham und Kontingenz. Zur medialen Verbiederung des Individuums der Gegenwart, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308470