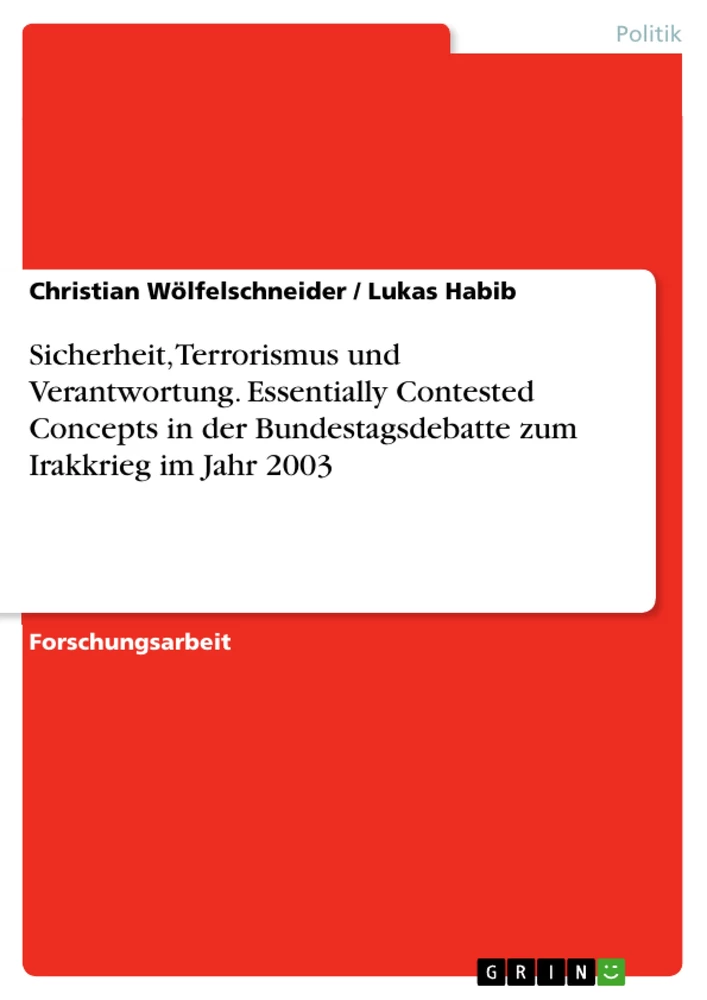Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Debatte im deutschen Bundestag über den Irakkrieg im Jahr 2003.
Von besonderem Interesse ist im Rahmen unserer Forschungsarbeit, wie wesentliche Begriffe des Diskurses aus den unterschiedlichen politischen Positionen verwendet wurden und welche Wirkung sie erzielen sollten. Daher erscheint nicht zuletzt die Betrachtung der Bundestagsdebatte als sinnvoll, da hier die mehrheitlichen geistigen Strömungen der Bundesrepublik in einem formellen Forum konkurrieren.
Als zentral haben wir dabei die Begriffe Sicherheit, Terrorismus und Verantwortung erachtet, die auf quantitativer und qualitativer Ebene eine nicht zu vernachlässigende Rolle einnahmen und seitens der politischen Akteure heftig umstritten waren.
Aus diesem Grund erscheint uns zur Erforschung unserer Fragestellung das Modell der „Essentially Contested Concepts“ von Walter Bryce Gallie als geeignet, da es den Anspruch hat, die Kernbedeutung eines Begriffes und gleichzeitig die individuellen Nivellierungen durch verschiedene Individuen, die beispielsweise aus der Vertretung gewisser politischer Gruppierungen oder differenter persönlicher Wertvorstellungen heraus resultieren kann, zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Problemaufriss
- Theorie & Methode
- „Essentially Contested Concept“
- Anwendung und Verbindung zur Forschungsarbeit
- Analyse des Datenmaterials
- Der Begriff der „Sicherheit“
- Der Begriff des „Terrorismus“
- Der Begriff der „Verantwortung“
- Ergebnisdiskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Forschungsarbeit zielt darauf ab, die Verwendung der Begriffe „Sicherheit“, „Terrorismus“ und „Verantwortung“ in der Bundestagsdebatte vom 13. Februar 2003 zu untersuchen und zu analysieren, wie diese Begriffe von den verschiedenen politischen Positionen verwendet wurden und welche Wirkung sie erzielen sollten.
- Analyse der Verwendung der Begriffe „Sicherheit“, „Terrorismus“ und „Verantwortung“ im Kontext der Irak-Frage.
- Untersuchung der unterschiedlichen Interpretationen und Perspektiven auf diese Begriffe innerhalb der politischen Landschaft Deutschlands.
- Bewertung der Rolle dieser Begriffe in der Formulierung und Durchsetzung von politischen Strategien.
- Erforschung des Einflusses des „Essentially Contested Concept“ auf die Debatte.
- Analyse der Auswirkungen der Bundestagsdebatte auf das transatlantische Verhältnis.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel bietet einen Überblick über die problematische Situation, die zur Bundestagsdebatte vom 13. Februar 2003 führte. Es wird die Disharmonie zwischen der deutschen und amerikanischen Politik im Vorfeld des Irakkrieges beschrieben, die durch die unterschiedlichen Auffassungen zum Thema „Sicherheit“ und zum Einsatz der Bundeswehr im Ausland geprägt war.
Das zweite Kapitel widmet sich der theoretischen Grundlage der Forschungsarbeit. Es wird das Konzept des „Essentially Contested Concept“ erläutert und seine Bedeutung für die Analyse von Diskursen im politischen Kontext hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieses Konzepts in der Untersuchung der Bundestagsdebatte.
Das dritte Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse des Datenmaterials. Es werden die verschiedenen Interpretationen der Begriffe „Sicherheit“, „Terrorismus“ und „Verantwortung“ von Seiten der Regierung und der Opposition untersucht. Die unterschiedlichen politischen Standpunkte und deren Auswirkungen auf die Debatte werden beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Schlüsselwörter dieser Forschungsarbeit sind: Sicherheit, Terrorismus, Verantwortung, Essentially Contested Concept, Bundestagsdebatte, Irak-Krieg, transatlantisches Verhältnis, politische Positionen, Diskursanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Essentially Contested Concepts“?
Es handelt sich um Begriffe, deren Kernbedeutung zwar anerkannt ist, deren konkrete Auslegung aber je nach politischer oder persönlicher Wertvorstellung variiert.
Welche Begriffe wurden in der Bundestagsdebatte 2003 analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Begriffe „Sicherheit“, „Terrorismus“ und „Verantwortung“ im Kontext des Irakkrieges.
Wie unterschieden sich die Positionen von Regierung und Opposition?
Die Arbeit zeigt auf, wie dieselben Begriffe genutzt wurden, um gegensätzliche politische Strategien und Handlungsnotwendigkeiten zu begründen.
Welche Wirkung sollten diese Begriffe erzielen?
Sie dienten dazu, die eigene Position moralisch und politisch zu legitimieren und die Gegenseite unter Druck zu setzen.
Warum wurde gerade die Debatte zum Irakkrieg gewählt?
Hier konkurrierten die mehrheitlichen geistigen Strömungen der Bundesrepublik in einem formellen Forum besonders intensiv miteinander.
- Quote paper
- M.A. Christian Wölfelschneider (Author), Lukas Habib (Author), 2013, Sicherheit, Terrorismus und Verantwortung. Essentially Contested Concepts in der Bundestagsdebatte zum Irakkrieg im Jahr 2003, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308578