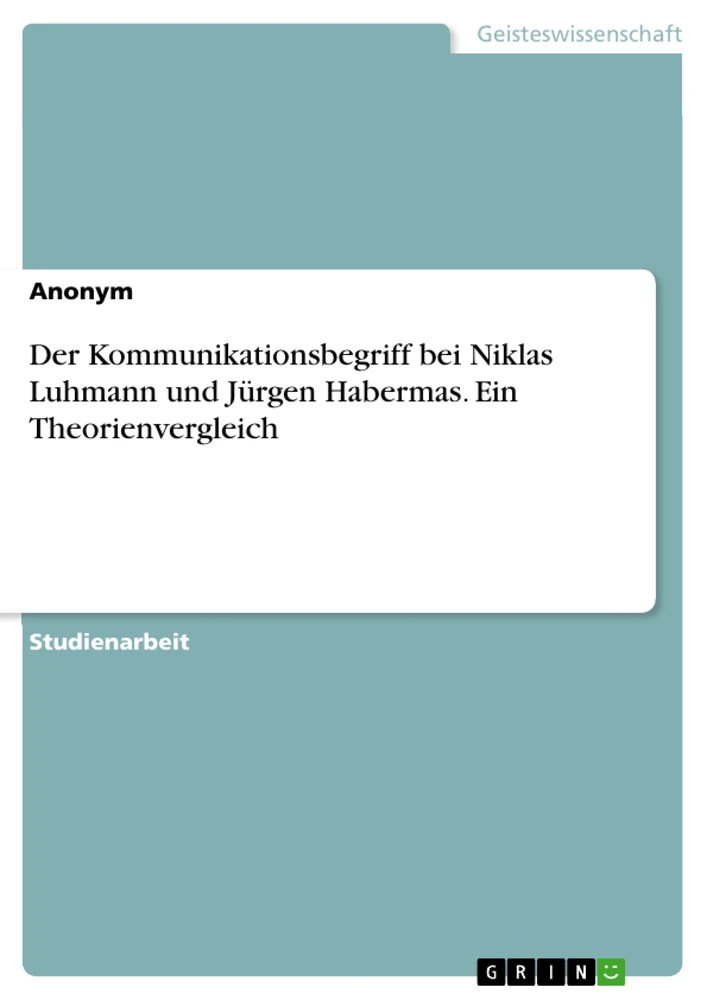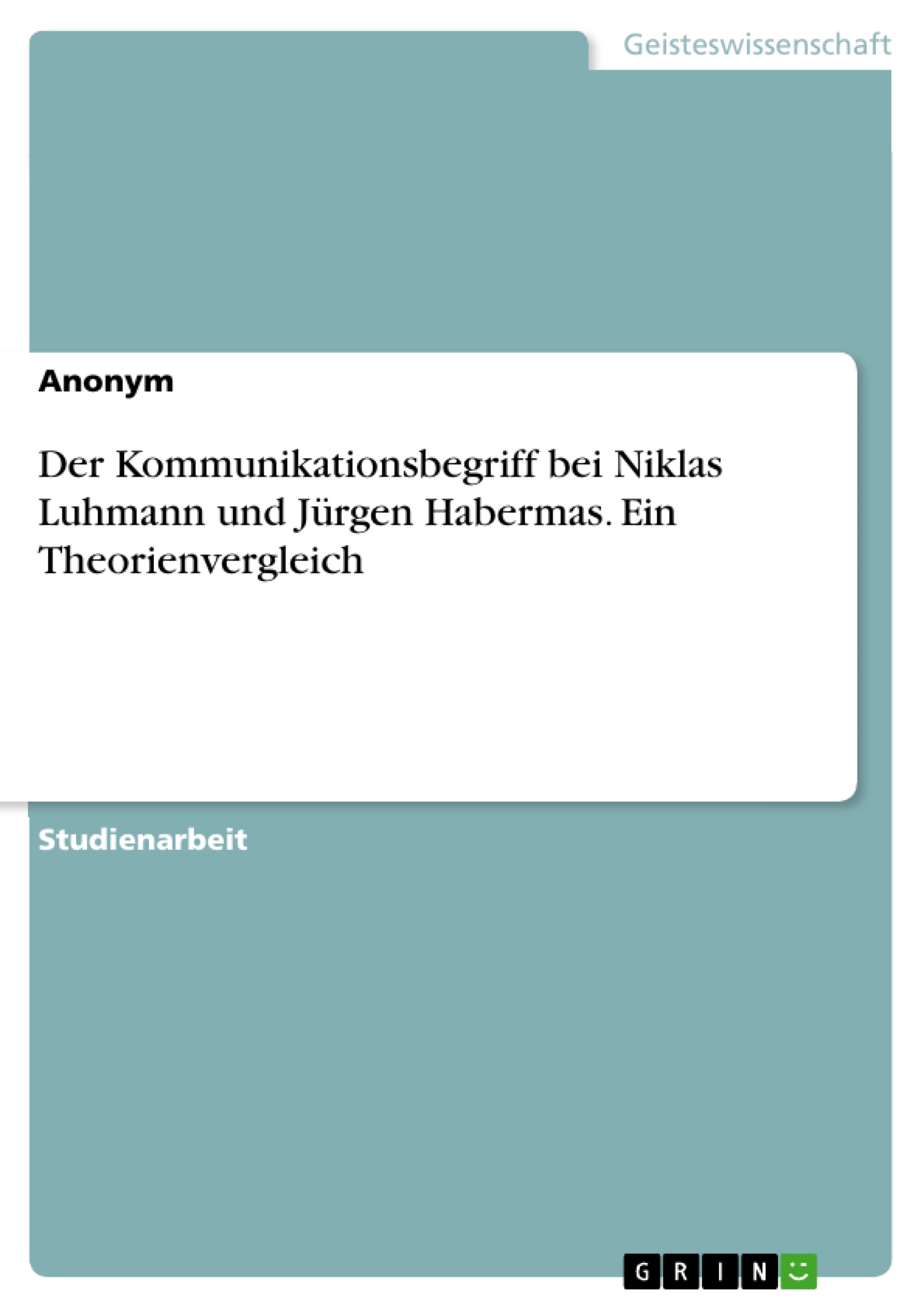Da Kommunikation für die Möglichkeit sozialer Ordnung bei Luhmann wie auch bei Habermas eine zentrale Rolle in ihren Theorien einnimmt, liegt der Fokus in vorliegender Hausarbeit auf dem Kommunikationsbegriff.
Aber sind die Definitionen, die Funktionen und die Auffassungen der beiden komplett unterschiedlich oder lassen sich doch einige Gemeinsamkeiten erkennen?
Um diesen Unterschieden beziehungsweise Ähnlichkeiten in den theoretischen Konstrukten von Luhmann und Habermas auf den Grund zu gehen, werden beide einem Vergleich unterzogen. Zu Beginn werden die Gesellschaftstheoretiker kurz vorgestellt. Anschließend werden die Grundzüge ihrer Theorie grob veranschaulicht, um dann explizit auf den Kommunikationsbegriff einzugehen.
Nachdem alle theoretischen Gesichtspunkte berücksichtigt wurden, werden die zwei Auffassungen einander gegenüber gestellt, um die Überschneidungen und Differenzen klar darstellen zu können. Abschließend werden die wichtigsten Aspekte in der Reflexion auf den Punkt gebracht, um der Frage auf den Grund zu gehen, inwiefern und in welchen Gesichtspunkten sich die Auffassungen von Luhmann und Habermas unterscheiden beziehungsweise in welcher Hinsicht diese in eine ähnliche Richtung gehen .
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Person Jürgen Habermas und der Theorie des kommunikativen Handelns
- Grundstrukturen der Kommunikation
- Kommunikatives Handeln
- Lebenswelt und System: Zweistufiges Modell der Gesellschaft
- Zur Person Niklas Luhmann
- Vergleich der beiden Konzeptionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Konzepte der Kommunikation von Niklas Luhmann und Jürgen Habermas, zwei einflussreichen Sozialtheoretikern, und setzt sie in Beziehung zueinander. Das Hauptziel der Arbeit besteht darin, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren jeweiligen Ansätzen zu identifizieren und zu beleuchten.
- Das Konzept der Kommunikation in den Theorien von Luhmann und Habermas
- Der Einfluss der beiden Theoretiker auf die Soziologie und Kommunikationswissenschaft
- Die Rolle der Kommunikation in der gesellschaftlichen Ordnung
- Der Vergleich der Grundprinzipien und zentralen Elemente der beiden Konzeptionen
- Die Relevanz der Luhmann-Habermas-Kontroverse für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Niklas Luhmann und Jürgen Habermas als einflussreiche Vertreter der Systemtheorie und der kritischen Theorie vor und erläutert die Relevanz ihrer Auseinandersetzung im Werk „Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie“. Sie beleuchtet den Fokus der Hausarbeit auf dem Kommunikationsbegriff und die Intention, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Konzepten der beiden Theoretiker herauszuarbeiten.
Zur Person Jürgen Habermas und der Theorie des kommunikativen Handelns
Dieser Abschnitt liefert einen kurzen Überblick über Jürgen Habermas' Leben und Werk, wobei besonders auf seine „Theorie des kommunikativen Handelns“ und ihre zentralen Elemente eingegangen wird. Es werden die Grundstrukturen der Kommunikation nach Habermas, der Begriff des kommunikativen Handelns und sein zweistufiges Modell der Gesellschaft mit den Komponenten System und Lebenswelt vorgestellt.
Zur Person Niklas Luhmann
Dieser Abschnitt widmet sich Niklas Luhmann und seiner Theorie der sozialen Systeme. Er behandelt die zentrale Rolle der Kommunikation in Luhmanns Ansatz und bietet eine kurze Darstellung seiner wichtigsten Werke.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Vergleich der Kommunikationstheorien von Niklas Luhmann und Jürgen Habermas. Zentrale Themen sind die Systemtheorie, die kritische Theorie, das kommunikative Handeln, die Lebenswelt, soziale Systeme, Geltungsansprüche, Sprechakte und der Diskurs.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Der Kommunikationsbegriff bei Niklas Luhmann und Jürgen Habermas. Ein Theorienvergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308619