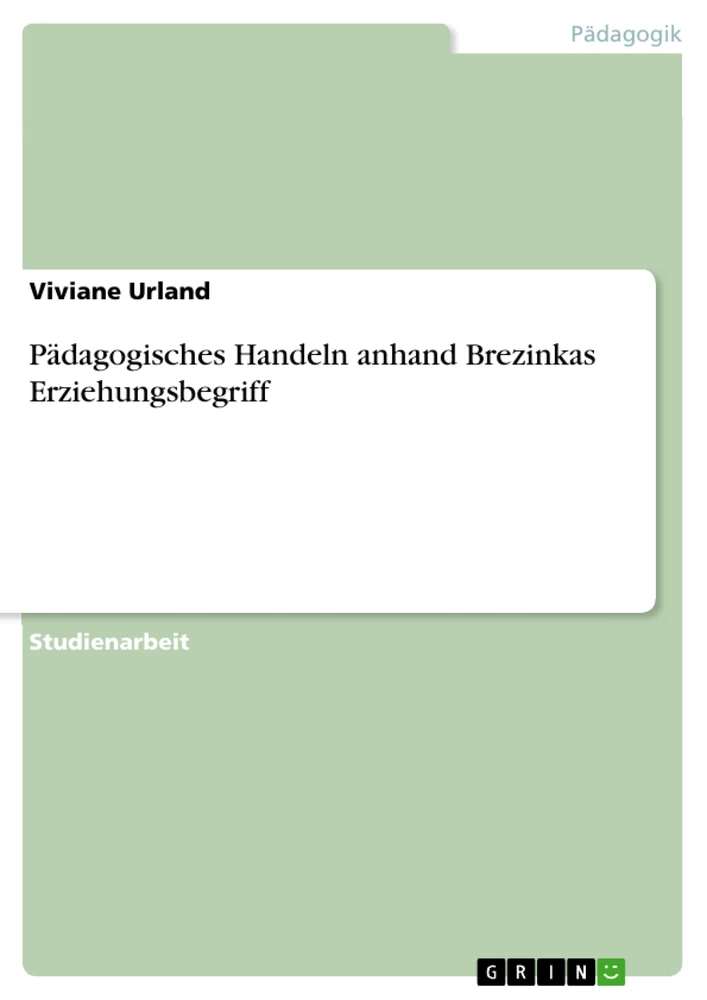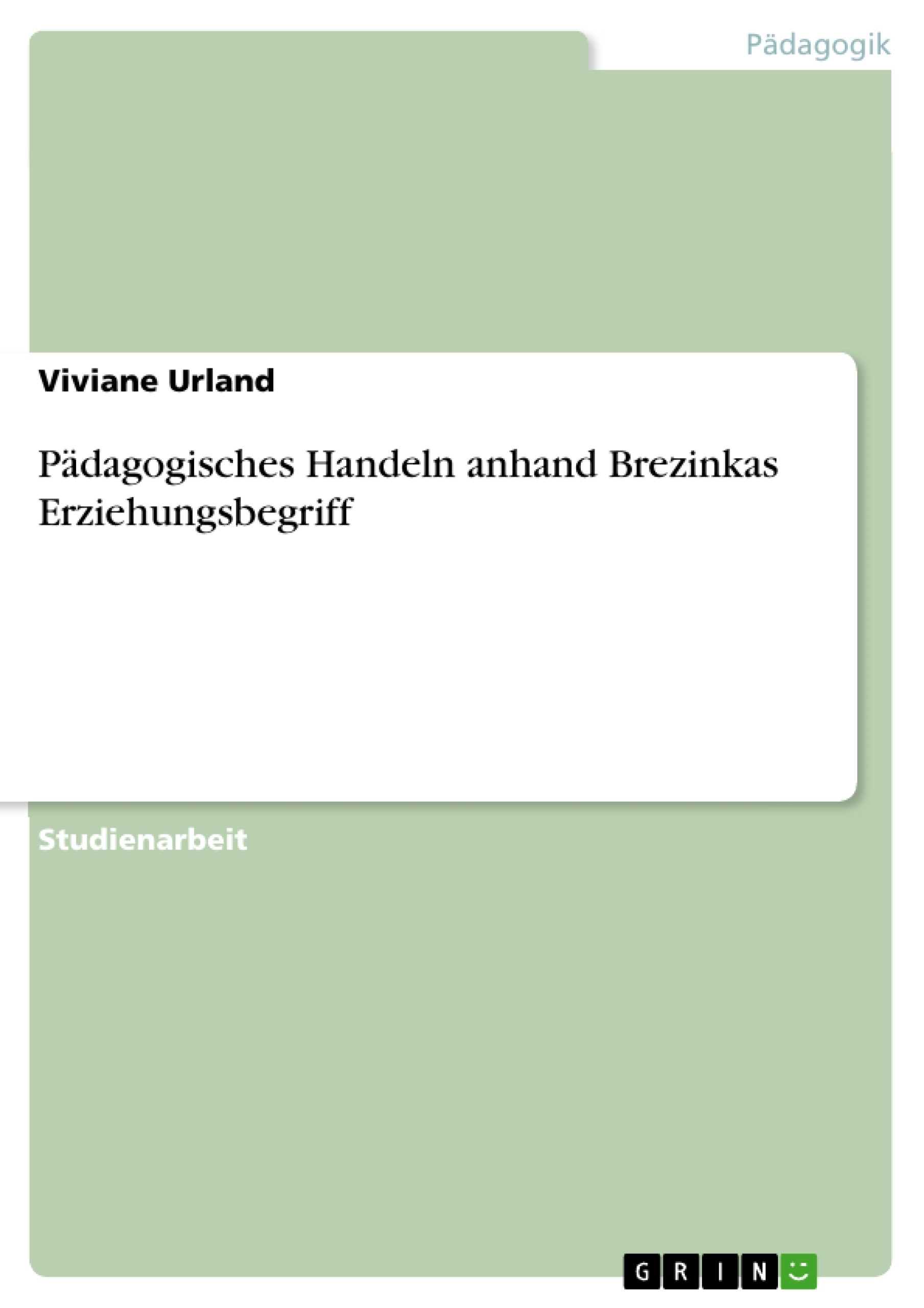Was ist pädagogisches Handeln und wie wird „richtig“ pädagogisch gehandelt? Mit dieser Fragestellung befasst sich die nachfolgende Hausarbeit und geht dabei auf die Ziele des pädagogischem Handelns ein. Grundlage bildet hierfür der Erziehungsbegriff von Wolfgang Brezinka, ein deutsch-österreichischer Erziehungswissenschaftler, welcher in seiner „Metatheorie der Erziehung“ drei Klassen von Theorien unterscheidet: die Erziehungswissenschaft, die Philosophie der Erziehung und die Praktische Pädagogik.
Nach der Definition von Brezinkas Erziehungsbegriff wird die Kritik von Kron an Brezinka dargestellt. Zum Ende soll ein aktueller Bezug hergestellt werden, welcher auf Brezinkas Erziehungsbegriffs und das pädagogische Handeln von Prange und Strobel-Eisele zurückgeführt werden soll.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1 Was ist pädagogisches Handeln?
- 1.1 Die Ziele pädagogischen Handelns
- 2 Der Erziehungsbegriff der Gegenwart: Brezinka und Kron
- 2.1 Der Erziehungsbegriff nach Brezinka
- 2.2 Der Erziehungsbegriff nach Kron mit Kritik an Brezinka
- 3 Das Problem des päd. Handelns anhand Brezinkas Erziehungsbegriff
- 4 Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, was pädagogisches Handeln ist und wie man "richtig" pädagogisch handelt. Sie untersucht die Ziele des pädagogischen Handelns und stützt sich dabei auf den Erziehungsbegriff von Wolfgang Brezinka, der drei Klassen von Theorien unterscheidet. Die Arbeit analysiert die Kritik von Kron an Brezinkas Erziehungsbegriff und stellt einen aktuellen Bezug zu Brezinkas Theorien und dem pädagogischen Handeln von Prange und Strobel-Eisele her.
- Das Wesen und die Ziele pädagogischen Handelns
- Der Erziehungsbegriff nach Brezinka und seine Kritik durch Kron
- Die Bedeutung von "Lernen" als Ziel pädagogischen Handelns
- Die Herausforderungen des pädagogischen Handelns in der heutigen Zeit
- Der Bezug von Brezinkas Erziehungsbegriff zum praktischen pädagogischen Handeln
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition von pädagogischem Handeln. Es erläutert die unterschiedlichen Handlungsformen und die Bedeutung des sozialen Handelns im pädagogischen Kontext. Kapitel 1.1 behandelt die Ziele pädagogischen Handelns und die Unterscheidung zwischen früheren und gegenwärtigen Zielsetzungen. Es wird hervorgehoben, dass "Lernen" als das zentrale Ziel pädagogischen Handelns gilt.
Das zweite Kapitel stellt zwei unterschiedliche Auffassungen des Erziehungsbegriffs vor: den Erziehungsbegriff nach Brezinka, der Erziehung als Beeinflussung psychischer Dispositionen versteht, und den Erziehungsbegriff nach Kron, der Erziehung als symbolische Interaktion definiert. Die Arbeit erläutert die wissenschaftstheoretischen Ansätze der beiden Pädagogen und ihre unterschiedlichen Perspektiven auf Erziehung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Pädagogisches Handeln, Erziehungsbegriff, Wolfgang Brezinka, Friedrich W. Kron, Lernen, Handlungsformen, Soziales Handeln, pädagogische Differenz, Lebenslanges Lernen, Empirische Erziehungswissenschaft, Kritische Erziehungswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert Wolfgang Brezinka als Erziehung?
Brezinka versteht Erziehung als den Versuch, die psychischen Dispositionen eines Menschen dauerhaft zu beeinflussen oder zu verbessern (Beeinflussungsbegriff).
Was ist der Unterschied zwischen Erziehungswissenschaft und Praktischer Pädagogik?
Brezinka unterscheidet drei Klassen: Die Erziehungswissenschaft (empirisch), die Philosophie der Erziehung (normativ) und die Praktische Pädagogik (handlungsorientiert).
Welche Kritik übt Friedrich Kron an Brezinka?
Kron kritisiert den einseitigen Beeinflussungsbegriff und definiert Erziehung stattdessen als symbolische Interaktion zwischen gleichberechtigten Partnern.
Warum ist "Lernen" das zentrale Ziel pädagogischen Handelns?
In der modernen Pädagogik gilt Lernen als die notwendige Reaktion des Zöglings, ohne die Erziehung nicht erfolgreich sein kann.
Was versteht man unter der "pädagogischen Differenz"?
Es bezeichnet den Unterschied zwischen dem beabsichtigten Handeln des Erziehers und dem tatsächlichen Lernerfolg beim Kind.
- Quote paper
- Viviane Urland (Author), 2015, Pädagogisches Handeln anhand Brezinkas Erziehungsbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308644